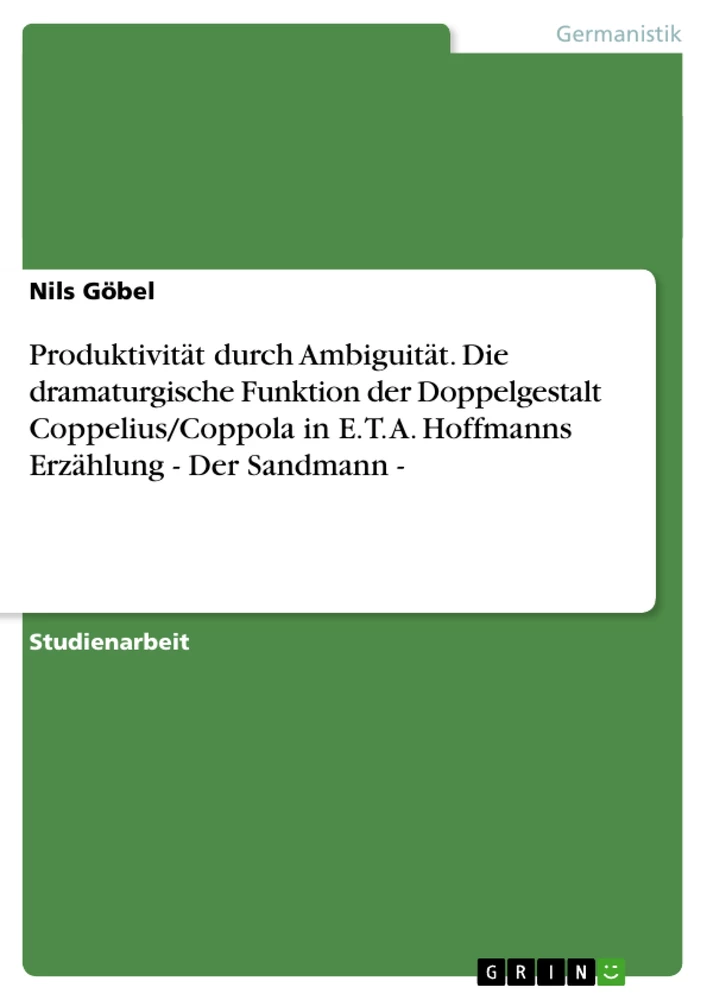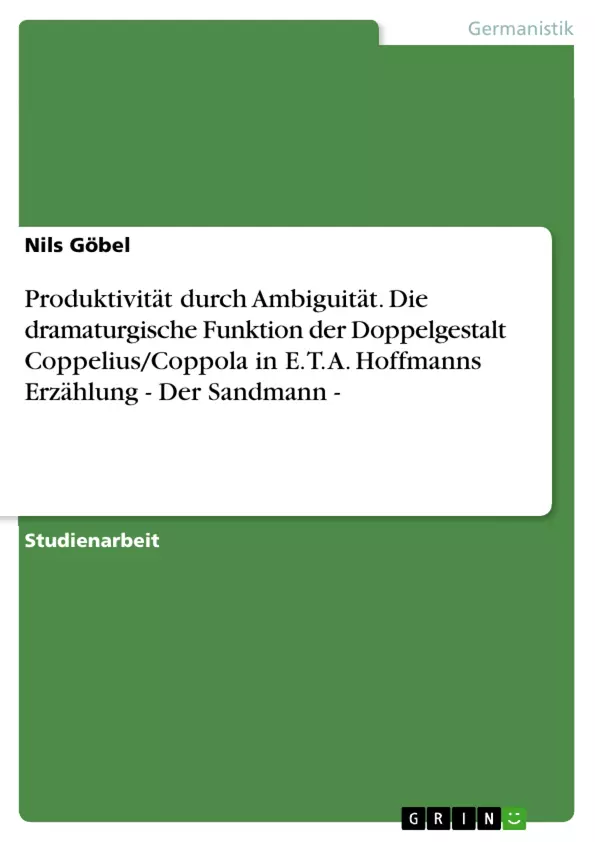E. T. A. Hoffmanns Erzählung Der Sandmann, die Ende 1816 im ersten Band der Nachtstücke erschienen ist, unterscheidet sich von der phantastischen Literatur seiner Zeit. Bei ihm kommt es zu einem - jedoch nicht völlig offensichtlichen - "′Einbruch′ des Unerhörten in die reale Welt der handelnden Personen" , wenn man diese Definition der Phantastik gelten läßt. Doch darüber hinaus thematisiert er die Reaktionen der Charaktere auf diesen Einbruch, dieses Aufreißen der Grenzen der Realität.
Dieser Aufsatz soll vor allem klären, zu welchen Interpretationsmustern die objektiven Figuren anhand der schauerlichen und phantastischen Erscheinung des Sandmannes tendieren und welcher Nutzen aus der nicht aufgelösten Identitätsfrage der doppelbödigen Gestalt Coppelius/Coppola gezogen wird. Dazu wird zu klären sein, welche Stellung der Sandmann in Nathanaels Bewußtsein hat, was Coppelius/Coppola beabsichtigt, und welche Aufschlüsse im Text und in der Sekundärliteratur zur Charakteristik und Herkunft dieser Gestalt gegeben werden.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Sandmann als mythische Reminiszenz Nathanaels
- Bedeutung des Wortes 'Sandmann' im 18. und 19. Jahrhundert
- Experimente des Coppelius/ Coppola
- Determinismus, Indeterminismus oder Fatalismus?
- Coppelius/ Coppola- Ambiguität eines Doppelgängers
- Auswirkungen des Sandmannes auf Nathanaels Wahrnehmung
- Fazit
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der vorliegende Aufsatz analysiert die dramaturgische Funktion der Doppelgestalt Coppelius/Coppola in E. T. A. Hoffmanns Erzählung "Der Sandmann" und untersucht, wie diese Figur die Interpretationsmuster der Figuren in der Geschichte beeinflusst. Der Aufsatz beleuchtet die Rolle des Sandmannes in Nathanaels Bewusstsein und analysiert die Absichten von Coppelius/Coppola.
- Die mythische Reminiszenz des Sandmannes in Nathanaels Kindheitserinnerungen
- Die Ambiguität der Doppelgestalt Coppelius/Coppola und ihre Bedeutung für die Interpretation der Geschichte
- Die Auswirkungen des Sandmannes auf Nathanaels Wahrnehmung und seine psychische Entwicklung
- Die Frage nach Determinismus, Indeterminismus oder Fatalismus in der Erzählung
- Die Verbindung von realen und phantastischen Elementen in der Erzählung und deren Bedeutung für die Charakterentwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Der erste Teil des Aufsatzes beleuchtet die mythische Reminiszenz des Sandmannes in Nathanaels Kindheitserinnerungen. Der Fokus liegt auf der Analyse des ersten Briefes, in dem Nathanael seinen Freund Lothar über seine Begegnung mit Coppelius informiert. Dieser Brief zeigt die starke Präsenz der Figur in Nathanaels Erinnerung und unterstreicht ihre Bedeutung für seine Entwicklung.
Die folgenden Kapitel widmen sich der Bedeutung des Wortes "Sandmann" im 18. und 19. Jahrhundert und untersuchen die Experimente des Coppelius/Coppola. Dabei wird die Ambiguität der Doppelgestalt hervorgehoben und die Frage nach Determinismus, Indeterminismus oder Fatalismus in der Erzählung behandelt.
Schlüsselwörter
E. T. A. Hoffmann, "Der Sandmann", Doppelgestalt, Coppelius/Coppola, Sandmann, Ambiguität, Mythische Reminiszenz, Determinismus, Indeterminismus, Fatalismus, Phantastik, Realität, Wahrnehmung, psychische Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Gestalt Coppelius/Coppola in E. T. A. Hoffmanns „Der Sandmann“?
Coppelius/Coppola fungiert als eine doppelbödige Gestalt, deren ungeklärte Identität die Grenze zwischen Realität und Wahnsinn verwischt und Nathanaels traumatische Kindheitserinnerungen triggert.
Was symbolisiert der „Sandmann“ in Nathanaels Bewusstsein?
Der Sandmann ist eine mythische Schreckgestalt aus Nathanaels Kindheit, die mit dem Verlust der Augen und dem Tod seines Vaters verknüpft ist und seine psychische Entwicklung tiefgreifend beeinflusst.
Worum geht es in dem ersten Brief von Nathanael?
Nathanael informiert seinen Freund Lothar über seine Begegnung mit dem Wetterglashändler Coppola, den er für den grausamen Advokaten Coppelius aus seiner Kindheit hält.
Was wird unter der „Ambiguität des Doppelgängers“ verstanden?
Es bleibt unklar, ob Coppelius und Coppola tatsächlich dieselbe Person sind oder ob diese Identität lediglich ein Produkt von Nathanaels gestörter Wahrnehmung ist.
Wie unterscheidet sich Hoffmanns Werk von der Phantastik seiner Zeit?
Hoffmann thematisiert besonders die psychologischen Reaktionen der Charaktere auf den „Einbruch des Unerhörten“ in die reale Welt, anstatt nur das Übernatürliche als solches darzustellen.
Welche philosophischen Fragen wirft die Erzählung auf?
Der Text diskutiert Fragen nach Determinismus, Indeterminismus und Fatalismus – also ob Nathanaels Schicksal vorbestimmt ist oder durch seine eigene Psyche gelenkt wird.
- Quote paper
- Nils Göbel (Author), 2001, Produktivität durch Ambiguität. Die dramaturgische Funktion der Doppelgestalt Coppelius/Coppola in E. T. A. Hoffmanns Erzählung - Der Sandmann -, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5536