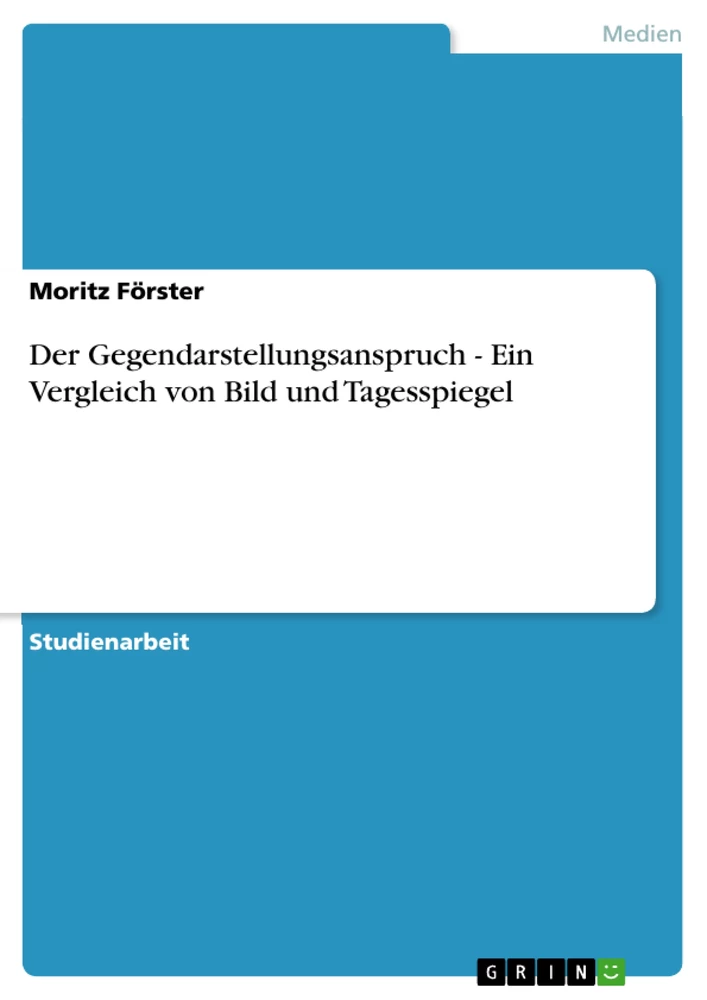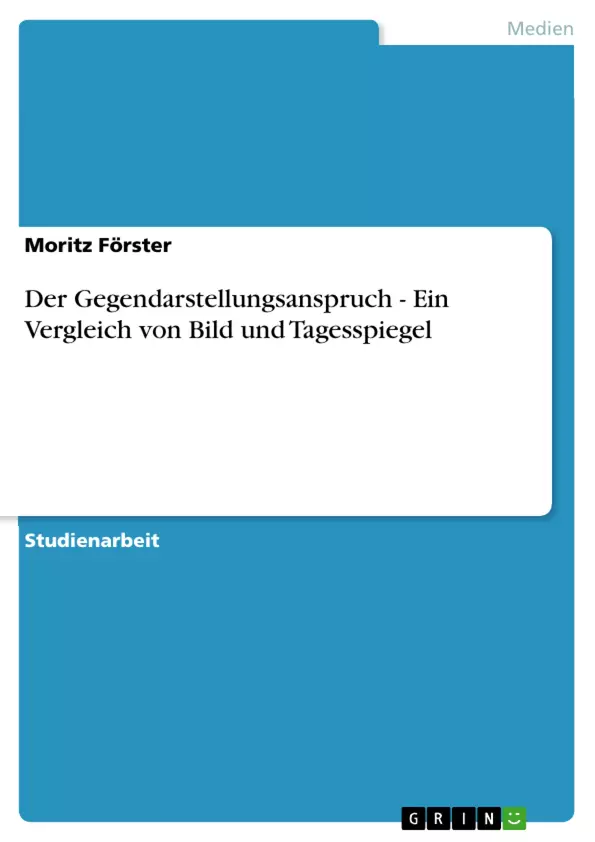Von den Medien gefürchtet, von den Betroffenen als Waffe genutzt – die Gegendarstellung zwingt die Medien zum Abdruck der Ansicht der Betroffenen. Was für Medienmacher eher eine lästige Pflicht ist, empfinden die Bürger als angenehmes Recht. Vor allem, weil die Medien seitens des Gesetzes zu dieser Maßnahme gezwungen werden, sie also nicht in freien Stücken über Inhalt und Form entscheiden können, wird die Gegendarstellung teilweise als krasser Eingriff in die Pressefreiheit gewertet.
Andererseits garantiert diese rechtliche Regelung, dass die Persönlichkeitsrechte der Bürger und Bürgerinnen gewahrt werden und speziell der Aspekt der informationellen Selbstbestimmung garantiert wird.
Auch hat die Existenz der Gegendarstellung eine sichernde Funktion in Bezug zur journalistischen Qualität, regt sie doch die Journalisten zu einer „gründlichen und fairen Recherche“ an. Schließlich muss der Journalist, um einer Gegendarstellung vorzubeugen, beide Parteien zum jeweiligen Fall zu Wort kommen lassen. Letzt genanntes ist ein unumstrittenes journalistisches Qualitätsmerkmal, um eine möglichst objektive und ausgewogene Berichterstattung zu ermöglichen. Nur sorgfältigste Recherche und saubere journalistische Arbeit können die Gefahr eines Gegendarstellungsanspruchs auf ein Minimum senken, wenn auch nicht immer gänzlich ausräumen. Schwierig wird dies vor allem, wenn ein Betroffener von vorneherein keine Stellung zu Vorwürfen nimmt, die seine Person betreffen.
Die Wurzeln der Gegendarstellungen beruhen auf dem französischen Entwurf des „droit de résponse“, der 1831 in Deutschland übernommen wurde und 1874 in den Reichspressegesetzen verankert wurde (Kapitel 2.1). Kennzeichnend für die deutsche Rechtsprechung ist seit dem letztgenannten Zeitpunkt, dass der Anspruch sich ausschließlich gegen Tatsachenbehauptungen richtet.
Während die Reichspressegesetze Bundesländer übergreifend galten, ist die mediale Gesetzgebung heutzutage Ländersache. Allerdings kann sich der Anspruch auf das durch das Grundgesetz gesicherte allgemeine Persönlichkeitsrecht berufen (Kapitel 2.2). Indes kann es durchaus passieren, dass unterschiedliche Landesgerichte die Rechtslage tendenziell unterschiedlich auslegen. Es heißt, einige seien Medien freundlicher, andere Medien feindlicher.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gegendarstellung: Entstehungsgeschichte und Idee
- ,,Droit de response"
- Die Gegendarstellung in Deutschland
- Rechtliche Aspekte des Anspruchs
- Operationalisierung
- Bild
- Tagesspiegel
- Ergebnisse
- Quantitative Auswertung
- Qualitative Auswertung
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Gegendarstellungsanspruch im deutschen Rechtssystem und analysiert dessen Anwendung anhand eines Vergleichs zwischen der Bild-Zeitung und dem Tagesspiegel. Dabei stehen die rechtlichen Grundlagen, die Entstehungsgeschichte des Anspruchs und die konkrete Umsetzung in der Praxis im Vordergrund.
- Rechtliche Grundlagen und Geschichte des Gegendarstellungsanspruchs
- Vergleich der Anwendung des Anspruchs in der Bild-Zeitung und dem Tagesspiegel
- Einfluss des journalistischen Stils auf die Gefahr von Gegendarstellungen
- Schutz der allgemeinen Persönlichkeitsrechte durch das Gegendarstellungsrecht
- Bewertung der Funktionsweise des Gegendarstellungsanspruchs in der heutigen Medienlandschaft
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Gegendarstellungsanspruch als Instrument des Persönlichkeitsschutzes in der deutschen Medienlandschaft vor. Es werden die Relevanz des Anspruchs, die Kritik an seiner Eingriffsqualität und die Notwendigkeit zur Analyse in Bezug auf die Medienlandschaft beleuchtet.
- Gegendarstellung: Entstehungsgeschichte und Idee: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Gegendarstellungsrechts, insbesondere das französische „droit de résponse“, und seine Übertragung auf das deutsche Rechtssystem. Es werden die zentralen Ziele und Funktionen des Anspruchs sowie seine Relevanz im Spannungsfeld von Pressefreiheit und Persönlichkeitsrecht behandelt.
- Rechtliche Aspekte des Anspruchs: In diesem Kapitel werden die rechtlichen Grundlagen des Gegendarstellungsanspruchs, insbesondere die Verankerung im Berliner Landespressegesetz und im allgemeinen Persönlichkeitsrecht, erläutert. Es wird auf die Unterschiede in der Auslegung durch Landesgerichte eingegangen und die Bedeutung der einheitlichen Anwendung für den Vergleich von Zeitungen hervorgehoben.
- Operationalisierung: Dieses Kapitel beschreibt die Methodik der Untersuchung, insbesondere die Auswahl der Zeitungen, die Festlegung des Zeitraums und die Definition der relevanten Daten für die Analyse.
- Bild: Das Kapitel befasst sich mit der Bild-Zeitung und analysiert deren Praxis im Umgang mit Gegendarstellungen. Es wird untersucht, ob der Boulevard-Stil der Zeitung zu einer höheren Anzahl von Gegendarstellungsansprüchen führt. Die Ergebnisse werden im Hinblick auf den Einfluss des journalistischen Stils auf die Gefahr von Gegendarstellungen interpretiert.
- Tagesspiegel: Analog zu Kapitel 5 betrachtet dieses Kapitel den Umgang mit Gegendarstellungen im Tagesspiegel. Es werden die Ergebnisse mit denen der Bild-Zeitung verglichen, um die Unterschiede in der Praxis und die Auswirkungen auf den Schutz der Persönlichkeitsrechte zu analysieren.
Schlüsselwörter
Gegendarstellungsanspruch, Pressefreiheit, Persönlichkeitsrecht, Medienrecht, Boulevard-Journalismus, Tatsachenbehauptung, Meinungsäußerung, Medienlandschaft, Rechtsschutz, Medienvergleich, Bild-Zeitung, Tagesspiegel, Rechtliche Grundlagen, Berliner Landespressegesetz, Grundgesetz.
Häufig gestellte Fragen
Was ist ein Gegendarstellungsanspruch?
Es ist das Recht einer Person, auf eine in den Medien veröffentlichte Tatsachenbehauptung mit einer eigenen Darstellung der Fakten zu reagieren.
Gegen welche Art von Aussagen kann man eine Gegendarstellung erwirken?
Der Anspruch richtet sich ausschließlich gegen Tatsachenbehauptungen, nicht gegen Meinungsäußerungen oder Werturteile.
Woher stammt das Konzept der Gegendarstellung?
Die Wurzeln liegen im französischen „droit de réponse“, das im 19. Jahrhundert in das deutsche Recht übernommen wurde.
Wie unterscheiden sich Bild und Tagesspiegel im Umgang mit Gegendarstellungen?
Die Arbeit analysiert, ob der Boulevard-Stil der Bild-Zeitung häufiger zu Gegendarstellungen führt als die Berichterstattung des eher seriösen Tagesspiegels.
Ist das Gegendarstellungsrecht ein Eingriff in die Pressefreiheit?
Während Medienmacher es oft als lästige Pflicht empfinden, dient es rechtlich dem Schutz der Persönlichkeitsrechte und der informationellen Selbstbestimmung der Bürger.
- Arbeit zitieren
- Moritz Förster (Autor:in), 2006, Der Gegendarstellungsanspruch - Ein Vergleich von Bild und Tagesspiegel, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55465