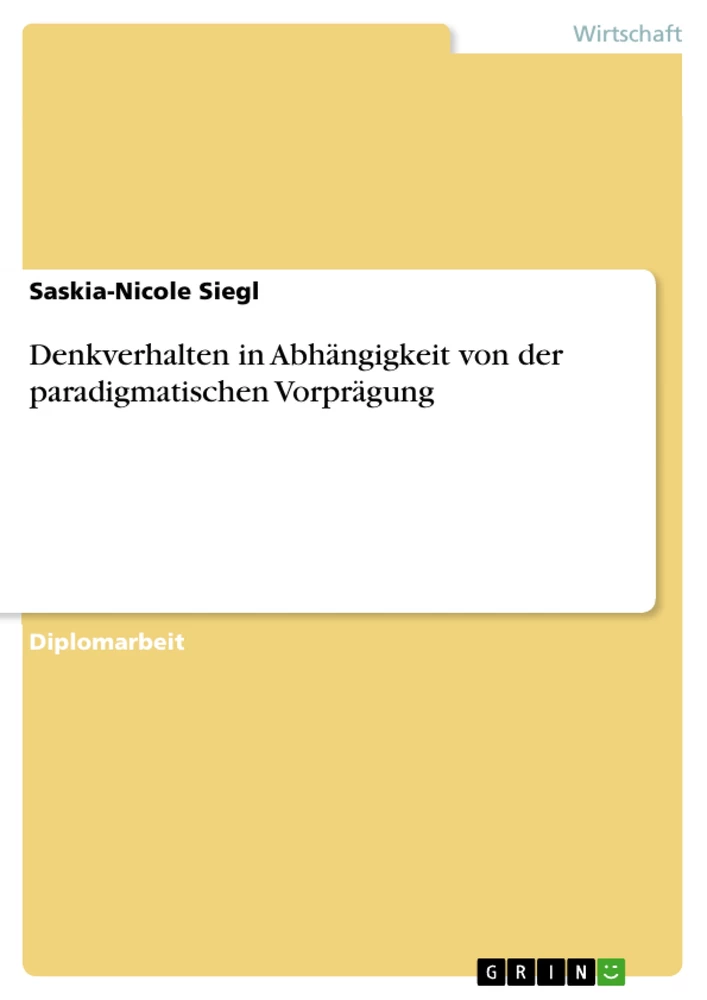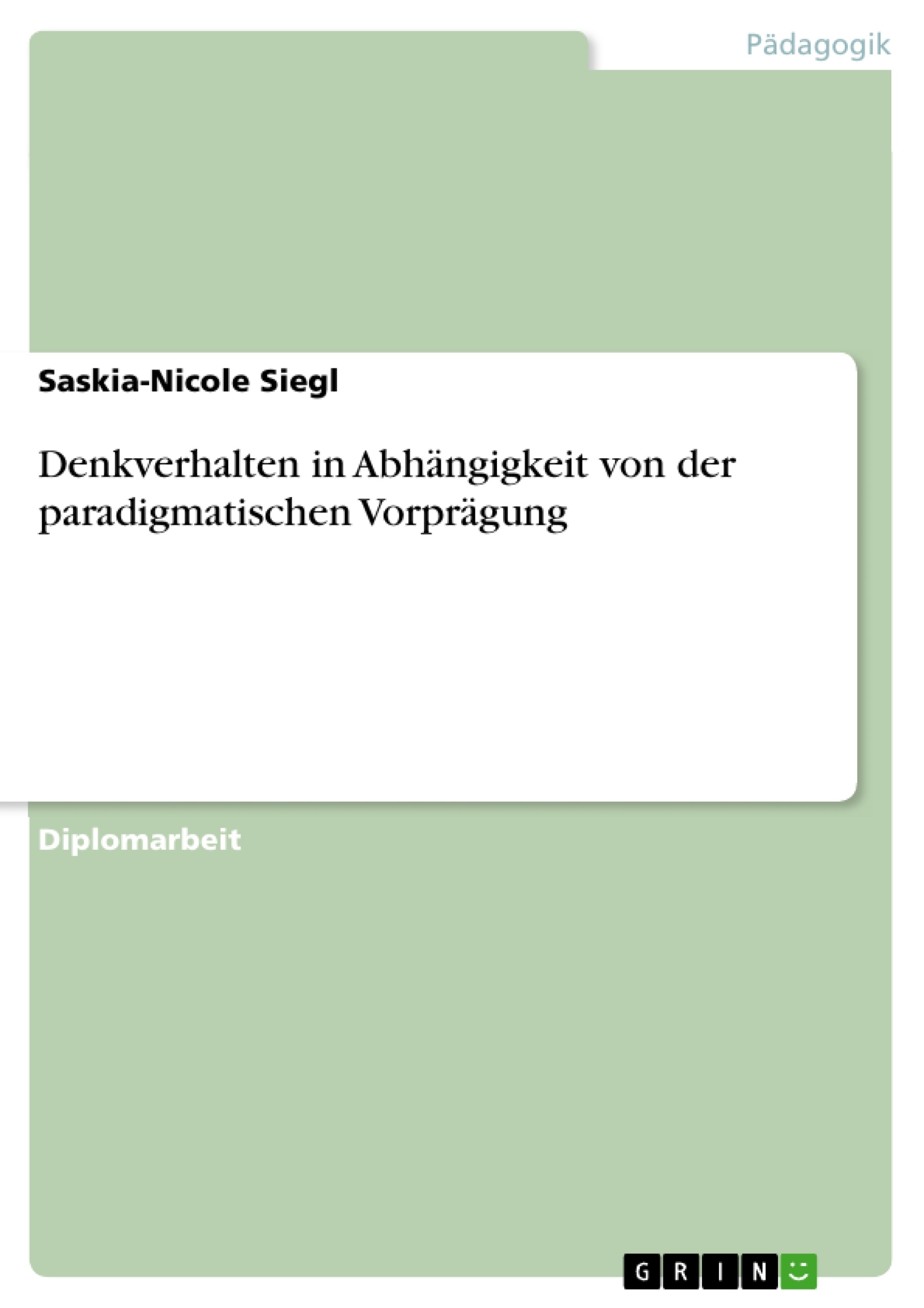Die Fähigkeit zu kommunizieren ist eines der wichtigsten Merkmale, die ein Lebewesen ausmachen. Für uns Menschen bietet die „gemeinsame Sprache“ die bedeutendste Möglichkeit, Mitteilungen und Nachrichten verbal auszutauschen. Obwohl die zwischenmenschliche Kommunikation innerhalb einer Sprache meist beabsichtigt, eindeutig zu sein, reden Menschen oft „aneinander vorbei“. Die Auswirkungen von falsch verstandenen Nachrichten können vielschichtig sein. Seit langem - die erste Beschreibung des Kommunikationsprozesses erfolgte durch Harold Lasswell im Jahre 19481- untersucht die Kommunikationsforschung die Ursachen einer „unbeabsichtigt fehlerhaften“ Kommunikation. Aus den Ergebnissen haben Denker verschiedene Theorien entwickelt, wie die Entstehung von Missverständnissen verstanden und dadurch möglicherweise vermieden werden können.
Die vorliegende Arbeit sucht ebenfalls nach einem Grund für Missverständnisse in der zwischenmenschlichen Kommunikation, deren Inhalt ein zu lösendes Problem ist. Die Suche beschäftigt sich dabei mit logischem, nachvollziehbarem Denken und vernachlässigt emotionales Denken, da es keinen logischen, nachvollziehbaren Regeln folgt.
Meine Überlegungen beginnen bei der Überzeugung, dass Menschen sich nicht eindeutig und nachvollziehbar miteinander unterhalten können, wenn sie unterschiedlich denken und die zu besprechenden Probleme auf unterschiedlichem Wege lösen wollen. Es wird angenommen, dass das unterschiedliche Denken auf einer unterschiedlichen paradigmatischen Vorprägung basiert.
Ziel der Arbeit ist es, Anhaltspunkte für die Existenz einer unterschiedlichen (individuellen) paradigmatischen Vorprägung zu finden und, falls sich eine paradigmatische Vorprägung isolieren lässt, Umsetzungsvorschläge für ihre Berücksichtigung zu erarbeiten.
Inhaltsverzeichnis
- A. Ziel und Aufbau der Arbeit
- B. Die wissenschaftstheoretischen Paradigmen als Basis für die paradigmatische Vorprägung
- I. Der Kritische Rationalismus
- 1. Geschichte
- 2. Ziel
- 3. Kennzeichnung des wissenschaftstheoretischen Paradigmas
- a. Der Entdeckungszusammenhang
- b. Der Begründungszusammenhang
- C. Der Verwertungs- und Wirkungszusammenhang
- 4. Graphische Zusammenfassung zum Kritischen Rationalismus
- 5. Der Kreislauf des forschungslogischen Ablaufs
- II. Die Hermeneutik
- 1. Geschichte
- 2. Ziel
- 3. Kennzeichnung des wissenschaftstheoretischen Paradigmas
- a. Der Hermeneutische Zirkel I
- b. Der Hermeneutische Zirkel II
- 4. Zusammenfassung zur Hermeneutik
- III. „Verstehen“ vs. „Erklären“
- IV. Zuteilung der Wissenschaften zu den zwei Paradigmen
- V. Tabellarischer Vergleich der zwei Paradigmen
- C. Die Offenlegung der paradigmatischen Vorprägung
- I. Die zwei Seiten des menschlichen Gehirns
- 1. Die Funktionsspezialisierung
- 2. Exkurs
- 3. Die Verbindung zwischen der Arbeitsweise des Gehirns und den wissenschaftstheoretischen Paradigmen
- a. Die linke Gehirnhälfte
- IIb. Die rechte Gehirnhälfte
- 4. Fazit
- II. Lernstile
- 1. Definition des Begriffs „Lernstil“
- 2. Die Lernstil-Typologie nach David A. Kolb
- a. Die vier Lernstil-Typen
- b. Die Verbindung zwischen Kolbs Lernstil-Typologie und den wissenschaftstheoretischen Paradigmen
- 3. Exkurs
- 4. Fazit
- III. Problemlösemethoden
- 1. Was ist ein Problem?
- 2. Problemlösearten nach Dörner
- a. Das Interpolationsproblem
- b. Das synthetische Problem
- C. Das dialektische Problem
- 3. Fazit
- IV. Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel C
- D. Umsetzung in der beruflichen Weiterbildung
- I. Rahmenbedingungen
- II. Der Vortrag
- 1. Definition, Merkmale und allgemeine Regeln
- 2. Möglichkeiten der Berücksichtigung der paradigmatischen Vorprägung im Rahmen eines Vortrages
- a. Der kritisch rational denkende Teilnehmerkreis
- b. Der hermeneutisch denkende Teilnehmerkreis
- III. Die Gruppenarbeit
- 1. Definition, Merkmale und allgemeine Regeln
- 2. Möglichkeiten der Berücksichtigung der paradigmatischen Vorprägung im Rahmen der Gruppenarbeit
- IV. Zusammenfassung der Ergebnisse aus Kapitel D
- E. Mögliche Kommunikationsregeln
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Menschen trotz gemeinsamer Sprache "aneinander vorbei" reden können, insbesondere wenn es um die Diskussion von Problemen geht. Die Arbeit geht davon aus, dass unterschiedliche Denkstile, die auf verschiedenen paradigmatischen Vorprägungen basieren, eine Rolle spielen. Ziel ist es, Anhaltspunkte für die Existenz dieser individuellen Vorprägungen zu finden und, falls eine solche isoliert werden kann, Umsetzungsvorschläge für deren Berücksichtigung zu entwickeln.
- Die wissenschaftstheoretischen Paradigmen des Kritischen Rationalismus und der Hermeneutik als Basis für unterschiedliche Denkstile
- Die Rolle der beiden Gehirnhälften und deren Arbeitsweisen für den Denkprozess
- Die Lernstil-Typologie nach David A. Kolb und ihre Verbindung zu den wissenschaftstheoretischen Paradigmen
- Die verschiedenen Arten von Problemlösemethoden nach Dörner und ihre Beziehung zu den Denkstilen
- Mögliche Umsetzungsvorschläge für die Berücksichtigung paradigmatischer Vorprägungen in der beruflichen Weiterbildung, speziell im Kontext von Vorträgen und Gruppenarbeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel A stellt das Ziel und den Aufbau der Arbeit vor. Es wird das Problem der "unbeabsichtigt fehlerhaften" Kommunikation angesprochen und die zentrale These aufgestellt, dass unterschiedliche Denkstile, basierend auf verschiedenen paradigmatischen Vorprägungen, zu Missverständnissen führen können.
Kapitel B beleuchtet die beiden Wissenschaftstheorien des Kritischen Rationalismus und der Hermeneutik. Die Kapitel untersuchen jeweils die Geschichte, Ziele und Kennzeichen der beiden Paradigmen sowie deren Anwendung in unterschiedlichen Wissenschaftsbereichen. Es wird gezeigt, wie diese beiden Ansätze verschiedene Denkweisen und Herangehensweisen an Probleme repräsentieren.
Kapitel C befasst sich mit der Offenlegung der paradigmatischen Vorprägung. Die Kapitel analysieren die unterschiedlichen Funktionsbereiche der Gehirnhälften und ihre Auswirkungen auf den Denkprozess. Es wird die Lernstil-Typologie nach Kolb vorgestellt und deren Verbindung zu den wissenschaftstheoretischen Paradigmen untersucht. Schließlich werden verschiedene Problemlösemethoden nach Dörner betrachtet und deren Zusammenhang mit den Denkstilen aufgezeigt.
Kapitel D widmet sich der Umsetzung der Erkenntnisse in die berufliche Weiterbildung. Es werden die Rahmenbedingungen für die Berücksichtigung der paradigmatischen Vorprägung im Rahmen von Vorträgen und Gruppenarbeiten beleuchtet und konkrete Möglichkeiten zur Gestaltung von Lernveranstaltungen aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter der Arbeit sind: paradigmatische Vorprägung, kritischer Rationalismus, Hermeneutik, Denkstile, Gehirnhälften, Lernstile, Problemlösemethoden, berufliche Weiterbildung, Kommunikation.
Häufig gestellte Fragen
Warum kommt es trotz gemeinsamer Sprache zu Missverständnissen?
Ein Hauptgrund ist die unterschiedliche paradigmatische Vorprägung, die dazu führt, dass Menschen Probleme auf logisch unterschiedliche Weise angehen.
Was unterscheidet den Kritischen Rationalismus von der Hermeneutik?
Kritischer Rationalismus zielt auf das "Erklären" durch Logik und Beweise ab, während die Hermeneutik das "Verstehen" von Sinnzusammenhängen in den Fokus rückt.
Welche Rolle spielen die Gehirnhälften beim Denken?
Die linke Gehirnhälfte wird oft mit analytischem, rationalem Denken assoziiert, während die rechte Hälfte eher für ganzheitliches, intuitives Verstehen zuständig ist.
Was sind die Lernstile nach David A. Kolb?
Kolb definiert vier Lernstil-Typen, die eng mit der Art und Weise verknüpft sind, wie Individuen Informationen verarbeiten und Probleme lösen.
Wie kann dieses Wissen in der Weiterbildung genutzt werden?
Durch die Berücksichtigung der Denkstile können Vorträge und Gruppenarbeiten so gestaltet werden, dass sowohl rational als auch hermeneutisch geprägte Teilnehmer optimal erreicht werden.
- Citation du texte
- Saskia-Nicole Siegl (Auteur), 2005, Denkverhalten in Abhängigkeit von der paradigmatischen Vorprägung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55491