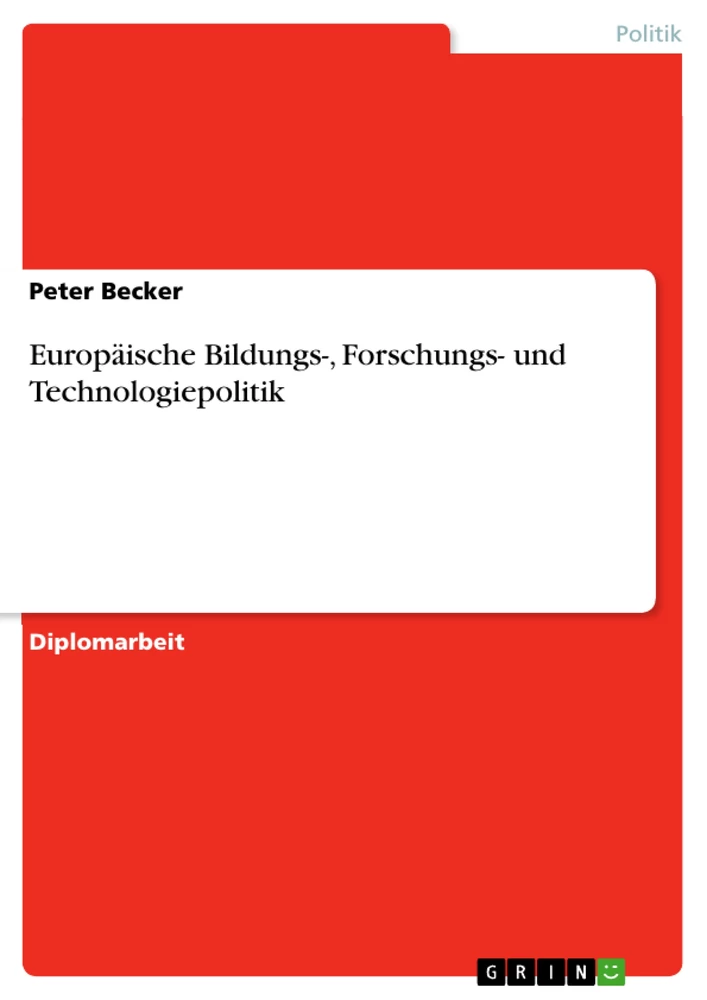Bildung, die Fortsetzung in der Forschung und deren Ergebnisse in Form von technologischen Errungenschaften, haben insbesondere in der Neuzeit eine zunehmend starke, dynamische Entwicklung genommen. Immer wieder haben „Quantensprünge der Wissenschaft“ die Menschheit im gerade beschriebenen Kreislauf bewegt. Beispielsweise gab es die Entdeckung der atomaren Kräfte und des von ihr verursachten Paradigmenwechsels in der Naturwissenschaft. Ganz abgesehen von den Auswirkungen auf die Wissenschaft selbst, hat beispielsweise die Erfindung des Lasers, einer Anwendung der Quantenmechanik, der Menschheit als Hilfsmittel in vielen Anwendungen gute Dienste geleistet und somit die Vorleistungen amortisiert. Analog zu den gesellschaftlichen Auswirkungen des Lasers, hat Jahrtausende früher, die Erfindung des Rades ermöglicht, mehr über die Umwelt zu erfahren, indem es den Aktionsradius des Menschen erhöhte. Worauf ich mit dieser Argumentation hinweisen möchte, ist, daß immer wieder epochale Erfindungen dem Menschen eine effizientere Nutzung der ihm zur Verfügung stehenden Ressourcen ermöglichten. Die Empirie, ebenfalls ein Meilenstein der Wissenschaftsgeschichte, hat die bereits erwähnte, dynamische Entwicklung im modernen Sinne, vielleicht erst ermöglicht. Welche Ursachen führen zu solch epochalen Meliorationen? Welche Rahmenbedingungen sind nötig bzw. was sollte vermieden werden, um solche Entwicklungen zu fördern? Ist die Dynamik zurzeit zunehmend, oder abnehmend; anders gefragt: ist beispielsweise die Erfindung des Computers ein solcher Meilenstein? Dies sind Fragen, welche dieser Arbeit ursprünglich zugrunde lagen. Die politikwissenschaftliche Frage, die sich hierbei stellt, ist diejenige nach der optimalen Bereitstellung von staatlichen oder unabhängigen Ressourcen, und die Schaffung der nötigen Freiräume bzw. eines fruchtbaren Umfeldes durch die Politik. Die Unterschiedlichkeit der Herangehensweisen an den Fortschrittsgedanken ist allerdings traditionell in den verschiedenen Nationen unterschiedlich und somit auch die staatlichen Mittel, mit welchen der Fortschritt erzeugt werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitende Gedanken
- Politik im europäischen Mehrebenensystem
- Wissenschaftliche Fragestellung
- Gemeinschaftliche Bildungspolitik
- Grundlegende Begriffe und Überlegungen zu Bildung
- Bildung und ethische Maße
- Die Entwicklung hin zu supranationalen Strukturen
- Ökonomische Rechtfertigung
- Zur Humankapitaltheorie
- Wettbewerbliche Organisation des Bildungsmarktes
- Europäische Bildungspolitik bis Maastricht
- Vertragliche Rahmenbedingungen
- Kompetenzausweitung durch Sekundärrecht
- Die Rolle des EuGH im Rahmen der Bildungspolitik
- Der veränderte Bildungsauftrag der Europäischen Union
- Steuerungsinstrumente der Gemeinschaft
- Aktuelle Entwicklungen
- Hochschule als „Schrittmacher“ gemeinschaftlicher Politik
- Entwicklung im Hochschulwesen
- Gründe für Hoheitliche Eingriffe
- Finanzierungsrückstand des europäischen Hochschulwesens
- Zur Beteiligung von Bildungsempfängern an den Kosten
- Problematiken bei der Einführung von Studiengebühren
- Soziale Aspekte privat mitfinanzierter Bildungssysteme
- Qualitätssicherung in der Hochschulbildung
- Wettbewerb und Hochschulwesen und Implikationen für die supranationale Ebene
- Entwicklung einer europäischen Wissensgesellschaft
- Europäische Forschungs- und Technologiepolitik
- Legitimation staatlichen Handelns in Forschungs- und Technologiepolitik
- Zusammenhang von Investitionen, Innovation und Wachstum
- Institutionelle Verfasstheit in Deutschland, Frankreich und Großbritannien
- Regulation der Wissenschaftsausrichtung
- Entscheidungsfindung in den drei großen europäischen Forschungsnationen
- Finalität und Praktikabilität nationaler Forschungspolitik
- Blick von der nationalen auf die supranationale Ebene
- Grundlagen im Gemeinschaftsrecht
- Konsensfähige Prinzipien auf gemeinschaftlicher Ebene
- Forschungsakteure im europäischen Mehrebenensystem
- Integrationsprozeß
- Finanzierungsdimension
- Die Rolle der Europäischen Gemeinschaft in der Praxis
- Planungsverfahren und Evaluierung der Gemeinschaftsprogramme
- Die operationelle Umsetzung der Forschungsprogramme
- Aktuelle Entwicklungen und Tendenzen der Gemeinschaftspolitik
- Ausblick auf die europäische Wissens- und Forschungsgesellschaft
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit befasst sich mit der Frage, wie die Europäische Union die Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik in einem mehrstufigen System effektiv gestalten kann. Im Mittelpunkt steht die Analyse der Herausforderungen und Chancen, die sich aus der zunehmenden Vernetzung von Wissenschaft, Bildung und Wirtschaft ergeben.
- Die Entwicklung einer europäischen Wissensgesellschaft
- Die Rolle der Europäischen Union in der Bildung, Forschung und Technologiepolitik
- Die Herausforderungen der Gestaltung eines europäischen Forschungsraums
- Die Bedeutung von Investitionen in Bildung und Forschung für die Wettbewerbsfähigkeit Europas
- Die Frage nach der optimalen Balance zwischen nationaler und europäischer Steuerung in der Wissenschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitende Gedanken: Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die politische Landschaft Europas und der Notwendigkeit einer umfassenden Betrachtung der Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik.
Gemeinschaftliche Bildungspolitik: Dieses Kapitel beleuchtet die Entwicklung der europäischen Bildungspolitik, die sich von einem rein ökonomischen Ansatz hin zu einem umfassenderen Ansatz bewegt. Es werden die Herausforderungen der Qualitätssicherung und der Finanzierung von Bildungseinrichtungen, insbesondere von Hochschulen, diskutiert.
Europäische Forschungs- und Technologiepolitik: Der Fokus liegt auf den institutionellen Rahmenbedingungen und den wichtigsten Akteuren in der europäischen Forschungspolitik. Das Kapitel beleuchtet die Rolle der Europäischen Union als Förderer von Innovationen und die Herausforderungen der Koordinierung von Forschungsprojekten auf internationaler Ebene.
Schlüsselwörter
Europäische Bildungspolitik, Forschungspolitik, Technologiepolitik, Wissensgesellschaft, Humankapital, Wettbewerb, Qualitätssicherung, Finanzierung, Integration, Innovation, Forschungskooperation, Mehrstufiges System
Häufig gestellte Fragen
Was ist eine europäische Wissensgesellschaft?
Es beschreibt ein gesellschaftliches Modell, in dem Wissen, Bildung und Forschung die zentralen Treiber für wirtschaftliches Wachstum und sozialen Fortschritt sind.
Welche Kompetenzen hat die EU in der Bildungspolitik?
Die EU hat primär unterstützende Kompetenzen. Die Arbeit zeigt jedoch, wie durch Sekundärrecht und den EuGH der Einfluss der EU stetig zugenommen hat.
Was besagt die Humankapitaltheorie?
Sie sieht Bildung als ökonomische Investition, die die Produktivität des Einzelnen und damit das Wirtschaftswachstum der gesamten Union steigert.
Warum sind Studiengebühren ein kontroverses Thema?
Die Arbeit diskutiert soziale Aspekte und die Finanzierungslücken im europäischen Hochschulwesen sowie die Beteiligung der Studierenden an den Kosten.
Wie fördert die EU Forschung und Technologie?
Durch gemeinschaftliche Forschungsprogramme und die Schaffung eines europäischen Forschungsraums, um im globalen Wettbewerb zu bestehen.
- Arbeit zitieren
- Peter Becker (Autor:in), 2005, Europäische Bildungs-, Forschungs- und Technologiepolitik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55496