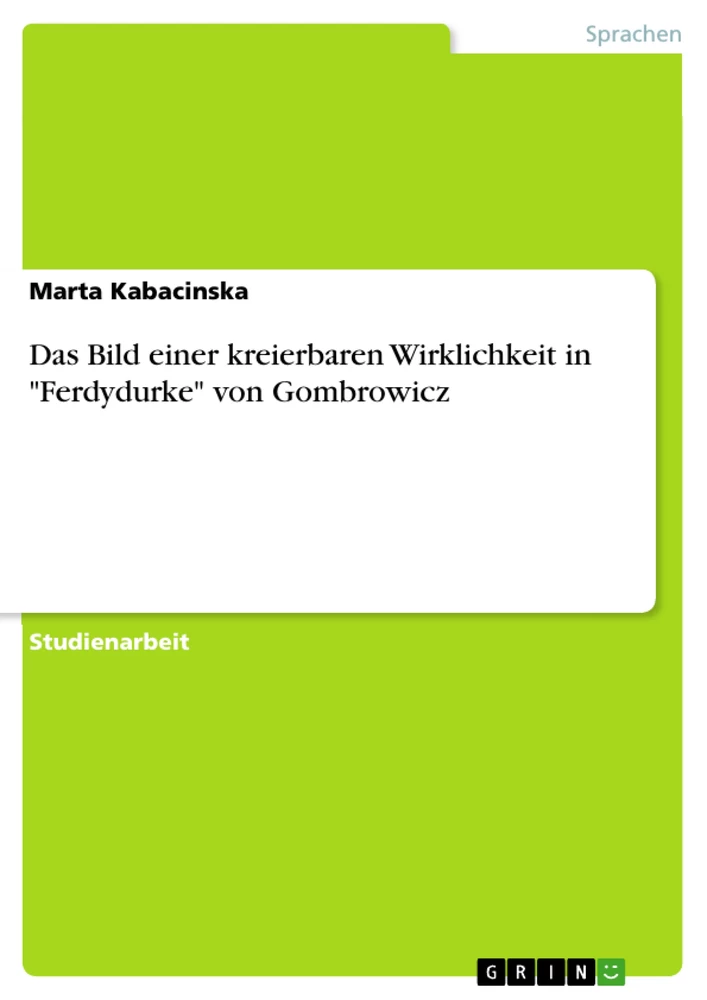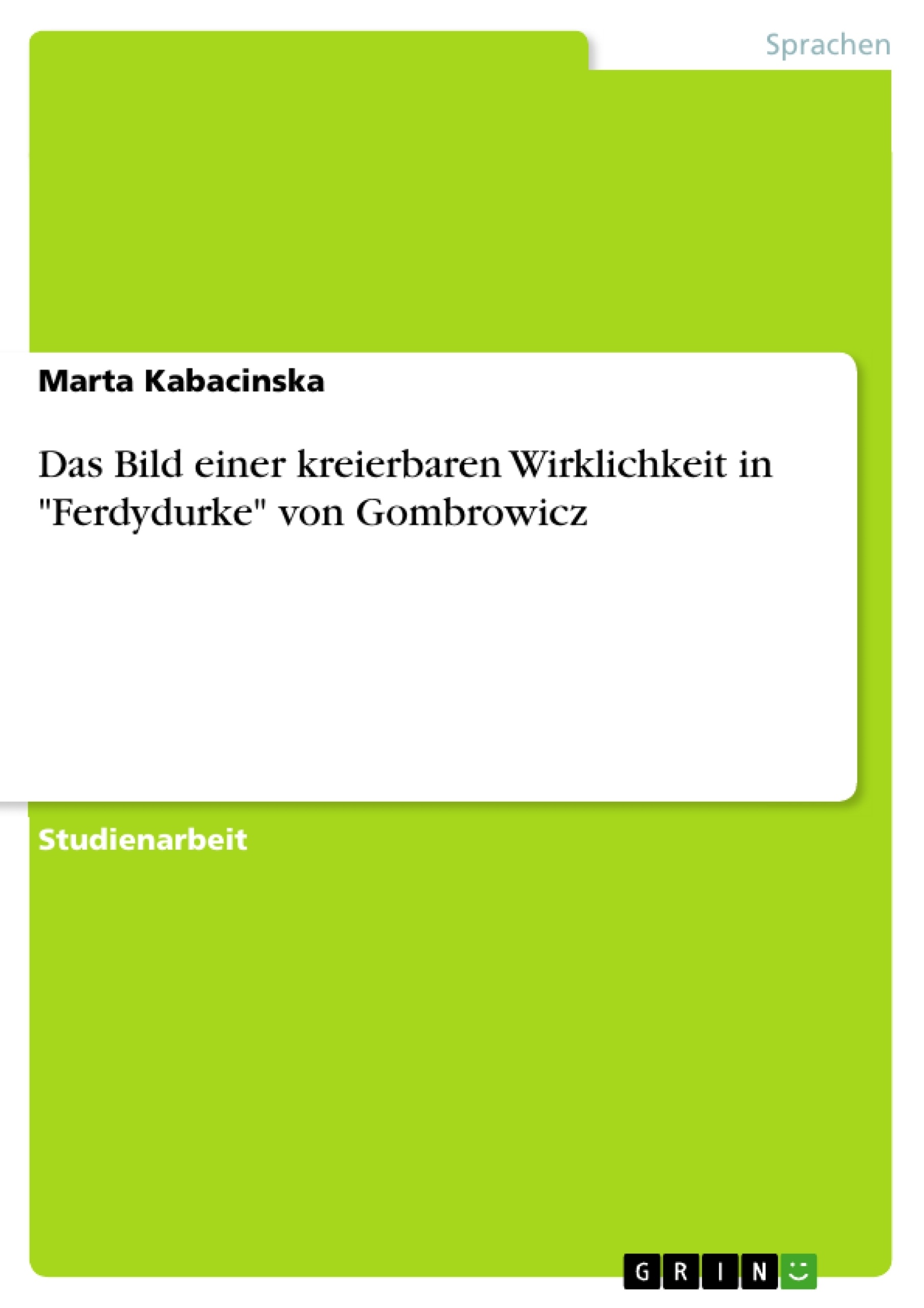Witold Gombrowicz wurde 1904 als Sohn eines polnischen Landadeligen geboren und ist einer der bedeutendsten polnischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. 1939 landete Gombrowicz als Passagier der Jungfernfahrt eines Schiffes in Argentinien, wo er vom Ausbruch des Zweiten Weltkriegs überrascht wurde und blieb dort bis 1963 in Argentinien. Danach übersiedelte er nach Frankreich und starb dort 1969.
Gombrowicz gilt als Vertreter des polnischen Existentialismus und wurde vor allem durch seine grotesken und phantastischen Erzählungen bekannt. Er stellt oft die menschliche Objektivität in Frage. Zu seiner meist bekannten Werke gehört Ferdydurke, in dem „die einzige Wahrheit“ und die autoritative Gesellschaft hinterfragt werden und die Individualität stark gelobt. Der Autor beschäftigt sich in Ferdydurke hauptsächlich mit dem Thema der Wirklichkeitswahrnehmung und der Kondition des Menschen, der diese Wirklichkeit wahrnimmt. Der Autor zeigt das Bild eines Menschen (Józio), der verschiedene „Formen“ betritt, sie demaskiert und dann verlässt.
Meine Arbeit, die sich vor allem auf Witold Gombrowiczs Werk Ferdydurke bezieht, soll in Anlehnung an seine „Theorie der Form“ die von ihm bei der Konstruktion der Wirklichkeit(en) genutzten Strategien und seine Vorstellung von der Wirklichkeit veranschaulichen. Was ist die „Wirklichkeit“ an sich? Gibt es überhaupt eine objektive Wirklichkeit (eine axiomatische Wirklichkeit)? In welchem Verhältnis steht die in Gombrowiczs Werken darstellte Wirklichkeit zu der von uns ertastbaren Wirklichkeit? Wie sieht die Welt Gombrowiczs aus und welche Regeln beinhaltet sie? Hat er bewusst und konsequent ein Weltbild kreiert? Welche Mittel benutzte er dabei? Woraus besteht die Einzigartigkeit seiner Vorgehensweise? In welcher Beziehung steht der Hauptprotagonist in Ferdydurke zur vorhandenen Wirklichkeit? Welche Verständnisstufe erreicht er bei der Perzeption der Wirklichkeit und welche Strategien sind ihm dabei von Nutzen? Diese alle Fragen versuchte ich in dieser Arbeit zu beantworten.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Die Zielbestimmung, die Literatur und Vorgehensweise
- 1.2. „Ferdydurke“
- 2. Wirklichkeitswahrnehmung
- 2.1. Mimesis
- 2.2. Eine relative Wirklichkeit
- 3. Problematik in „Ferdydurke“
- 3.1. Suche nach der Objektivität
- 3.2. Postulat des Relativismus
- 4. Form und das Außerformelle
- 4.1. Oppositionelles System
- 4.2. Was ist die „Form“? Wozu existiert die „Form“?
- 5. Verzichten auf die „Form“
- 5.1. Unreife als Freiheit
- 5.2. Unreife als Schweigen
- 5.3. Ständiges „Werden“
- 6. Literarische Mittel der Realisierung und Derealisierung in „Ferdydurke“
- 6.1. Farce und Symbolik
- 6.2. Teilverständnis und Sprache
- 6.3. Schwanken der „Form“
- 7. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht Witold Gombrowicz' Werk „Ferdydurke“ im Hinblick auf seine „Theorie der Form“ und die darin verwendeten Strategien zur Konstruktion von Wirklichkeiten. Die Arbeit analysiert Gombrowicz' Vorstellung von Wirklichkeit, das Verhältnis seiner dargestellten Wirklichkeit zur empirischen Wirklichkeit und die Mittel, die er zur Schaffung seines Weltbildes einsetzt. Der Fokus liegt auf der Textanalyse von „Ferdydurke“, ergänzt durch Gombrowicz' eigene Schriften wie seine Tagebücher und „Testament“.
- Gombrowicz' Theorie der Form und deren Anwendung in „Ferdydurke“
- Die Konstruktion von Wirklichkeit(en) in Gombrowicz' Werk
- Der Relativismus und die Suche nach Objektivität in „Ferdydurke“
- Die Rolle der Form und des Außerformellen in Gombrowicz' literarischem Stil
- Die literarischen Mittel der Realisierung und Derealisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung skizziert die Zielsetzung der Arbeit: die Analyse der von Gombrowicz in „Ferdydurke“ zur Konstruktion von Wirklichkeiten verwendeten Strategien im Kontext seiner „Theorie der Form“. Sie stellt die zentrale Frage nach der Natur der „Wirklichkeit“ und deren Verhältnis zur in Gombrowicz' Werken dargestellten Wirklichkeit. Die Einleitung umreißt die Vorgehensweise, die sich auf die Textanalyse von „Ferdydurke“ und Gombrowicz' eigenen Schriften stützt, und benennt die relevanten Sekundärliteraturquellen. Die Schwierigkeit des Verständnisses von Gombrowicz' Theorie aufgrund deren nicht-wissenschaftlichen Charakters wird ebenfalls angesprochen.
2. Wirklichkeitswahrnehmung: Dieses Kapitel befasst sich mit Gombrowicz' Konzept der Wirklichkeitswahrnehmung, indem es den Begriff der Mimesis und die Idee einer relativen Wirklichkeit analysiert. Es untersucht, wie Gombrowicz die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt und eine Welt konstruiert, die sich den traditionellen Kategorien der Wirklichkeitsdarstellung entzieht. Die Analyse der Mimesis legt den Schwerpunkt auf die Art und Weise, wie Gombrowicz Realität abbildet oder eben nicht abbildet, um seine eigenen Vorstellungen von Wirklichkeit zum Ausdruck zu bringen. Die relative Wirklichkeit wird als ein Konzept diskutiert, das die Vielschichtigkeit und die subjektive Natur von Erfahrung betont.
3. Problematik in „Ferdydurke“: Das Kapitel konzentriert sich auf die in „Ferdydurke“ dargestellte Problematik der Suche nach Objektivität und dem Postulat des Relativismus. Es analysiert die Herausforderungen, denen der Protagonist bei seinem Versuch begegnet, eine objektive Wirklichkeit zu erfassen. Der Relativismus wird als ein zentrales Element von Gombrowicz' Weltanschauung herausgestellt, das die Unmöglichkeit einer endgültigen Wahrheit und die Vieldeutigkeit von Erfahrung betont. Der Fokus liegt auf dem Spannungsfeld zwischen dem Bestreben nach Objektivität und der Anerkennung der Relativität von Wahrheiten.
4. Form und das Außerformelle: In diesem Kapitel wird Gombrowicz' Konzept von „Form“ und dessen Gegenstück, dem „Außerformellen“, untersucht. Es analysiert das oppositionelle System, das Gombrowicz in seinen Werken schafft, und befasst sich mit der Frage nach der Funktion und dem Wesen der „Form“. Die Untersuchung konzentriert sich auf den Spannungsbogen zwischen den Konventionen der Form und den Möglichkeiten des Außerformellen, welche die Grenzen der literarischen und gesellschaftlichen Konventionen durchbrechen und so neue Ausdrucksformen schaffen. Der Fokus liegt auf der Rolle der Form und des Außerformellen im Kontext von Gombrowicz' literarischem Stil und Weltanschauung.
5. Verzichten auf die „Form“: Dieses Kapitel analysiert die Bedeutung des Verzichts auf die „Form“ bei Gombrowicz, wobei die Konzepte der Unreife als Freiheit, Unreife als Schweigen und das ständige „Werden“ im Mittelpunkt stehen. Es untersucht, wie Gombrowicz durch den Verzicht auf konventionelle Formen neue Möglichkeiten der Selbstausdruck und Darstellung eröffnet. Die Unreife wird nicht als Mangel, sondern als Potential für Freiheit und Offenheit interpretiert. Das Schweigen wird als eine Form des Widerstands gegen die Zwänge der Form verstanden, während das ständige „Werden“ den dynamischen und offenen Charakter von Gombrowicz' Weltanschauung betont.
6. Literarische Mittel der Realisierung und Derealisierung in „Ferdydurke“: Das Kapitel befasst sich mit den literarischen Mitteln, die Gombrowicz in „Ferdydurke“ einsetzt, um sowohl Wirklichkeit darzustellen als auch zu dekonstruieren. Es analysiert die Verwendung von Farce und Symbolik, Teilverständnis und Sprache sowie das Schwanken der „Form“. Die Analyse der Farce beleuchtet die komische Übertreibung und die Absurdität, die Gombrowicz einsetzt, um die Konventionen zu untergraben. Die Symbolik wird untersucht in ihrer mehrschichtigen Bedeutung und dem Potenzial zur Interpretation. Teilverständnis und Sprache werden in Bezug auf ihre Rolle in der Schaffung von Mehrdeutigkeit und Unklarheit untersucht, während das Schwanken der Form die Dynamik und den Prozesscharakter der Wirklichkeitskonstruktion verdeutlicht.
Schlüsselwörter
Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Theorie der Form, Mimesis, relative Wirklichkeit, Objektivität, Relativismus, Form, Außerformelles, Unreife, Realität, Fiktion, Groteske, polnische Moderne, literarische Strategien, Wirklichkeitskonstruktion.
Häufig gestellte Fragen zu Gombrowicz' "Ferdydurke"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Witold Gombrowicz' Roman "Ferdydurke" im Hinblick auf seine "Theorie der Form" und die darin verwendeten Strategien zur Konstruktion von Wirklichkeiten. Der Fokus liegt auf der Textanalyse von "Ferdydurke", ergänzt durch Gombrowicz' eigene Schriften wie seine Tagebücher und "Testament". Die Arbeit untersucht Gombrowicz' Vorstellung von Wirklichkeit, das Verhältnis seiner dargestellten Wirklichkeit zur empirischen Wirklichkeit und die Mittel, die er zur Schaffung seines Weltbildes einsetzt.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die zentralen Themen sind Gombrowicz' Theorie der Form und deren Anwendung in "Ferdydurke", die Konstruktion von Wirklichkeit(en) in Gombrowicz' Werk, der Relativismus und die Suche nach Objektivität, die Rolle der Form und des Außerformellen in Gombrowicz' literarischem Stil sowie die literarischen Mittel der Realisierung und Derealisierung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sieben Kapitel: Eine Einleitung, die die Zielsetzung und Vorgehensweise beschreibt; ein Kapitel zur Wirklichkeitswahrnehmung bei Gombrowicz; ein Kapitel zur Problematik der Objektivitätssuche und des Relativismus in "Ferdydurke"; ein Kapitel zu Gombrowicz' Konzept von "Form" und "Außerformellen"; ein Kapitel zum Verzicht auf die "Form" und den damit verbundenen Konzepten der Unreife, des Schweigens und des ständigen "Werdens"; ein Kapitel zu den literarischen Mitteln der Realisierung und Derealisierung; und abschließend ein Fazit.
Was versteht Gombrowicz unter "Form" und "Außerformellen"?
Gombrowicz' Konzept der "Form" und des "Außerformellen" bildet ein zentrales Thema der Arbeit. Es wird das oppositionelle System analysiert, das Gombrowicz schafft, und die Frage nach der Funktion und dem Wesen der "Form" untersucht. Der Spannungsbogen zwischen den Konventionen der Form und den Möglichkeiten des Außerformellen, die Grenzen literarischer und gesellschaftlicher Konventionen zu durchbrechen, steht im Mittelpunkt.
Welche Rolle spielt die Mimesis in Gombrowicz' Werk?
Die Arbeit analysiert den Begriff der Mimesis im Kontext von Gombrowicz' Konzept der relativen Wirklichkeit. Es wird untersucht, wie Gombrowicz die Grenzen zwischen Realität und Fiktion verschwimmen lässt und eine Welt konstruiert, die sich den traditionellen Kategorien der Wirklichkeitsdarstellung entzieht. Der Fokus liegt darauf, wie Gombrowicz Realität abbildet oder eben nicht abbildet, um seine Vorstellungen von Wirklichkeit auszudrücken.
Wie wird der Relativismus in "Ferdydurke" dargestellt?
Der Relativismus wird als ein zentrales Element von Gombrowicz' Weltanschauung herausgestellt, das die Unmöglichkeit einer endgültigen Wahrheit und die Vieldeutigkeit von Erfahrung betont. Die Arbeit analysiert den Spannungsbogen zwischen dem Bestreben nach Objektivität und der Anerkennung der Relativität von Wahrheiten in "Ferdydurke".
Welche literarischen Mittel setzt Gombrowicz in "Ferdydurke" ein?
Die Arbeit analysiert die literarischen Mittel, die Gombrowicz zur Darstellung und Dekonstruktion von Wirklichkeit einsetzt. Dazu gehören Farce und Symbolik, die Rolle von Teilverständnis und Sprache, sowie das "Schwanken der Form". Die Analyse beleuchtet die komische Übertreibung, die mehrschichtige Symbolik, die Schaffung von Mehrdeutigkeit und Unklarheit, und die Dynamik der Wirklichkeitskonstruktion.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und bietet eine abschließende Betrachtung der in "Ferdydurke" dargestellten Konzepte und Strategien. (Der genaue Inhalt des Fazits wird in der Zusammenfassung der Kapitel nicht detailliert beschrieben.)
Welche Schlüsselwörter sind relevant für diese Arbeit?
Witold Gombrowicz, Ferdydurke, Theorie der Form, Mimesis, relative Wirklichkeit, Objektivität, Relativismus, Form, Außerformelles, Unreife, Realität, Fiktion, Groteske, polnische Moderne, literarische Strategien, Wirklichkeitskonstruktion.
- Quote paper
- Marta Kabacinska (Author), 2005, Das Bild einer kreierbaren Wirklichkeit in "Ferdydurke" von Gombrowicz, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55542