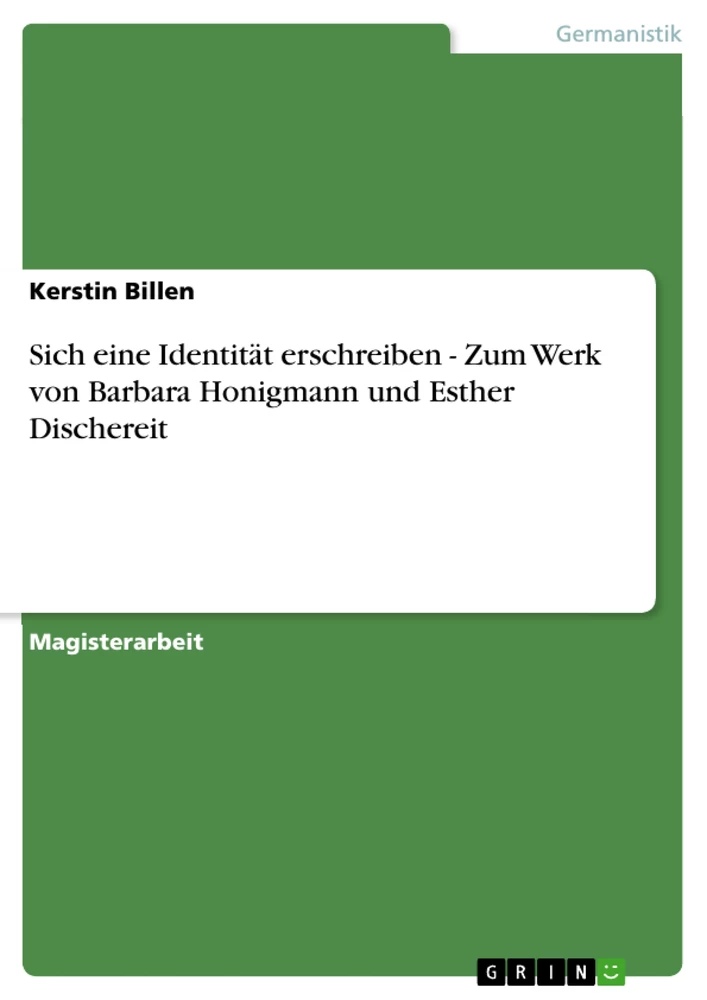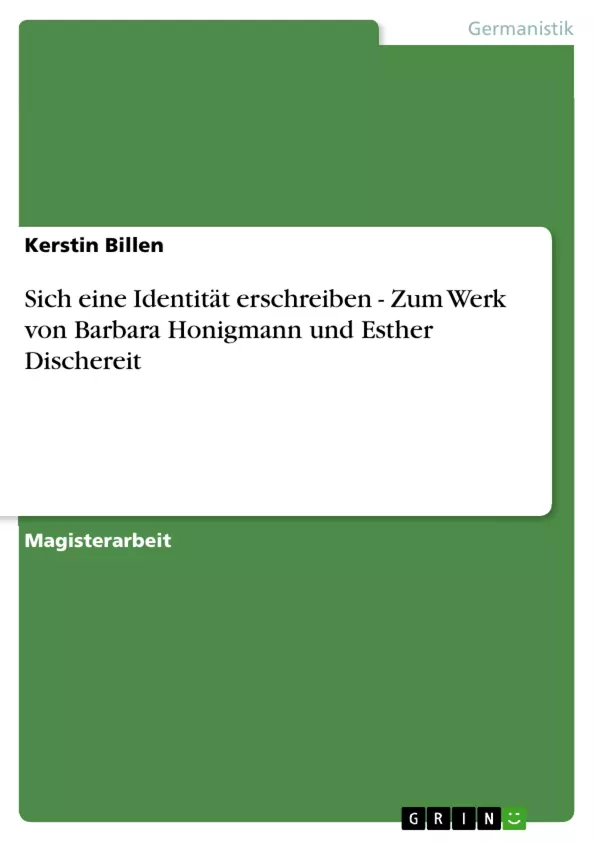Der Leitfaden der vorliegenden Arbeit wird die Fragestellung sein, aus welchen Elementen jüdische Identität in den ersten Werken Esther Dischereits und Barbara Honigmanns entsteht. Ausgangspunkt ist ein Blick auf das autobiographische Schreiben, das sich wie ein roter Faden durch die Werke beider Autorinnen zieht, sowie auf die deutsch-jüdische Literatur der 2. Generation.
Der Hauptteil dieser Arbeit beschäftigt sich mit einer vergleichenden Analyse der wichtigsten Motive der Schriftstellerinnen. Kapitel 3 ist unterteilt in die Abschnitte Geschichte und eigene Erfahrungen, Judentum und Religion,Jüdischsein und Erfahrung der Fremdheit sowie Leben in Deutschland oder Emigration. Der Schwerpunkt der Analyse wird dabei auf Esther Dischereits Geschichte "Joëmis Tisch" und den Erzählungen von Barbara Honigmann, die in den Bänden "Roman von einem Kinde" und "Damals, dann und danach" erschienen sind, liegen. "Roman von einem Kinde" und "Joëmis Tisch" sind die ersten literarische Werke der Autorinnen, zudem sind sie nahezu zur gleichen Zeit entstanden. Wie es bei ersten Texten häufig der Fall ist, sind diese Werke sehr von der Autobiographie der Autorinnen geprägt. Wo es für die Analyse hilfreich ist, werden auch Einzelaspekte aus weiteren Werken der Autorinnen betrachtet. In Einzelnen sind dies Honigmannns "Soharas Reise" und "Eine Liebe aus Nichts" und Dischereits Essaysammlungen "Übungen, jüdisch zu sein" sowie "Mit Eichmann an die Börse".
Die Texte werden hier ‚an sich’ betrachtet, d. h. ohne eine tiefgehende Interpretation in Hinblick auf die Biographie der Autorinnen und ohne, dass aus den festgestellten, die Identität der Protagonistinnen prägenden, Einzelelementen bereits ein Gesamtbild der jeweiligen Identität erzeugt wird. Zunächst werden die Vorgehensweisen und die Sprache der Schriftstellerinnen analysiert und einander gegenübergestellt.
In Kapitel 4 werden dann diese einzelnen Identitätsbausteine in ihrer Gesamtheit betrachtet und es wird der Prozess der Identitätsfindung der Hauptfiguren beider Autorinnen nachvollzogen und analysiert, ob diese Identitätsfindung gelungen ist. Als Basis dient hierbei das theoretische Modell der Identität von Jürgen Habermas, das von einer Konstruktion der Identität als einem aktiven, kontinuierlich stattfindenden Prozess ausgeht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Hintergrund
- 2.1 Autorinnen der zweiten Generation
- 2.2 Autobiographisches Schreiben
- 3. Aspekte der deutsch-jüdischen Identitätsbildung
- 3.1 Geschichte und eigene Erfahrungen
- 3.1.1 Shoah
- 3.1.2 Erzählen um zu erinnern
- 3.1.3 Motiv des Friedhofs
- 3.2 Judentum und Religion
- 3.3 Jüdischsein und Erfahrung der Fremdheit
- 3.4 Leben in Deutschland oder Emigration
- 3.4.1 Israel
- 4. Sich eine Identität erschreiben
- 4.1 Sprache und Struktur
- 4.2 Wirklichkeitsstatus der Texte
- 5. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Konstruktion jüdischer Identität in den Werken von Esther Dischereit und Barbara Honigmann, insbesondere in Bezug auf die Erfahrungen der zweiten Generation nach der Shoah. Die Analyse konzentriert sich auf autobiographische Elemente und die Frage, wie die Geschichte, insbesondere das Trauma der Shoah, die Lebensentwürfe und die Identitätsfindung der Protagonistinnen beeinflusst.
- Autobiographisches Schreiben und seine Bedeutung für die Darstellung jüdischer Identität
- Der Einfluss der Shoah und anderer geschichtlicher Ereignisse auf die Identitätsbildung
- Die Auseinandersetzung mit Judentum und Religion im Kontext deutscher Gesellschaft
- Das Erleben von Fremdheit und die Frage nach Zugehörigkeit
- Die Gestaltung jüdischen Lebens in Deutschland im Spannungsfeld von Assimilation und Erinnerung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik der deutsch-jüdischen Literatur der Gegenwart ein und hebt die zentrale Rolle der Shoah und ihrer Auswirkungen hervor. Sie stellt die Autorinnen Barbara Honigmann und Esther Dischereit vor und benennt die Forschungsfrage nach der Konstruktion jüdischer Identität in ihren Werken. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse autobiographischer Elemente und die Frage, wie ein jüdisches Leben im heutigen Deutschland gestaltet werden kann.
2. Hintergrund: Dieses Kapitel beleuchtet den Kontext der deutsch-jüdischen Literatur der zweiten Generation und die Bedeutung des autobiographischen Schreibens für die Aufarbeitung der Vergangenheit. Es liefert einen theoretischen Rahmen für die Analyse der folgenden Kapitel, indem es die spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten der deutsch-jüdischen Identitätsfindung in der Nachkriegszeit beschreibt. Die Auseinandersetzung mit dem Erbe der Shoah und der Suche nach einer jüdischen Identität im Schatten der deutschen Geschichte wird als zentraler Aspekt hervorgehoben.
3. Aspekte der deutsch-jüdischen Identitätsbildung: Dieses Kapitel analysiert verschiedene Aspekte der deutsch-jüdischen Identitätsbildung anhand der Werke der beiden Autorinnen. Es untersucht die Rolle der Geschichte und persönlicher Erfahrungen, die Bedeutung von Judentum und Religion, das Erleben von Fremdheit und die Frage nach der Emigration oder dem Leben in Deutschland. Es werden dabei die in den Texten dargestellten Strategien der Bewältigung des Traumas der Shoah und des Umgangs mit dem Schweigen zwischen den Generationen beleuchtet. Die Kapitel unterteilen sich in die Abschnitte Geschichte und eigene Erfahrungen, Judentum und Religion, Jüdischsein und Erfahrung der Fremdheit sowie Leben in Deutschland oder Emigration.
4. Sich eine Identität erschreiben: Kapitel 4 untersucht den Prozess der Identitätsfindung der Protagonistinnen in den Werken von Dischereit und Honigmann. Es analysiert die sprachlichen und strukturellen Mittel, die zur Konstruktion der Identität verwendet werden, und hinterfragt den Wirklichkeitsstatus der Texte. Die Analyse bezieht sich auf theoretische Modelle der Identitätsbildung und untersucht, inwieweit die Protagonistinnen eine erfolgreiche Identitätsfindung erleben. Das Kapitel integriert die in Kapitel 3 gewonnenen Erkenntnisse über die einzelnen Aspekte der Identität zu einem Gesamtbild der Identitätskonstruktion.
Schlüsselwörter
Deutsch-jüdische Literatur, zweite Generation, Shoah, autobiographisches Schreiben, Identitätsbildung, Judentum, Religion, Fremdheit, Emigration, Deutschland, Barbara Honigmann, Esther Dischereit, Erinnerung, Trauma.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Konstruktion jüdischer Identität in den Werken von Esther Dischereit und Barbara Honigmann
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese wissenschaftliche Arbeit untersucht die Konstruktion jüdischer Identität in den Werken der Autorinnen Esther Dischereit und Barbara Honigmann, insbesondere im Kontext der zweiten Generation nach der Shoah. Der Fokus liegt auf autobiographischen Elementen und dem Einfluss der Geschichte, vor allem des Shoah-Traumas, auf die Identitätsfindung der Protagonistinnen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Aspekte der deutsch-jüdischen Identitätsbildung. Dazu gehören autobiographisches Schreiben und seine Bedeutung, der Einfluss der Shoah und anderer geschichtlicher Ereignisse, die Auseinandersetzung mit Judentum und Religion in der deutschen Gesellschaft, das Erleben von Fremdheit und Zugehörigkeit, sowie die Gestaltung jüdischen Lebens in Deutschland zwischen Assimilation und Erinnerung.
Welche Autorinnen stehen im Mittelpunkt der Analyse?
Die Analyse konzentriert sich auf die Werke von Esther Dischereit und Barbara Honigmann, wobei deren autobiographische Elemente im Zentrum der Betrachtung stehen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Hintergrund (inkl. deutsch-jüdischer Autorinnen der zweiten Generation und autobiographischem Schreiben), Aspekte der deutsch-jüdischen Identitätsbildung (inkl. Shoah, Erinnerung, Judentum, Religion, Fremdheit, Emigration und Leben in Deutschland), Sich eine Identität erschreiben (inkl. Sprache, Struktur und Wirklichkeitsstatus der Texte) und Resümee.
Wie wird die deutsch-jüdische Identitätsbildung analysiert?
Die Analyse untersucht die Rolle der Geschichte und persönlicher Erfahrungen, die Bedeutung von Judentum und Religion, das Erleben von Fremdheit und die Frage nach Emigration oder Leben in Deutschland. Es werden die Strategien der Traumabewältigung und des Umgangs mit Generationenschweigen beleuchtet.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Arbeit will die Konstruktion jüdischer Identität in den untersuchten Werken analysieren und dabei die Einflüsse der Shoah und des autobiographischen Schreibens auf die Identitätsfindung der Protagonistinnen herausarbeiten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Deutsch-jüdische Literatur, zweite Generation, Shoah, autobiographisches Schreiben, Identitätsbildung, Judentum, Religion, Fremdheit, Emigration, Deutschland, Barbara Honigmann, Esther Dischereit, Erinnerung, Trauma.
Welchen methodischen Ansatz verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit verwendet eine literaturwissenschaftliche Analyse der ausgewählten Texte, die sich auf die autobiographischen Elemente und deren Bedeutung für die Darstellung jüdischer Identität konzentriert. Die Analyse untersucht die sprachlichen und strukturellen Mittel der Identitätskonstruktion und hinterfragt den Wirklichkeitsstatus der Texte.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich für deutsch-jüdische Literatur, autobiographisches Schreiben, Identitätsbildung, die Shoah und die Nachwirkungen des Holocaust interessieren. Sie richtet sich insbesondere an Wissenschaftler*innen, Studierende der Literaturwissenschaft und an alle, die sich mit Fragen der Erinnerungskultur und der deutsch-jüdischen Geschichte auseinandersetzen.
- Citar trabajo
- M.A, Kerstin Billen (Autor), 2006, Sich eine Identität erschreiben - Zum Werk von Barbara Honigmann und Esther Dischereit, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55544