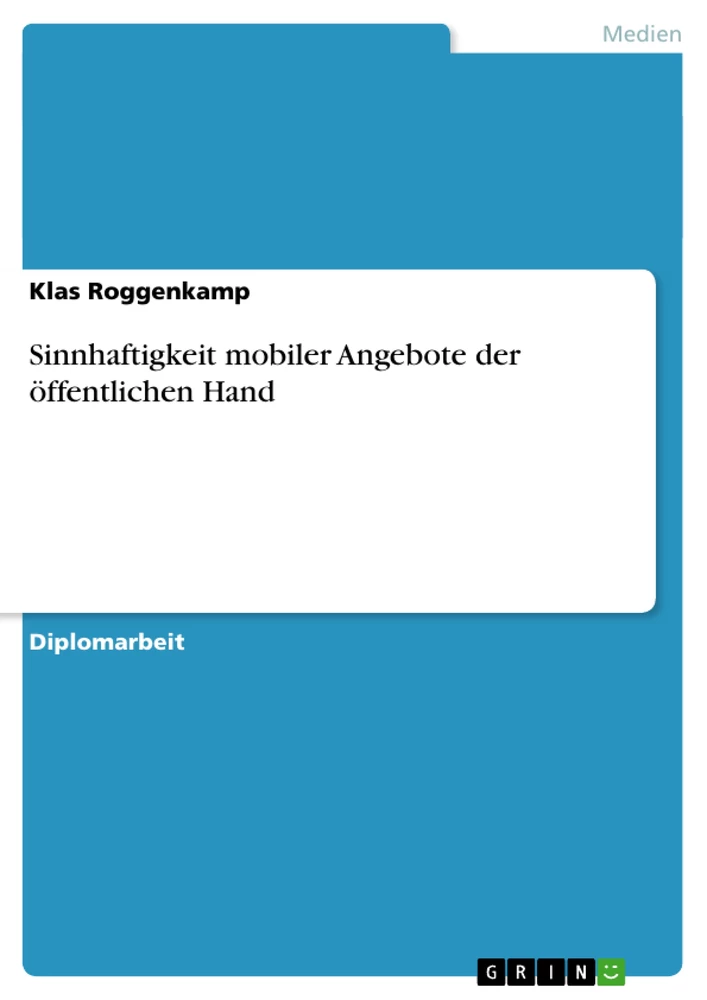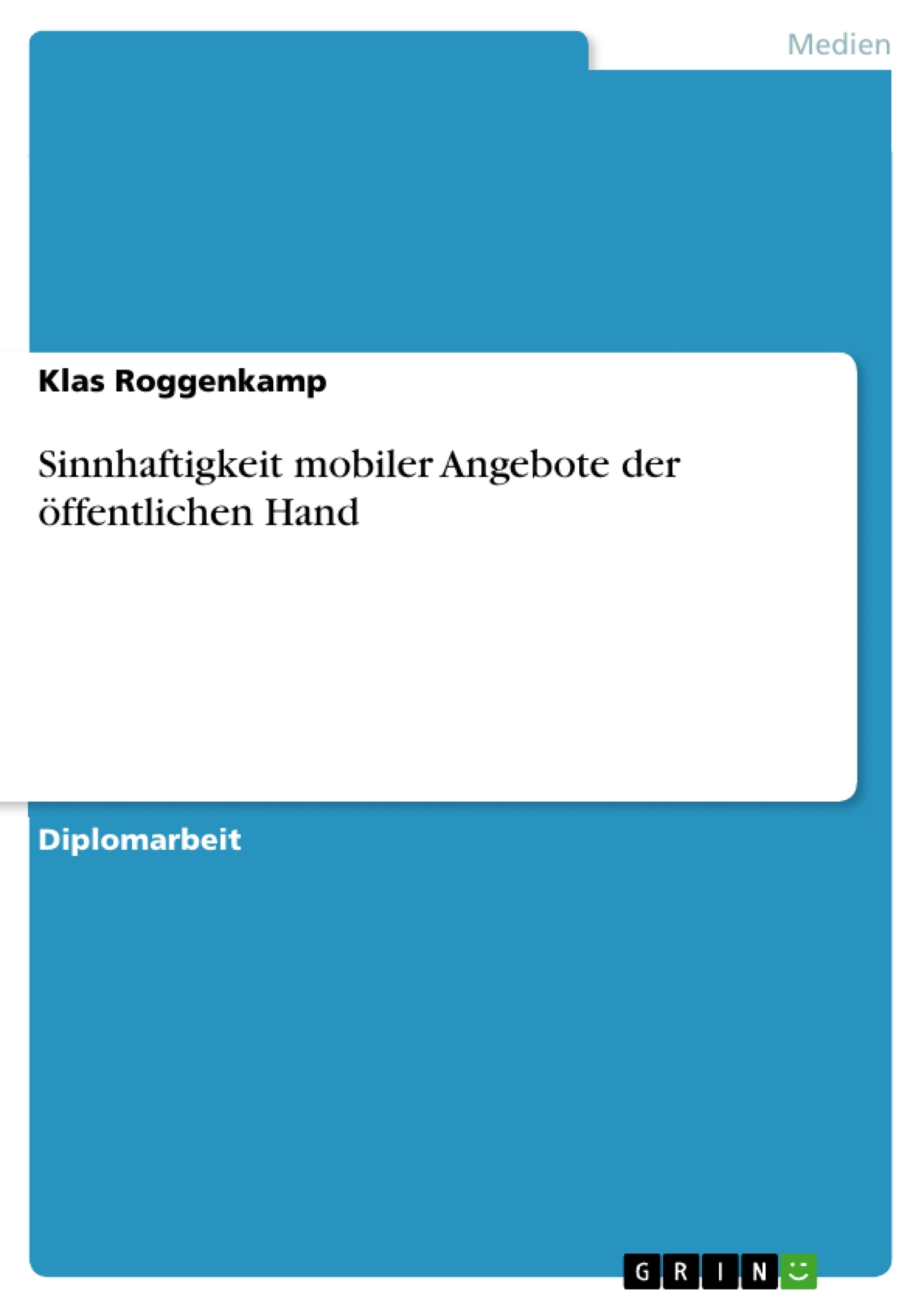Die Nutzung mobiler Kommunikation wird zum Alltagsverhalten. Daraus entsteht die Erwartung, dass nach sozialen und organisatorischen Veränderungen im privaten Bereich, ebenso wie in Unternehmen, auch die Organisationen im Public Sector mobile Dienste anbieten und nutzen sollten.
Die Erwartungen an diese neuen Technologien sind hoch. Im Laufe der Zeit sind jedoch die hochtrabenden Visionen von E-Government zunehmend pragmatischeren Ansrpüchen gewichen: War zunächst noch von fundamentalen Veränderungern der Rolle des Staates die Rede, werden heute v.a. Zugangsmöglichkeiten und die Veränderung von Steuerungsmechanismen diskutiert.
Es werden die Vorbedingungen für sinnhafte mobile Angebote der öffentlichen Hand betrachtet: wie gut ein Ziel mit gegebenen Maßnahmen erreicht werden kann. Im Fokus stehen die Einflussgrößen "Nutzer", "Organisation" und "Prozesse" in Beziehung zu mobilen Angeboten sowie konkurrierenden Angebote ("Kanalkonkurrenz"). Dazu wird eingangs Mobilität in verschiedenen Facetten vom soziologischen bis zum rein technischen Begriffsverständnis betrachtet.
Die Betrachtung der Sinnhaftigkeitseinflüsse beginnt mit dem Nutzer. Sein Verhalten, die Akzeptanz von technisierten Angeboten, basiert auf der Wahrnehmung verfügbarer Technologie und des konkret empfundenen, situativen Mehrwerts. Es wirken Vorerfahrungen mit ähnlicher Technik und die Verfügbarkeit konkurrierender Angebote ("Kanalkonkurrenz").
Für den Faktor Organisation interessiert v.a. die Fähigkeit, mobile Angebote effektiv in interne Kommunikationsabläufe einzubinden. Es werden Strategien diskutiert, wie eine Organisation auf mobile Dienste vorzubereiten ist, aber auch, wie sich diese Dienste auf die Organisation auswirken können.
Der Faktor Prozess leitet sich ab aus Rahmenbedingungen, die mobil abgebildet, also technisch erfüllt werden müssen. Nutzer und Organisation sind für M-Government der diffuse Grund: Sie sind mobil oder wollen dies unterstützen. Durch die Kenntnis des Prozesses und seine losgelöste Betrachtung, lässt sich ein starkes Kriterium für oder gegen ein mobiles Angebot ableiten –ohne den Kontext Nutzer/Organisation bleibt dies aber eine isolierte Analyse des Möglichen.
Aus der Betrachtung der drei Kernfaktoren entsteht ein grobes Schema zur Entwicklung von Nutzer- und Nutzungsszenarien, mit denen sich konkrete Angebote im Vorfeld auf Akzeptanz, Umsetzbarkeit, schlußendlich: Sinnhaftigkeit untersuchen lassen.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Definition des Untersuchungsobjektes
- 1.1.1 Government
- 1.1.2 Electronic Government
- 1.1.3 Mobile Government
- 1.2 Konkretisierung der Fragestellung
- 1.3 Aufbau der Arbeit
- 2 Mobilität
- 2.1 Der Mobilitätsbegriff
- 2.2 Ebenen von Mobilität
- 2.3 Mobile Interaktion
- 2.3.1 Räumlich
- 2.3.2 Zeitlich
- 2.3.3 Kontextuell
- 2.3.4 Technisch vermittelte mobile Interaktion
- 3 Nutzerverhalten
- 3.1 Nutzererwartungen
- 3.1.1 Einflüsse der Umwelt
- 3.1.2 Persönliche Erfahrungen
- 3.2 Kennenlernphase
- 3.3 Verhaltensregeln
- 3.4 Das access anytime, anywhere- Paradigma
- 4 Mobilität und mobile Technologien in Organisationen
- 4.1 Government als Organisation
- 4.2 Strategien für M-Government
- 4.2.1 „e-Gov Goes Wireless: From Palm to Shining Palm“
- 4.2.2 „Mobile Government: Die Stadt als Lebensbegleiter“
- 4.2.3 „Preparing for Wireless and Mobile Technologies in Government“
- 4.2.4 „Government unplugged“
- 4.3 M-Government in öffentlichen Organisationen
- 5 Methoden zur Betrachtung von Prozessen
- 5.1 Elemente eines Prozesses
- 5.2 Mobilisierbarkeit von Prozessen
- 5.3 Bewertungsmethoden
- 5.3.1 eGov-Rechner
- 5.3.2 WiBe 21 / WiBe 4.0
- 5.3.3 3P Value Model for mGovernment applications
- 5.3.4 Portfolioanalyse
- 6 Mobile: Sonderweg oder Zusatzfunktion
- 6.1 Zwischenfazit
- 6.1.1 Diskussion der Methoden
- 6.2 Kriterienableitung
- 6.2.1 Vorüberlegungen
- 6.2.2 Kriterien für die Bestimmung der Sinnhaftigkeit
- 7 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die Sinnhaftigkeit mobiler Angebote der öffentlichen Hand. Ziel ist es, Kriterien für die Beurteilung der Zweckmäßigkeit solcher Angebote zu entwickeln und verschiedene Methoden zur Prozessbetrachtung im Kontext von M-Government zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen und Chancen, die sich aus der mobilen Nutzung öffentlicher Dienste ergeben.
- Definition und Abgrenzung von Mobile Government
- Analyse des Nutzerverhaltens im Kontext mobiler Angebote
- Bewertung von Methoden zur Prozessanalyse im M-Government-Bereich
- Entwicklung von Kriterien zur Bestimmung der Sinnhaftigkeit mobiler Angebote
- Untersuchung der Rolle von Mobilität in öffentlichen Organisationen
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Dieses Kapitel legt den Grundstein der Arbeit, indem es das Untersuchungsobjekt "Mobile Government" definiert und abgrenzt. Es wird der Begriff im Kontext von "Government" und "Electronic Government" eingeordnet und die Forschungsfrage präzisiert. Der Aufbau der Arbeit wird im letzten Teil des Kapitels dargelegt, wodurch dem Leser ein strukturierter Überblick über die folgende Analyse ermöglicht wird. Die Einleitung dient dazu, den Rahmen der Studie zu setzen und den Leser auf die folgenden Kapitel vorzubereiten.
2 Mobilität: Hier wird der Begriff "Mobilität" umfassend definiert und in verschiedene Ebenen unterteilt (räumlich, zeitlich, kontextuell). Die technisch vermittelte mobile Interaktion wird als Schlüsselelement für M-Government hervorgehoben. Das Kapitel liefert ein theoretisches Fundament, um die späteren Analysen des Nutzerverhaltens und der Prozessgestaltung im Kontext mobiler Anwendungen zu verstehen. Die verschiedenen Ebenen von Mobilität dienen als Grundlage für die Betrachtung der Nutzerbedürfnisse und -erwartungen.
3 Nutzerverhalten: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Erwartungen und das Verhalten von Nutzern mobiler öffentlicher Dienste. Es werden Einflüsse der Umwelt und persönliche Erfahrungen als entscheidende Faktoren untersucht, die das Nutzerverhalten beeinflussen. Die "Kennenlernphase" und die "Verhaltensregeln" werden im Kontext der Nutzung mobiler Anwendungen analysiert, um ein umfassendes Verständnis für die Nutzerperspektive zu gewinnen. Das "access anytime, anywhere"-Paradigma wird als Leitmotiv für die Gestaltung mobiler Dienste herausgestellt.
4 Mobilität und mobile Technologien in Organisationen: In diesem Kapitel wird die Rolle von Mobilität und mobilen Technologien in öffentlichen Organisationen beleuchtet. Es werden verschiedene Strategien für M-Government vorgestellt und anhand ausgewählter Beispiele aus der Praxis illustriert. Die Kapitel analysiert den Organisationskontext und die Herausforderungen der Implementierung mobiler Technologien in der öffentlichen Verwaltung. Der Fokus liegt auf der strategischen Positionierung von M-Government innerhalb öffentlicher Organisationen.
5 Methoden zur Betrachtung von Prozessen: Dieses Kapitel stellt verschiedene Methoden zur Analyse und Bewertung von Prozessen vor, die für die Entwicklung und Implementierung mobiler Dienste relevant sind. Methoden wie der eGov-Rechner, WiBe 21/4.0 und das 3P Value Model werden detailliert erläutert und kritisch bewertet. Der Schwerpunkt liegt auf der Auswahl geeigneter Methoden zur Beurteilung der Sinnhaftigkeit mobiler Angebote. Die Portfolioanalyse wird als Instrument zur strategischen Entscheidungsfindung vorgestellt.
6 Mobile: Sonderweg oder Zusatzfunktion: Dieses Kapitel fasst die Ergebnisse der vorherigen Kapitel zusammen und leitet daraus Kriterien für die Bestimmung der Sinnhaftigkeit mobiler Angebote ab. Die Diskussion der Methoden und die Ableitung der Kriterien bilden den Kern dieses Kapitels. Es wird kritisch hinterfragt, ob mobile Angebote einen Sonderweg oder lediglich eine Zusatzfunktion darstellen.
Schlüsselwörter
Mobile Government, M-Government, Nutzerverhalten, Mobilität, Prozessanalyse, Bewertungsmethoden, Sinnhaftigkeit, öffentliche Hand, eGov, Strategien, technologische Implementierung, Nutzererwartungen.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu der Diplomarbeit: Sinnhaftigkeit mobiler Angebote der öffentlichen Hand
Was ist der Hauptgegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Arbeit untersucht die Sinnhaftigkeit mobiler Angebote der öffentlichen Hand (M-Government). Das zentrale Ziel ist die Entwicklung von Kriterien zur Beurteilung der Zweckmäßigkeit solcher Angebote und die Analyse verschiedener Methoden zur Prozessbetrachtung im Kontext von M-Government.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Definition und Abgrenzung von Mobile Government, Analyse des Nutzerverhaltens im Kontext mobiler Angebote, Bewertung von Methoden zur Prozessanalyse im M-Government-Bereich, Entwicklung von Kriterien zur Bestimmung der Sinnhaftigkeit mobiler Angebote und Untersuchung der Rolle von Mobilität in öffentlichen Organisationen.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung (Definition von M-Government, Forschungsfrage, Aufbau der Arbeit); Mobilität (Definition und Ebenen von Mobilität); Nutzerverhalten (Nutzererwartungen, Kennenlernphase, Verhaltensregeln); Mobilität und mobile Technologien in Organisationen (Strategien für M-Government, Beispiele aus der Praxis); Methoden zur Betrachtung von Prozessen (eGov-Rechner, WiBe 21/4.0, 3P Value Model, Portfolioanalyse); Mobile: Sonderweg oder Zusatzfunktion (Zwischenfazit, Kriterienableitung); und Fazit.
Welche Methoden zur Prozessanalyse werden untersucht?
Die Arbeit analysiert verschiedene Methoden zur Prozessanalyse, darunter der eGov-Rechner, WiBe 21/4.0, das 3P Value Model für mGovernment-Anwendungen und die Portfolioanalyse. Diese Methoden werden detailliert erläutert und kritisch bewertet, um ihre Eignung zur Beurteilung der Sinnhaftigkeit mobiler Angebote zu überprüfen.
Welche Kriterien werden zur Beurteilung der Sinnhaftigkeit mobiler Angebote entwickelt?
Die Arbeit entwickelt Kriterien zur Bestimmung der Sinnhaftigkeit mobiler Angebote der öffentlichen Hand, basierend auf den Ergebnissen der Analyse des Nutzerverhaltens, der Prozessanalysemethoden und der Betrachtung der Rolle von Mobilität in öffentlichen Organisationen. Diese Kriterien sollen Entscheidungsträgern bei der Planung und Implementierung von M-Government-Lösungen unterstützen.
Wie wird der Begriff "Mobilität" in der Arbeit definiert?
Der Begriff "Mobilität" wird umfassend definiert und in verschiedene Ebenen unterteilt: räumlich, zeitlich, kontextuell. Die technisch vermittelte mobile Interaktion wird als Schlüsselelement für M-Government hervorgehoben. Diese Definition bildet die Grundlage für die Analyse des Nutzerverhaltens und der Prozessgestaltung im Kontext mobiler Anwendungen.
Welche Rolle spielt das Nutzerverhalten in der Arbeit?
Das Nutzerverhalten spielt eine zentrale Rolle. Die Arbeit untersucht die Erwartungen und das Verhalten von Nutzern mobiler öffentlicher Dienste, einschließlich der Einflüsse der Umwelt und persönlicher Erfahrungen. Die "Kennenlernphase" und "Verhaltensregeln" werden analysiert, um ein umfassendes Verständnis der Nutzerperspektive zu gewinnen. Das "access anytime, anywhere"-Paradigma wird als Leitmotiv für die Gestaltung mobiler Dienste hervorgehoben.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter: Mobile Government, M-Government, Nutzerverhalten, Mobilität, Prozessanalyse, Bewertungsmethoden, Sinnhaftigkeit, öffentliche Hand, eGov, Strategien, technologische Implementierung, Nutzererwartungen.
- Quote paper
- Klas Roggenkamp (Author), 2005, Sinnhaftigkeit mobiler Angebote der öffentlichen Hand, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55619