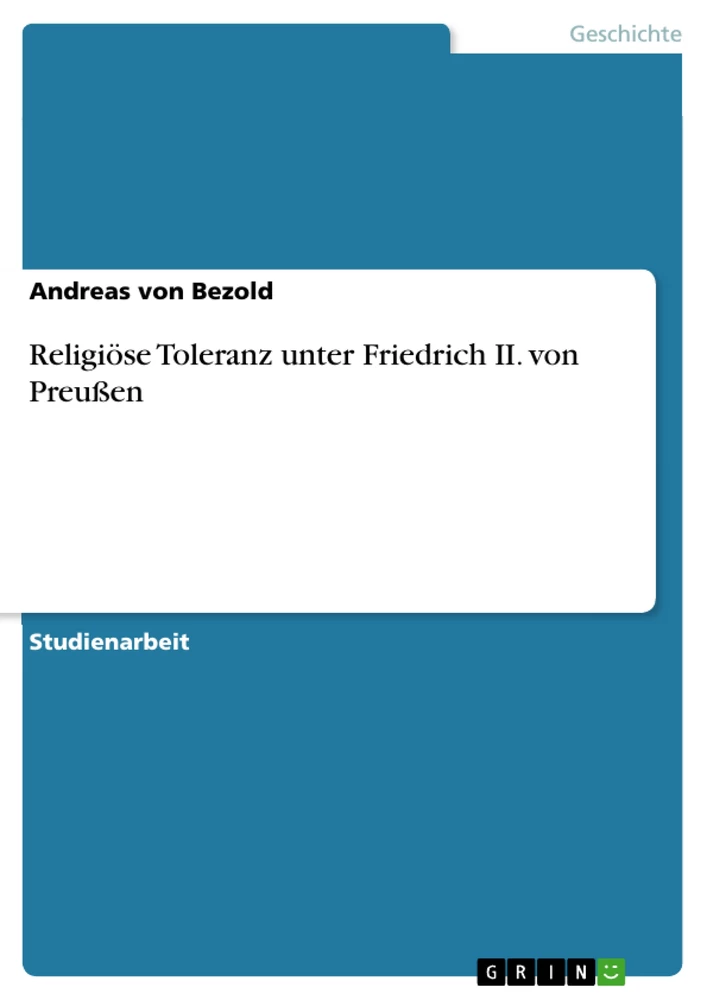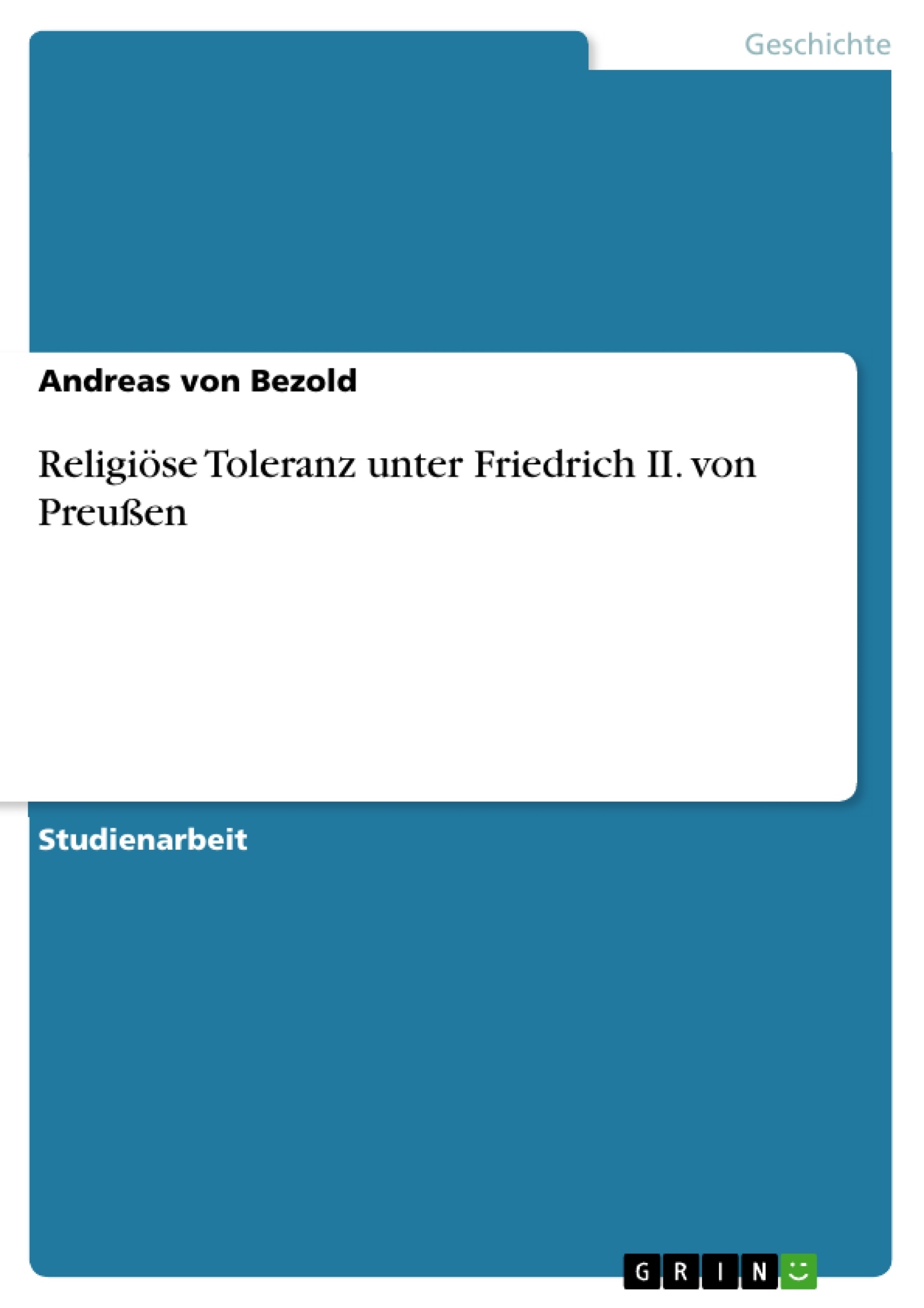Die religiöse Toleranz in Preußen unter Friedrich II. ist auch heute noch einer der bemerkenswerten Aspekte der Regierung dieses Königs, gerade im Vergleich mit der sonst üblichen Herrschaftspraxis im 18. Jahrhundert, das üblicherweise mit dem –nicht unumstrittenen- Begriff des „Zeitalters des Absolutismus“ charakterisiert wird. Folgt man dieser Terminologie, so kann man König Friedrich II. als Vertreter des „aufgeklärten Absolutismus“ bezeichnen. Charakteristisch für diese Form der Herrschaftsausübung ist es, dass der Anspruch auf Alleinherrschaft sich verband mit der Überzeugung, dem Wohl des Staates dienen zu müssen. Auch Friedrich sah folglich den Zweck seiner Herrschaft darin, den preußischen Staat zu erhalten und zu vergrößern und zum Wohlergehen seiner Untertanen beizutragen.
Persönlich hielt er religiöse Zeremonien und Gebräuche für lächerlich und hielt sich mit Spott über diesen - seiner Meinung nach- Aberglauben in Äußerungen gegenüber Gleichgesinnten nicht zurück. Da er jedoch der überwiegenden Masse seiner Untertanen nicht zutraute, für die Ideen der Aufklärung zugänglich zu sein, erachtete er die Religion zur Aufrechterhaltung von Moral und Ordnung für unabdingbar. Dabei räumte er der freien Religionsausübung und der Gewissensfreiheit höchsten Rang ein.
Drei entscheidende Fragen stellen sich in diesem Zusammenhang: Woher kommt diese Bereitschaft, einen jeden „nach seiner Fasson selig“ werden zu lassen, die Überzeugung, dass die Religionen alle
gleich seien? Konnte und wollte der König den Anspruch, in religiösen Dingen Toleranz zu üben, in der Praxis tatsächlich umsetzen? Und, vor allem, welchen praktischen Nutzen brachte diese tolerante Haltung für den preußischen Staat?
Ergebnis dieser Untersuchung der theoretischen und praktischen Seite der religiösen Toleranz in Preußen unter Friedrich II. wird daher eine Würdigung der Auswirkungen auf die Entwicklung Preußens sein, das erst unter der Regierung Friedrichs II. von einer Mittelmacht vergleichbar mit Sachsen oder Hannover zu einer der bedeutendsten Europäischen Mächte, vergleichbar mit dem Habsburgerreich, wurde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Religionsgemeinschaften in Preußen und im Deutschen Reich vom Westfälischen Frieden bis zum „aufgeklärten Absolutismus“ in der Zeit Friedrichs des Grossen
- Die religiöse Toleranz Friedrich des Grossen
- Friedrichs persönliche Einstellung zur Religion
- Die Theorie: Religiöse Toleranz als Bestandteil des aufgeklärten Absolutismus
- Die Praxis: Friedrichs Kirchenpolitik gegenüber den wichtigsten Religionsgemeinschaften in Preußen
- Protestanten: Lutheraner und Reformierte
- Katholiken
- Juden
- Die Politik Friedrichs gegenüber der katholischen Kirche in Schlesien als Beispiel von Theorie und Praxis der religiösen Toleranz
- Die Auswirkungen der toleranten Religionspolitik auf die Entwicklung des preußischen Staates
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die religiöse Toleranz unter der Herrschaft Friedrichs des Grossen in Preußen. Sie analysiert die Entstehung und Umsetzung dieser Toleranzpolitik im Kontext des „aufgeklärten Absolutismus“ und untersucht die Auswirkungen auf die Entwicklung des preußischen Staates.
- Friedrichs persönliche Einstellung zur Religion und seine Sicht auf den Wert und die Rolle der Religion in der Gesellschaft
- Die Theorie der religiösen Toleranz als Bestandteil des aufgeklärten Absolutismus und die philosophischen und politischen Grundlagen dieser Denkweise
- Die konkrete Umsetzung der Toleranzpolitik in Bezug auf verschiedene Religionsgemeinschaften wie Protestanten, Katholiken und Juden
- Die Auswirkungen der Toleranzpolitik auf die Entwicklung des preußischen Staates, insbesondere die Besiedlung, Integration und die Bildung einer einheitlichen Staatsidentität
- Die Rolle der Religion in der Gesellschaft des 18. Jahrhunderts und die Bedeutung der Religionspolitik für die Stabilität und den Fortschritt des Staates
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den Kontext der religiösen Toleranz in Preußen im 18. Jahrhundert und stellt die zentralen Fragen der Arbeit dar: Woher rührt Friedrichs Toleranz, wie wurde sie in der Praxis umgesetzt und welchen Einfluss hatte sie auf den preußischen Staat? Das zweite Kapitel betrachtet die religiöse Landschaft in Preußen und im Deutschen Reich vor Friedrichs Herrschaft, beleuchtet die Konflikte zwischen verschiedenen Glaubensrichtungen und die Verbreitung des „Cuius regio eius religio“-Prinzips. Im dritten Kapitel wird die Toleranzpolitik Friedrichs des Grossen untersucht, indem seine persönliche Einstellung zur Religion, die theoretischen Grundlagen der Toleranz im aufgeklärten Absolutismus und die konkrete Umsetzung der Toleranzpolitik gegenüber den wichtigsten Religionsgemeinschaften beleuchtet werden. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Politik gegenüber der katholischen Kirche in Schlesien. Das vierte Kapitel analysiert die Auswirkungen der toleranten Religionspolitik auf die Entwicklung des preußischen Staates, insbesondere die Besiedlung, Integration und die Bildung einer einheitlichen Staatsidentität.
Schlüsselwörter
Religiöse Toleranz, Friedrich der Grosse, aufgeklärter Absolutismus, Preußen, Religionsgemeinschaften, Protestanten, Katholiken, Juden, Kirchenpolitik, Besiedlung, Integration, Staatliche Entwicklung, „Cuius regio eius religio“.
- Arbeit zitieren
- Andreas von Bezold (Autor:in), 2006, Religiöse Toleranz unter Friedrich II. von Preußen, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55654