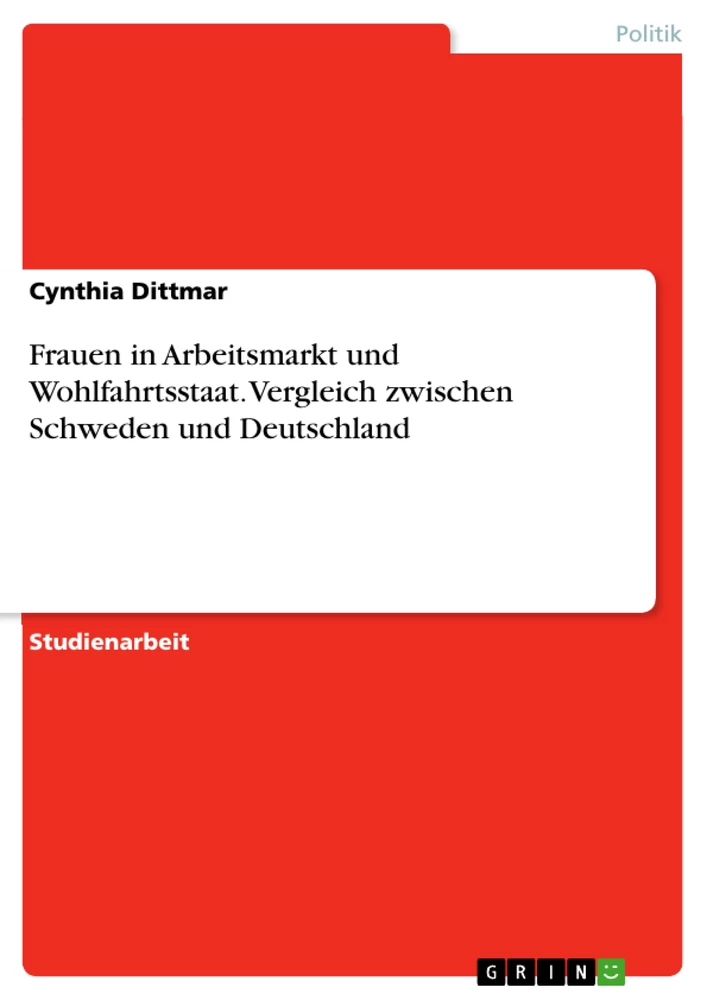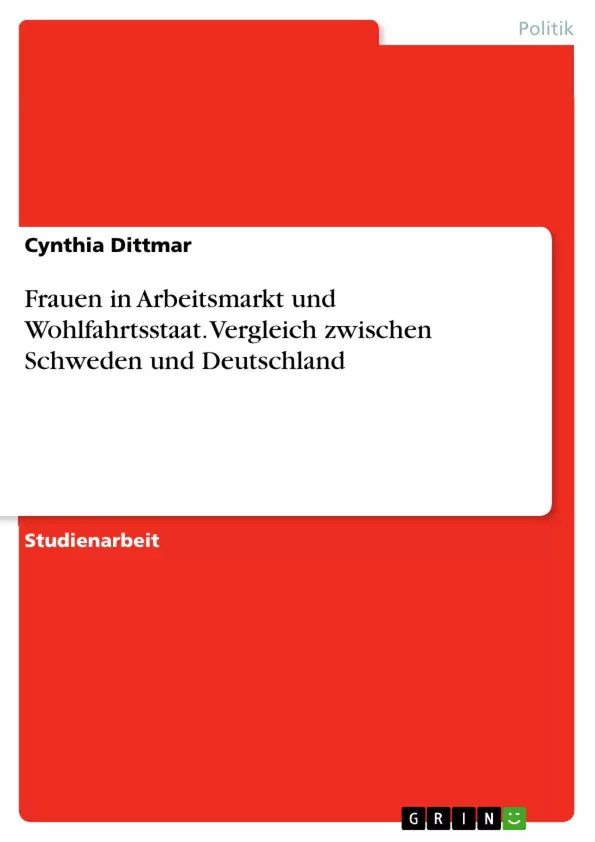Nach einer Erörterung des Wohlfahrts-Regime-Konzeptes von Esping-Andersen und einer Gegenüberstellung der feministischen Kritik, mit Vorschlägen zur Klassifizierung von Wohlfahrtsstaaten nach Gendergesichtspunkten, sollen Deutschland und Schweden gegenübergestellt werden. Nach einer Analyse der Quantität und Qualität der Erwerbsintegration von Frauen, werden Anreize bzw. Fehlanreize der Wohlfahrtspolitik von Schweden und Deutschland diskutiert.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Theoretischer Rahmen
- Wohlfahrts-Regime
- Feministische Kritik und Gender Regime
- Wohlfahrtsstaat Schweden
- Wohlfahrtsstaat Deutschland
- Geschlechtergerechtigkeit des deutschen und schwedischen Arbeitsmarktes
- Arbeitsmarktintegration
- Beschäftigungsquoten
- Arbeitslosigkeit
- Qualität der Erwerbstätigkeit
- Einkommensunterschiede
- Geschlechtliche Segregation
- Atypische Beschäftigung
- Arbeitsmarktintegration
- Wohlfahrtsstaatliche Anreize und Restriktionen
- Steuerpolitik
- Mutterschutz und Elternzeit
- Finanzielle Leistungen
- Kinderbetreuung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt und das Wohlfahrtsregime in Deutschland und Schweden. Sie beleuchtet die Auswirkungen der jeweiligen Wohlfahrtspolitik auf die Erwerbsbeteiligung von Frauen und die Gleichstellung der Geschlechter. Darüber hinaus wird die Qualität der Erwerbstätigkeit von Frauen unter dem Blickwinkel der Geschlechtergerechtigkeit untersucht.
- Einfluss des Wohlfahrtsstaates auf die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt
- Geschlechtergerechtigkeit im Arbeitsmarkt in Deutschland und Schweden
- Analyse der quantitativen und qualitativen Aspekte der Erwerbsintegration von Frauen
- Vergleich der Wohlfahrtspolitik in Deutschland und Schweden im Hinblick auf die Integration von Frauen
- Bewertung der Anreize und Restriktionen der Wohlfahrtspolitik für die Erwerbstätigkeit von Frauen
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt die Problematik der Doppelbelastung von Frauen durch Familie und Beruf dar und führt die Relevanz der Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt für den Wohlfahrtsstaat und die deutsche Wirtschaft aus. Außerdem wird der Vergleich mit Schweden als mögliches Vorbild für die Geschlechtergleichstellung in den Fokus gerückt.
- Theoretischer Rahmen: Dieses Kapitel erläutert die theoretischen Grundlagen des Wohlfahrtsregime-Konzepts von Esping-Andersen sowie die feministische Kritik daran. Es werden die spezifischen Merkmale des schwedischen und deutschen Wohlfahrtsstaates vorgestellt.
- Geschlechtergerechtigkeit des deutschen und schwedischen Arbeitsmarktes: Dieses Kapitel untersucht die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt in Deutschland und Schweden anhand von quantitativen und qualitativen Merkmalen. Es werden die Beschäftigungsquoten, Arbeitslosigkeit, Einkommensunterschiede, geschlechtliche Segregation und atypische Beschäftigung analysiert.
- Wohlfahrtsstaatliche Anreize und Restriktionen: Dieses Kapitel analysiert die Auswirkungen der Steuerpolitik, des Mutterschutzes, der Elternzeit, der finanziellen Leistungen und der Kinderbetreuung auf die Erwerbstätigkeit von Frauen in Deutschland und Schweden.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen und Konzepte dieser Arbeit umfassen die Integration von Frauen in den Arbeitsmarkt, die Geschlechtergerechtigkeit, das Wohlfahrtsregime, der Vergleich zwischen Deutschland und Schweden, die Erwerbsbeteiligung von Frauen, die Qualität der Erwerbstätigkeit, die Wohlfahrtspolitik, Anreize und Restriktionen, Steuerpolitik, Mutterschutz, Elternzeit, finanzielle Leistungen, Kinderbetreuung.
- Arbeit zitieren
- Cynthia Dittmar (Autor:in), 2005, Frauen in Arbeitsmarkt und Wohlfahrtsstaat. Vergleich zwischen Schweden und Deutschland, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55677