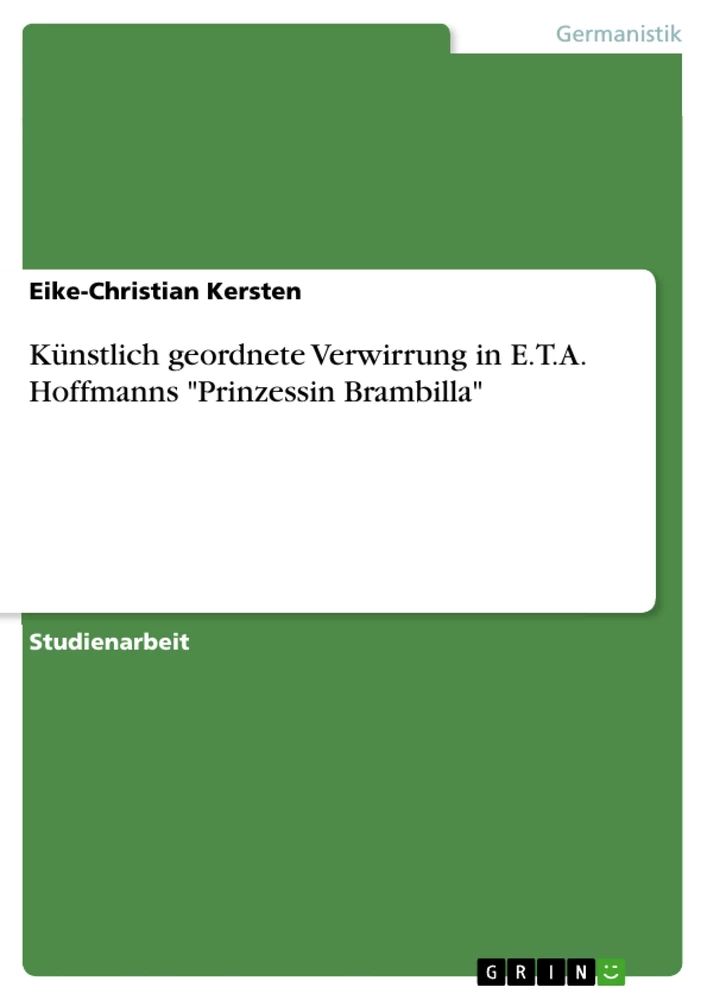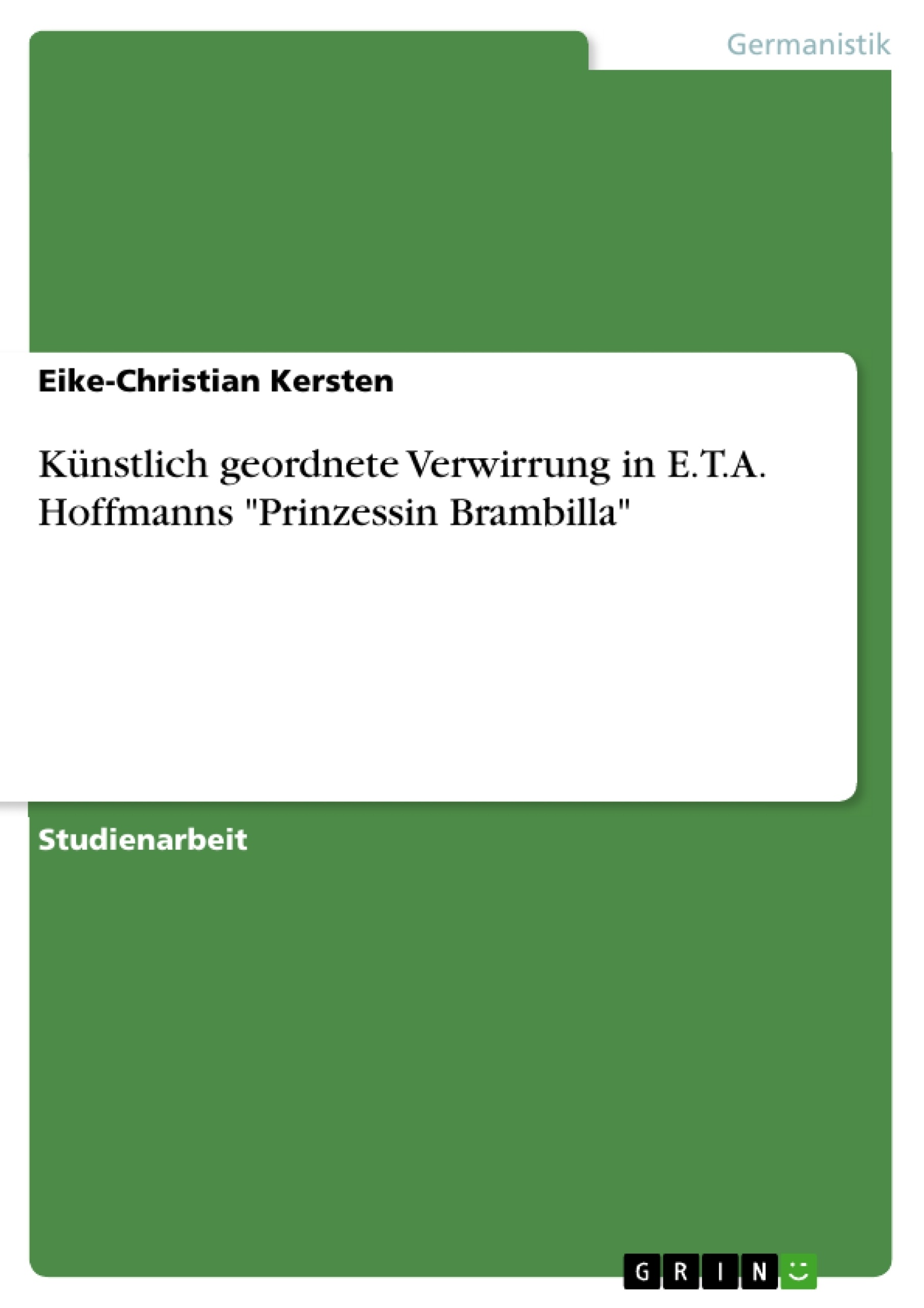Thema soll die Klärung der Frage sein, wie und mit welchen Mitteln E. T. A. Hoffmann jene ,,künstlich geordneten Verwirrung" herbeiführt, die Leser und Kritiker gleichermaßen verwirrt und verärgert, jedenfalls beeindruckt, ohne ihn jedoch gänzlich allein zu lassen. Dazu wird auf die Struktur des Capriccios eingegangen, wobei eine weitere, in der Literatur bisher nicht genannte Erzählebene eingeführt wird; sowie auf die Leseranrede und die Aufspaltung der Personen wie auch ihre Benennung.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Die Struktur
- 3. Die Leseranrede
- 4. Namen und Charakterisierungen der Personen beziehungsweise Figuren
- 4.1 Giglio Fava - Prinz Cornelio Chiapperi - Capitan Pantalon - König Ophioch
- 4.2 Giacinta Soardi - Prinzessin Brambilla - Königin Liris - Prinzessin Mystilis
- 4.3 Ciarlatano Celionati - Fürst Bastianello di Pistoja
- 4.4 Ruffiamonte - Magus Hermod
- 6. Schlußwort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, wie E. T. A. Hoffmann in seinem Capriccio „Prinzessin Brambilla“ eine „künstlich geordnete Verwirrung“ erzeugt. Die Analyse konzentriert sich auf die Struktur des Textes, die Leseranrede und die Namensgebung der Figuren. Die Arbeit vermeidet eine umfassende Interpretation des Werkes und fokussiert auf die genannten Aspekte.
- Analyse der mehrschichtigen Erzählstruktur in „Prinzessin Brambilla“
- Untersuchung der metafiktionalen Leseranrede und ihrer Funktion
- Bedeutung der Namensgebung für die Charakterisierung der Figuren
- Erörterung der widersprüchlichen Rezeption des Capriccios
- Klärung der Mittel, mit denen Hoffmann Verwirrung und Faszination erzeugt
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beleuchtet die kontroverse Rezeption von E. T. A. Hoffmanns „Prinzessin Brambilla“. Sie stellt verschiedene kritische Stimmen gegenüber, die das Werk einerseits als verwirrend und formlos, andererseits als kunstvoll und faszinierend bewerten. Die Einleitung umreißt das Ziel der Arbeit: die Analyse der Mittel, mit denen Hoffmann die „künstlich geordnete Verwirrung“ erreicht.
2. Die Struktur: Dieses Kapitel befasst sich mit der vielschichtigen Erzählstruktur des Capriccios. Es werden verschiedene in der Sekundärliteratur vorgeschlagene Interpretationen der Anzahl und des Zusammenspiels der Erzählebenen vorgestellt und kritisch diskutiert. Der Autor führt eine zusätzliche, bisher nicht erwähnte Ebene ein, um die Komplexität des Textes zu verdeutlichen. Die Analyse konzentriert sich auf das Ineinandergreifen der verschiedenen fiktiven Ebenen, anstatt jede einzelne Ebene isoliert zu betrachten.
3. Die Leseranrede: Dieses Kapitel widmet sich dem für Hoffmann typischen Element der Leseranrede. Im Mittelpunkt steht das metafiktionale Erzählen, welches dem Autor Möglichkeiten der Interaktion mit dem Leser eröffnet. Die Analyse untersucht, wie diese direkte Ansprache den Leser in das Geschehen einbezieht und zur Gestaltung der „künstlich geordneten Verwirrung“ beiträgt.
4. Namen und Charakterisierungen der Personen beziehungsweise Figuren: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der Analyse der Namensgebung der Figuren und deren Bedeutung für die Charakterisierung. Die Untersuchung konzentriert sich auf die Hauptfiguren Giglio Fava und Giacinta Soardi sowie die „Regisseure“ Celionati und Ruffiamonte. Es wird gezeigt, wie Hoffmann durch die Namenswahl bereits im Ansatz die Exzentrik und die Vielschichtigkeit der Figuren betont und diese für die Gesamtwirkung des Textes nutzt.
Schlüsselwörter
Prinzessin Brambilla, E. T. A. Hoffmann, Capriccio, Erzählstruktur, Leseranrede, Figurencharakterisierung, Namensgebung, metafiktionales Erzählen, Romantische Ironie, Verwirrung, Mehrdeutigkeit.
E.T.A. Hoffmanns "Prinzessin Brambilla": Häufig gestellte Fragen (FAQ)
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese akademische Arbeit analysiert E.T.A. Hoffmanns Capriccio "Prinzessin Brambilla" unter Fokussierung auf die von Hoffmann erzeugte "künstlich geordnete Verwirrung". Die Analyse konzentriert sich auf die Struktur des Textes, die Leseranrede und die Namensgebung der Figuren. Eine umfassende Interpretation des Werkes wird vermieden.
Welche Aspekte von "Prinzessin Brambilla" werden untersucht?
Die Arbeit untersucht die mehrschichtige Erzählstruktur, die metafiktionale Leseranrede und ihre Funktion, die Bedeutung der Namensgebung für die Figurencharakterisierung, die widersprüchliche Rezeption des Capriccios und die Mittel, mit denen Hoffmann Verwirrung und Faszination erzeugt.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einleitung: Stellt die kontroverse Rezeption von "Prinzessin Brambilla" dar und umreißt das Ziel der Arbeit. 2. Die Struktur: Analysiert die vielschichtige Erzählstruktur des Capriccios und diskutiert verschiedene Interpretationen der Erzählebenen. 3. Die Leseranrede: Untersucht das metafiktionale Erzählen und die direkte Ansprache des Lesers. 4. Namen und Charakterisierungen der Personen beziehungsweise Figuren: Analysiert die Namensgebung der Figuren und deren Bedeutung für die Charakterisierung, insbesondere der Hauptfiguren und "Regisseure". 6. Schlußwort: (Inhalt nicht im Preview spezifiziert).
Welche Figuren werden im Detail betrachtet?
Die Analyse konzentriert sich auf die Hauptfiguren Giglio Fava und Giacinta Soardi sowie die Figuren Celionati und Ruffiamonte, um die Bedeutung der Namensgebung für die Charakterisierung zu verdeutlichen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Prinzessin Brambilla, E.T.A. Hoffmann, Capriccio, Erzählstruktur, Leseranrede, Figurencharakterisierung, Namensgebung, metafiktionales Erzählen, Romantische Ironie, Verwirrung, Mehrdeutigkeit.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen in strukturierter und professioneller Weise. Sie basiert auf OCR-Daten.
- Arbeit zitieren
- Eike-Christian Kersten (Autor:in), 2006, Künstlich geordnete Verwirrung in E.T.A. Hoffmanns "Prinzessin Brambilla", München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55768