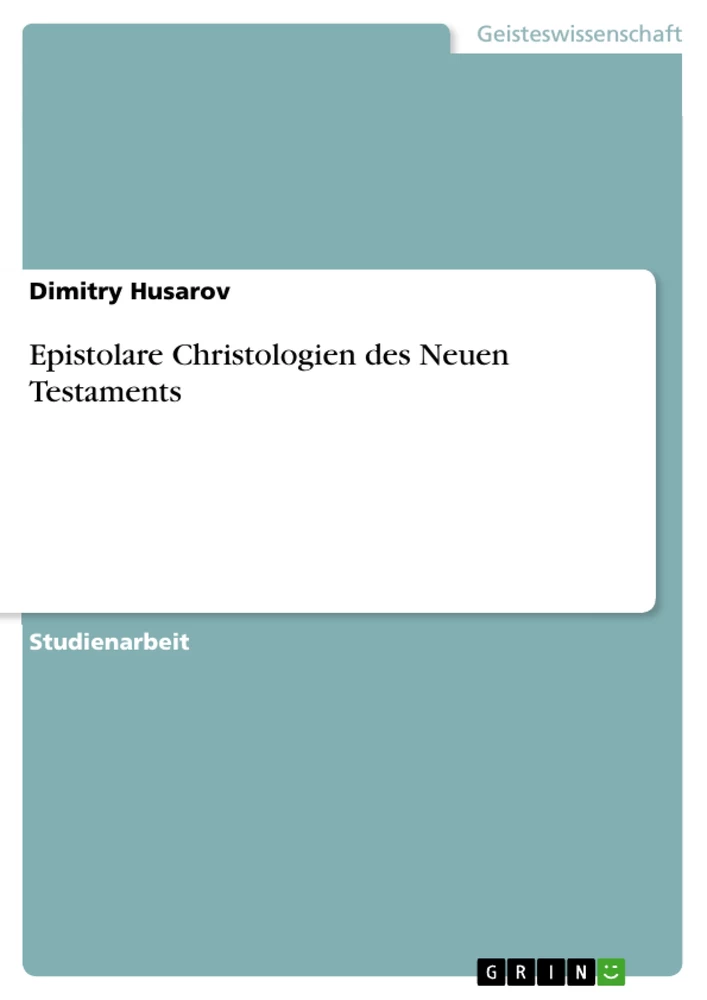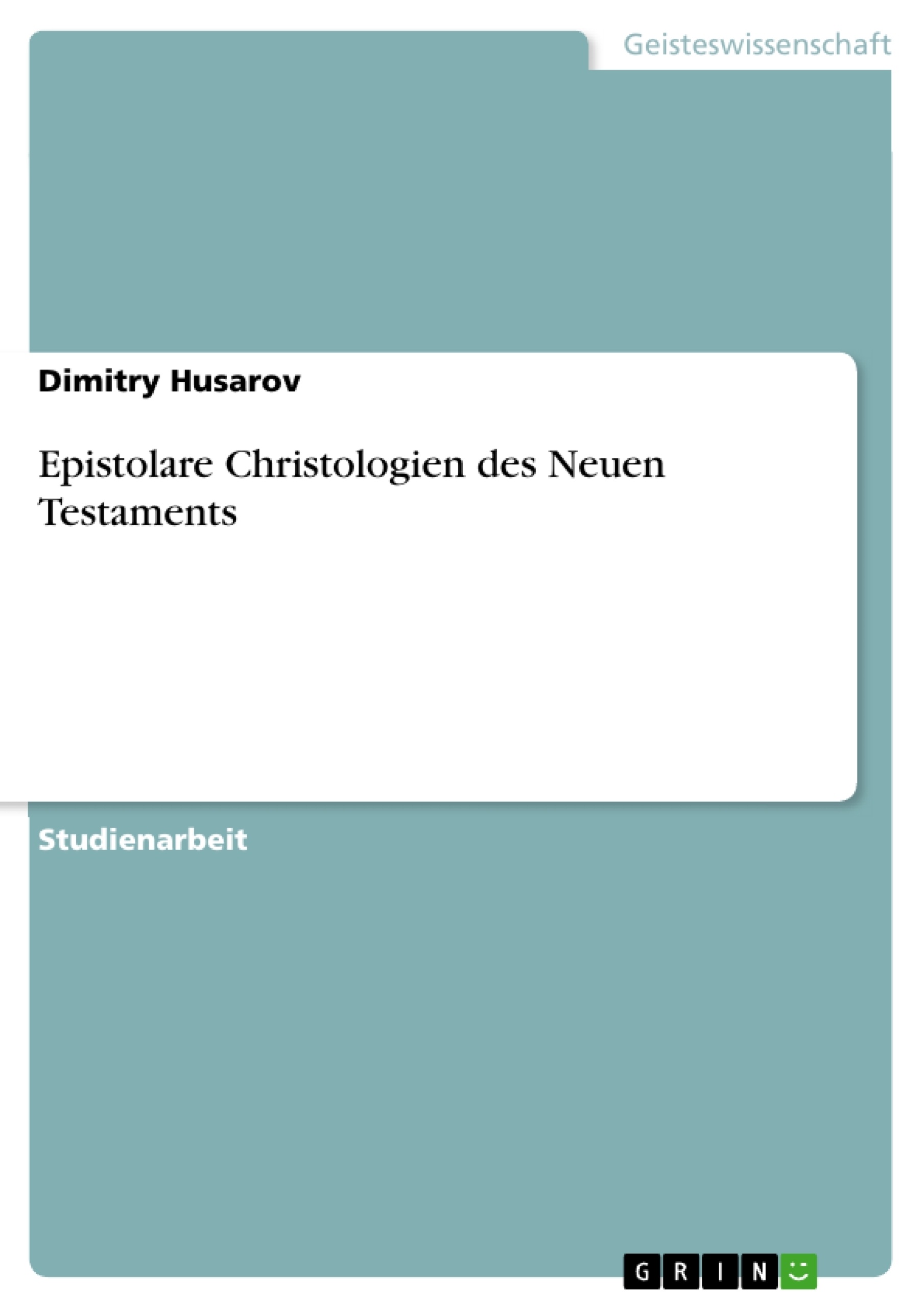„Die Theologie des Paulus, sofern sie konkret ist, nimmt Christus wahr. Alles andere ist Konsequenz oder Abstraktion.“ Wenn man nun sich der Forschung der Person und des Werkes Christi zuwendet, kommt man zum Herz nicht nur der paulinischen Theologie, sondern zu den tiefsten Gründen des christlichen Glaubens.
Die Aufgabe und der Sinn der Christologie besteht in der Darstellung der „Christusgeschehens“ in ihren vielfachen Facetten und von verschiedenen Seiten. Jeder Christ sollte per definitionem mit Freude und Anbetung erfüllt werden, von jedem winzig kleinen Detail, jedem sogar fast unbemerkbaren Strich zum Portrait dessen, wessen Namen er trägt. Daher genießt die christologische Forschung ihre Aktualität, sogar ihre Brisanz in jedem Zeitalter, in jeder Gesellschaft, in jedem Kurs und unter jeder Fragestellung.
Die moderne Christologie hat sich von der Enge der Fragestellung nach der Person Jesu, nach seinem Sein losgelöst und hat auch sein Werk, sein Tun, zu ihrem Gegenstand gemacht. Die Lehre von Christo ist daher immer eine Soteriologie. Das war aber nicht immer und nicht für jeden so. Die verschiedenen Christologien bemühen sich nicht im gleichen Maß um das Heil der Menschen.
Die christologischen Abhandlungen des Neuen Testamentes widersprechen einander in keiner Hinsicht. Sie beleuchten Christus von verschiedenen Seiten und unter verschiedenen Gesichtspunkten. Betrachtet man verschiedene Autoren und Werke, wird man sich wundern, inwieweit unterschiedlich sie Christus darstellen.
In dieser Arbeit geht es um den Versuch eines Vergleiches einiger christologischen Darstellungen. Das Hauptziel dieser Arbeit besteht darin, die Christologie des Apostels Paulus und die Christologie des vorpaulinischen Hymnus Phil 2,6-11 gegenüberzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1 Der Philipperhymnus 2,6-11 und seine christologische Aussage
- 1.1 Exegetische Vorüberlegungen
- 1.1.1 Paulinische Autorschaft des Hymnus?
- 1.1.2 Der Aufbau des Hymnus
- 1.2 Die Einzelexegese des Hymnus
- 1.3 Christologie des Hymnus
- 1.3.1 Die Aussage der ersten Strophe des Hymnus
- 1.3.2 Die Aussage der zweiten Strophe des Hymnus
- 1.1 Exegetische Vorüberlegungen
- 2 Christologie des Apostels Paulus
- 2.1 Die Hoheitstitel Jesu in der paulinischen Verkündigung
- 2.1.1 Jesus der Christus
- 2.1.2 Jesus der Herr
- 2.1.3 Jesus der Sohn Gottes
- 2.1.4 Andere christologische Bezeichnungen
- 2.1.5 Die Bedeutung der Titel und die Gottheit Jesu
- 2.1.6 Zusammenfassung
- 2.2 Die Christologie in „drei christologischen Bewegungen“
- 2.2.1 Erste christologische Bewegung – die Sendung
- 2.2.2 Zweite christologische Bewegung – das Heilswerk
- 2.2.3 Dritte christologische Bewegung – die Vollendung
- 2.2.4 Fazit
- 2.1 Die Hoheitstitel Jesu in der paulinischen Verkündigung
- 3 Der Vergleich der paulinischen Christologie mit den christologischen Aussagen des Hymnus Phil 2,6-11
- 3.1 Die Titel Jesu und der Christushymnus Phil 2,6-11
- 3.2 Drei christologische Bewegungen des Paulus vs. zwei des Hymnus
- 4 Fazit: Das paulinische christologische Gedankengut
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit einem Vergleich der Christologie des Apostels Paulus und der Christologie des vorpaulinischen Hymnus in Phil 2,6-11. Das Hauptziel ist die Gegenüberstellung dieser beiden Ansätze, um das christologische Gedankengut des Paulus zu erforschen. Hierzu werden verschiedene methodische Schritte unternommen, beginnend mit einer detaillierten Exegese des Hymnus, gefolgt von einer Darstellung der paulinischen Christologie und abschliessend einer Analyse der Gemeinsamkeiten und Unterschiede.
- Die christologische Aussage des Hymnus in Phil 2,6-11
- Die Darstellung der paulinischen Christologie
- Ein Vergleich der beiden Christologien
- Das Herausarbeiten des paulinischen Gedankenguts
- Die Untersuchung der Bedeutung des hymnischen Textes für die Entwicklung des Christentums
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel widmet sich dem Philipperhymnus 2,6-11. Es untersucht die Exegese des Hymnus, betrachtet die Fragen der Autorschaft und des Aufbaus sowie die Interpretation einzelner Ausdrücke und die christologische Konzeption. Im zweiten Kapitel wird die Christologie des Apostels Paulus anhand der Würdetitel Jesu und des Konzepts der „drei christologischen Bewegungen“ beleuchtet. Das dritte Kapitel setzt die beiden Kapitel in Beziehung und vergleicht die Ergebnisse, um die Gemeinsamkeiten und Unterschiede der beiden Christologien herauszuarbeiten. Der letzte Abschnitt (Kapitel 4) präsentiert das Fazit und fasst die Ergebnisse der Arbeit zusammen.
Schlüsselwörter
Paulinische Christologie, Philipperhymnus, Phil 2,6-11, christologische Bewegungen, Hoheitstitel Jesu, Präexistenz, Inkarnation, Erhöhung, Kenosis, Gottheit Jesu, christologisches Gedankengut, vorpaulinische christologische Formationen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel des christologischen Vergleichs in dieser Arbeit?
Die Arbeit stellt die Christologie des Apostels Paulus der des vorpaulinischen Hymnus in Philipper 2,6-11 gegenüber.
Was besagt der Philipperhymnus (Phil 2,6-11)?
Der Hymnus beschreibt den Weg Christi von der Gottesgestalt über die Entäußerung (Kenosis) und Menschwerdung bis hin zur Erhöhung und Verherrlichung durch Gott.
Welche Hoheitstitel Jesu nutzt Paulus in seiner Verkündigung?
Zentrale Titel sind „Christus“, „Herr“ (Kyrios) und „Sohn Gottes“, die jeweils unterschiedliche Aspekte der Gottheit und des Werkes Jesu betonen.
Was sind die „drei christologischen Bewegungen“ bei Paulus?
Paulus beschreibt das Christusgeschehen oft in den Phasen der Sendung, des Heilswerks (Kreuz und Auferstehung) und der abschließenden Vollendung.
Warum ist Christologie immer auch Soteriologie?
Weil die Lehre von der Person Christi untrennbar mit seinem Werk, also der Errettung (Heil) des Menschen, verbunden ist.
- Arbeit zitieren
- Dimitry Husarov (Autor:in), 2006, Epistolare Christologien des Neuen Testaments, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55905