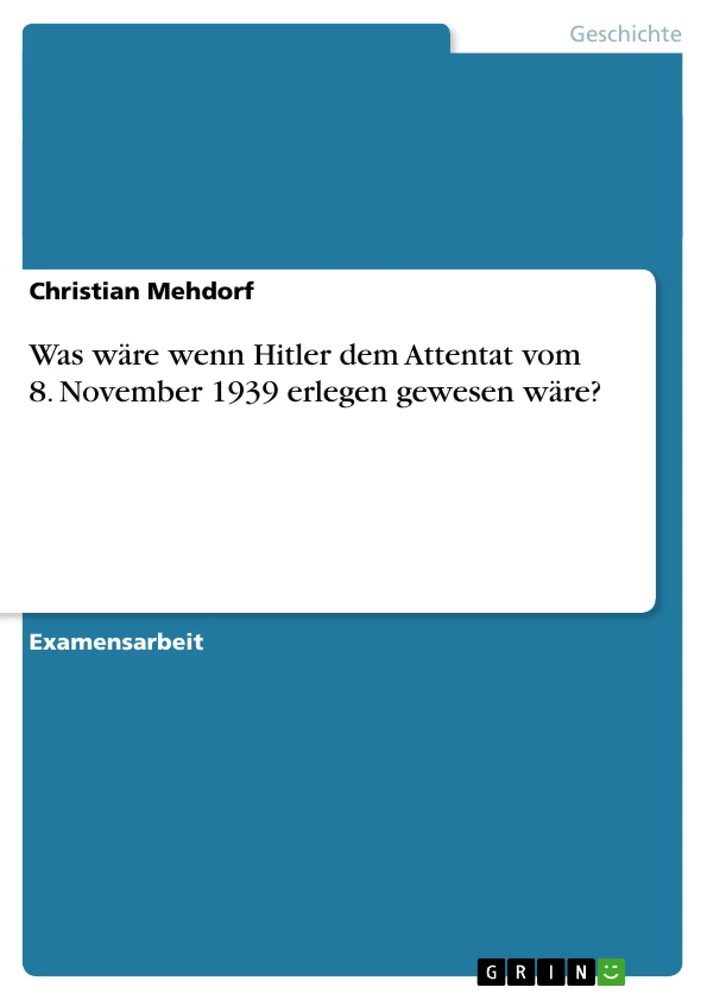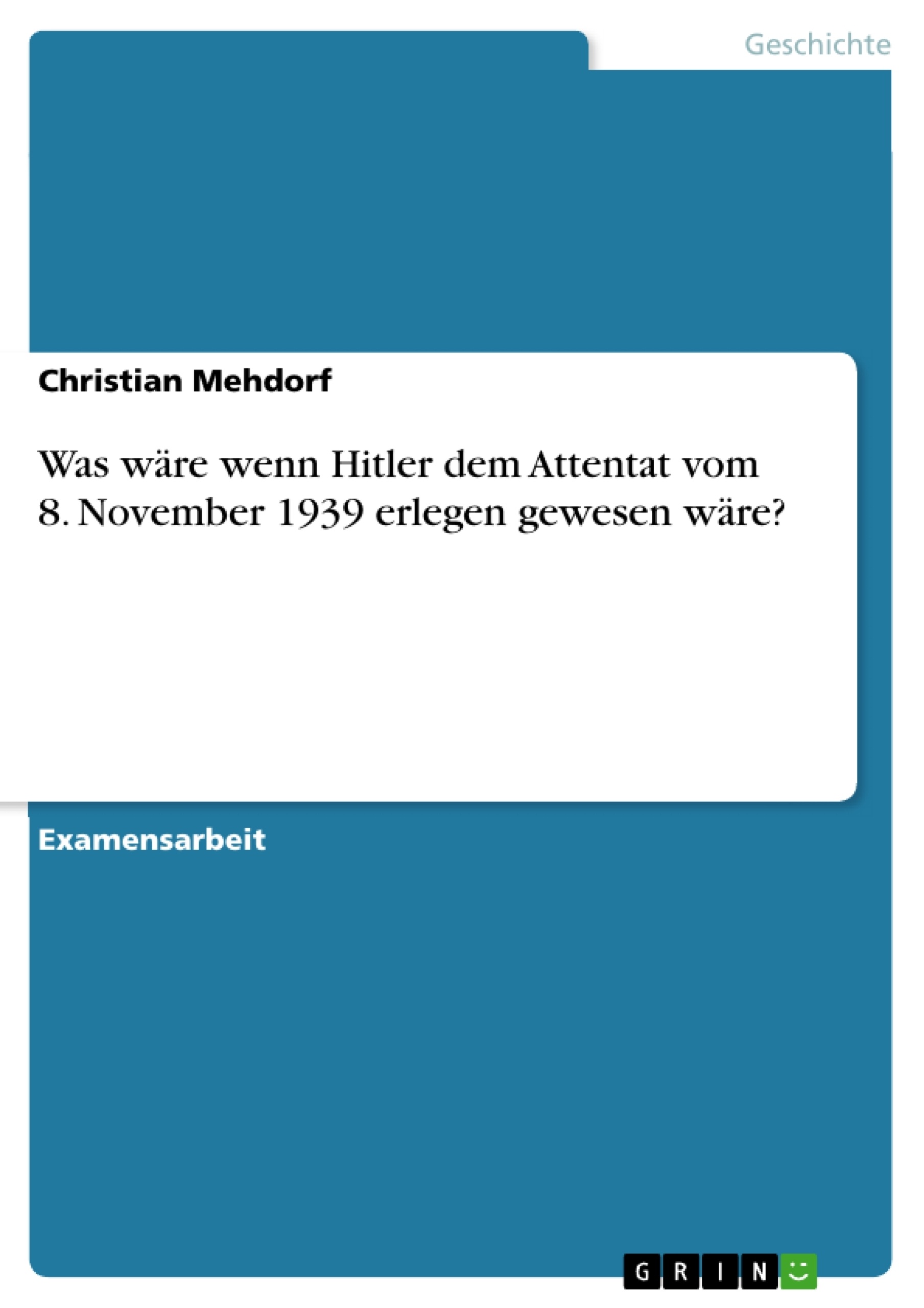Die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus bildet einen gewichteten Kern nachkriegsdeutscher Identität. Sie definiert unser Verhältnis zu uns selbst und unseren Nachbarn, sie trennt und vereint Generationen, Ost und West. Als zentrale Gestalt jener dreiecksähnlichen Betrachtung zwischen Opfern, Tätern und der deutschen Gesellschaft ist Adolf Hitler zu nennen. Über seine Rolle und Funktion innerhalb des Nationalsozialistischen Herrschaftssystems wird seit Jahrzehnten in der Fachwissenschaft diskutiert.
Die Person Hitler, die im Zentrum dieser politisch-historischen und nicht zuletzt auch geschichtsphilosophischen Debatte steht, erhält damit eine zentrale Bedeutung. Ganz im Gegensatz steht dazu die Unwichtigkeit seines Todes am 30. April 1945. Sein Tod änderte nichts am Lauf der Ereignisse, das Ende des Zweiten Weltkrieges stand bereits fest.
Was wäre aber geschehen, wenn die Person Adolf Hitler nicht freiwillig aus dem Leben geschieden wäre, sondern einem der 42 Attentate zum Opfer gefallen wäre? Was wäre dann aus der nationalsozialistischen Bewegung und dem Deutschland zu jener Zeit geworden? Wie wäre es in den Bereichen politischer Führung, Kriegsverlauf und antisemitischer Ideologie weitergegangen? In aktuellen Lehrbüchern und Unterrichtskonzepten wird dieser alternativhistorischen Fragestellung mit ihrem Konjunktiv irrealis weder nachgegangen noch wird diese thematisiert. Dieses habe ich mit Schülern einer 9. Gesamtschulklasse als vertiefende Auseinandersetzung zum Thema„Wie konnte dieses geschehen? - Der Nationalsozialismus“getan. Dabei wählte ich ein vergleichbar unbekanntes Attentat von Georg Elser, welches am 8. November 1939 nach langer Vorbereitung scheiterte, da Hitler den Tatort 13 Minuten früher verließ als ursprünglich vorgesehen. Neben inhaltlichen Aspekten zum Attentat steht in dieser Unterrichtssequenz meine gewählte Fragestellung„Was wäre, wenn Adolf Hitler dem Attentat vom 8. November 1939 erlegen gewesen wäre?“im Vordergrund, inwieweit sich politische Strukturen, Kriegssituation und die antisemitische Haltung im Falle dessen verändert hätten.
Vor diesem Hintergrund ist es das Ziel dieser Arbeit, die alternativhistorische Betrachtungsweise anhand einer durchgeführten Unterrichtreihe mit sieben Einheiten darzustellen, praxisnah zu reflektieren und folgende persönlich gestellte Fragestellungen zu beantworten:
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung und Fragestellung
- 2. Vorstellung der alternativhistorischen Betrachtungsweise für den Geschichtsunterricht
- 2.1. Die alternativhistorische Betrachtungsweise und Beispiele aus der Literatur
- 2.2. Stellenwert der alternativhistorischen Betrachtungsweise in der Geschichtswissenschaft
- 2.3. Grundsätze zur Durchführung der alternativhistorischen Betrachtungsweise im Unterricht
- 3. Planung einer alternativhistorischen Unterrichtssequenz zum Hitler-Attentat vom 8. November 1939
- 3.1. Die Lerngruppe im Bezug zum Unterrichtsgegenstand
- 3.2. Didaktische Relevanz der alternativhistorischen Fragestellung innerhalb des Hamburger Rahmenplans Gesellschaft
- 3.3. Methodisch-didaktische Vorüberlegungen zum Unterrichtsgegenstand
- 3.4. Sachanalyse zum Attentat auf Hitler vom 8. November 1939 und seine möglichen Auswirkungen
- 3.4.1. Georg Elser und das Attentat vom 8. November 1939
- 3.4.2. Mögliche Auswirkungen auf politische Strukturen, Weiterführung des Krieges und auf die Rassenideologie nach dem 8. November 1939
- 3.5. Lerzielformulierungen für die Unterrichtssequenz
- 4. Darstellung der Unterrichtssequenz „Was wäre wenn, Adolf Hitler dem Attentat vom 8. November 1939 erlegen gewesen wäre?”
- 4.1. Tabellarische Übersicht zur durchgeführten Unterrichtssequenz
- 4.2. Durchführung und Reflexion einzelner Unterrichtsschritte
- 4.2.1. Abschnitt 1: Georg Elser und das Attentat auf Hitler am 8. November 1939
- 4.2.2. Abschnitt 2: Was wäre eventuell geschehen, wenn das Attentat auf Hitler erfolgreich verlaufen wäre?
- 4.2.3. Abschnitt 3: Georg Elser: „Ich wollte nur ein weiteres Blutvergießen verhindern”
- 4.3. Detaillierte Betrachtung der Einzelstunde vom 17.01.2006
- 5. Gesamtreflexion unter Einbeziehung der Fragestellungen und Schlussfolgerungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Anwendung der alternativhistorischen Betrachtungsweise im Geschichtsunterricht am Beispiel eines Unterrichtsprojekts zum gescheiterten Attentat auf Hitler am 8. November 1939. Ziel ist es, den Erkenntnisgewinn für Schüler durch diesen Ansatz zu evaluieren und dessen Eignung zur Förderung des historischen Denkens zu prüfen. Die Arbeit analysiert die didaktischen und methodischen Herausforderungen und Chancen dieser kontroversen Herangehensweise.
- Anwendung der alternativhistorischen Methode im Geschichtsunterricht
- Didaktische Analyse der Unterrichtssequenz zum Hitler-Attentat
- Förderung des historischen Denkens durch kontrafaktische Geschichtsbetrachtung
- Analyse der möglichen Auswirkungen eines erfolgreichen Attentats auf Hitler
- Reflexion des Erkenntnisgewinns der Schüler
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung und Fragestellung: Die Arbeit untersucht die Bedeutung der Figur Adolf Hitlers in der Aufarbeitung des Nationalsozialismus und stellt die Frage nach den möglichen Folgen eines erfolgreichen Attentats auf ihn. Im Gegensatz zum tatsächlichen Tod Hitlers, der den Kriegsverlauf nicht mehr beeinflusste, wird hier die kontrafaktische Frage nach den Auswirkungen eines früheren Todes gestellt. Die Arbeit fokussiert auf ein spezifisches Attentat und beleuchtet die didaktischen und methodischen Implikationen der Untersuchung im Geschichtsunterricht.
2. Vorstellung der alternativhistorischen Betrachtungsweise für den Geschichtsunterricht: Dieses Kapitel definiert und erläutert die alternativhistorische Betrachtungsweise, auch bekannt als Uchronie oder kontrafaktische Geschichte. Es werden Beispiele aus der Literatur genannt und die kontroverse Diskussion um ihren Platz in der Geschichtswissenschaft dargestellt. Das Kapitel leitet didaktische Schlussfolgerungen für den Einsatz im Geschichtsunterricht ab und legt die Grundlagen für die Methodik des darauf folgenden Unterrichtsprojekts.
3. Planung einer alternativhistorischen Unterrichtssequenz zum Hitler-Attentat vom 8. November 1939: Dieses Kapitel beschreibt die Planung der Unterrichtssequenz, indem es die Lerngruppe, die didaktische Relevanz im Rahmen des Hamburger Lehrplans und methodisch-didaktische Überlegungen berücksichtigt. Eine detaillierte Sachanalyse des Attentats von Georg Elser und möglicher Auswirkungen auf politische Strukturen, den Kriegsverlauf und die Rassenideologie bildet den Kern dieses Kapitels. Die Formulierung von Lernzielen rundet den Planungsprozess ab.
Schlüsselwörter
Alternativgeschichte, Kontrafaktische Geschichte, Uchronie, Nationalsozialismus, Adolf Hitler, Georg Elser, Geschichtsdidaktik, Geschichtsunterricht, Historisches Denken, Attentat, Zweiter Weltkrieg, Rassenideologie, Politische Strukturen, Didaktische Analyse, Methodische Reflexion.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Arbeit: "Was wäre wenn, Adolf Hitler dem Attentat vom 8. November 1939 erlegen gewesen wäre?"
Was ist das Thema der Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Anwendung der alternativhistorischen Betrachtungsweise im Geschichtsunterricht anhand eines konkreten Unterrichtsprojekts zum gescheiterten Attentat auf Hitler am 8. November 1939. Es wird der Erkenntnisgewinn der Schüler durch diesen Ansatz evaluiert und dessen Eignung zur Förderung des historischen Denkens geprüft. Die didaktischen und methodischen Herausforderungen und Chancen dieser Herangehensweise werden analysiert.
Welche Methode wird in der Arbeit angewendet?
Die Arbeit verwendet die alternativhistorische (kontrafaktische) Betrachtungsweise. Es wird untersucht, welche Auswirkungen ein erfolgreicher Verlauf des Attentats auf Hitler auf politische Strukturen, den Kriegsverlauf und die Rassenideologie gehabt hätte. Dies dient als Grundlage für die didaktische Reflexion im Geschichtsunterricht.
Welche Aspekte des Attentats vom 8. November 1939 werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf das Attentat von Georg Elser und analysiert dessen möglichen Einfluss auf den weiteren Verlauf des Zweiten Weltkriegs, die politische Entwicklung und die Rassenideologie des Nationalsozialismus. Es wird die kontrafaktische Frage nach den Folgen eines erfolgreichen Attentats gestellt.
Wie wird die alternativhistorische Methode im Geschichtsunterricht eingesetzt?
Die Arbeit beschreibt die Planung und Durchführung einer Unterrichtssequenz, die die alternativhistorische Methode nutzt. Es werden die didaktischen und methodischen Überlegungen, die Lerngruppe und die Einbettung in den Hamburger Rahmenplan Gesellschaft erläutert. Die Reflexion der durchgeführten Unterrichtseinheiten und der Lernerfolge der Schüler bildet einen wichtigen Bestandteil.
Welche Lernziele werden in der Unterrichtssequenz verfolgt?
Die Lernziele der Unterrichtssequenz zielen auf die Förderung des historischen Denkens durch die Auseinandersetzung mit einer kontrafaktischen Fragestellung ab. Die Schüler sollen die Methode der Alternativgeschichte verstehen und anwenden können, sowie die möglichen Konsequenzen eines veränderten historischen Verlaufs analysieren und kritisch reflektieren.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: 1. Einführung und Fragestellung; 2. Vorstellung der alternativhistorischen Betrachtungsweise für den Geschichtsunterricht; 3. Planung einer alternativhistorischen Unterrichtssequenz zum Hitler-Attentat vom 8. November 1939; 4. Darstellung der Unterrichtssequenz; 5. Gesamtreflexion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Alternativgeschichte, Kontrafaktische Geschichte, Uchronie, Nationalsozialismus, Adolf Hitler, Georg Elser, Geschichtsdidaktik, Geschichtsunterricht, Historisches Denken, Attentat, Zweiter Weltkrieg, Rassenideologie, Politische Strukturen, Didaktische Analyse, Methodische Reflexion.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Arbeit zieht Schlussfolgerungen über den Einsatz der alternativhistorischen Methode im Geschichtsunterricht. Sie bewertet den Erkenntnisgewinn der Schüler und die Eignung dieser Methode zur Förderung des historischen Denkens. Die didaktischen und methodischen Herausforderungen und Chancen werden abschließend bewertet.
- Quote paper
- Christian Mehdorf (Author), 2006, Was wäre wenn Hitler dem Attentat vom 8. November 1939 erlegen gewesen wäre?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/55963