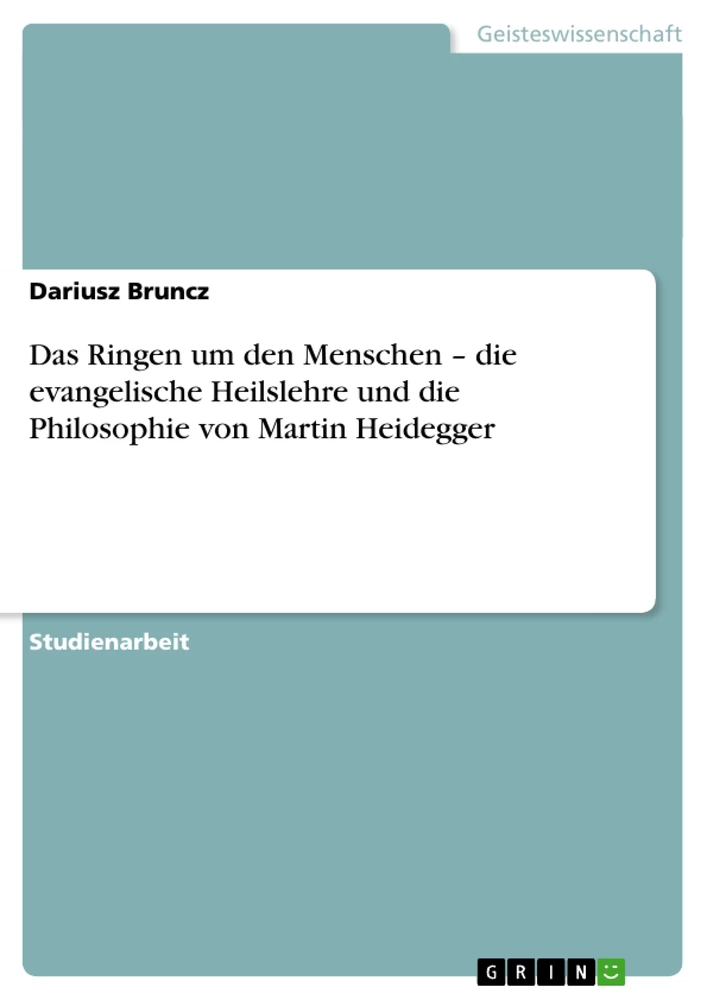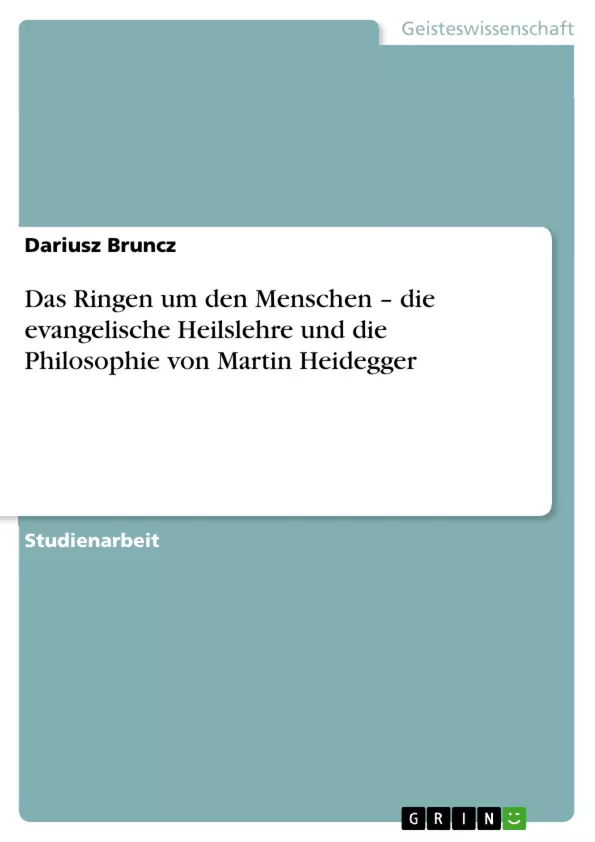Die etablierten konfessionellen Großkirchen bemühen sich um den Missionserfolg, wobei sie sich dessen ganz gut bewußt sind, daß die neuzeitliche Religiosität von dem selektiven konfessionsübergreifenden Synkretismus gekennzeichnet ist. Die radikale und von den überlieferten Glaubenswahrheiten getrennte Individualisierung der Suche nach dem Göttlichen steht am Scheideweg. Auch die philosophischen Systeme und andere Ersatzreligionen wollen den verwirrten Menschen ansprechen. Sie bedienen sich dabei der quasireligiösen Sprache, die manchmal geschickt hinter den eigentlichen Gedanken verborgen steht oder für die partikulären Zwecke umgewertet wird. Der gegenseitige Einfluß ist in diesem Fall nicht zu vermeiden. Das hat gewiss positive und negative Folgen für jeweilige "Parteien", aber eine Sache wird dabei auffällig: der Kampf um den Menschen, um seine Seele und seinen Verstand ist keineswegs ausgetragen. Die neuen Dimensionen dieses Kampfes werden mit neuen Fragen(-stellungen) gemacht, zwischen denen sowohl inhaltliche Differenzen als auch rhetorische Kunstfiguren vorkommen können.
Diese Hausarbeit ist ein kleiner Versuch einen von diesen Kämpfen aufzuhellen, und zwar das Gespräch zwischen der christlichen Heilslehre (Soteriologie) in ihrer reformatorischen Ausprägung (Martin Luther und Paul Tillich) und der Philosophie von Martin Heidegger, dem Zauberer von Meßkirch, wie den berühmtesten Philosophen aus der Provinzstadt in Schwaben sein Biograph Rüdiger Safranski einmal genannt hat. Martin Heidegger ist eine denkerische Größe an sich. Wenn man seine Werke liest und sein Leben dabei bedenkt, kann man sich keine Gleichgültigkeit leisten, es sei denn, daß man ihn überhaupt nicht richtig verstanden hat. Einerseits, nahezu prophetisch und in seiner Suche nach dem Sein andachtsvoll interpretiert, andererseits blasphemisch oder sogar atheistisch denkbar. Der Denker aus Leidenschaft und aus der selbstaufgeworfenen Berufung. Ein verkrachter Priester ohne seine Kirche und ohne Botschaft, der doch seine letzte Ruhe auf dem römisch-katholischen Friedhof in Meßkirch, unter erneuter Obhut der Kirche, finden wollte. Ob es begründet und mit seiner Philosophie übereinstimmend war, bleibt noch umstritten. Es sollten hier die Überlappungen, Ähnlichkeiten aber vor allem die Divergenzen der existenziellen Philosophie und der reformatorischen Theologie erörtert werden, die sich überraschenderweise bei vielen Diskussionsfragen begegnen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Das Fragen nach dem Sein und die Überwindung der Uneigentlichkeit
- Die Entlarvung des Man.
- Der Mut zum Sein – die Philosophie..
- Die Grenzen des menschlichen Daseins...
- In der Freiheit der Wahrheit..
- Das christlich-reformatorische Verständnis des Heils
- Die evangelische Anthropologie nach Martin Luther...
- Das Ereignis der Rechtfertigung und die Torheit des Kreuzes.......
- Der systematisch-theologische Diskurs: Das Sein und die Frage nach Gott bei Paul Tillich...
- Philosophie und Glaube im Gespräch ......
- Nur ein Gott kann uns retten..
- Schlussfolgerungen.......
- Fremdsprachliche Zusammenfassung
- Literaturverzeichnis........
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Beziehung zwischen der evangelischen Heilslehre (Soteriologie) und der Philosophie von Martin Heidegger. Der Schwerpunkt liegt auf den Gemeinsamkeiten und Unterschieden zwischen der reformatorischen Theologie und der existenziellen Philosophie, insbesondere im Hinblick auf die Frage nach dem Sein und der Bedeutung des Menschen.
- Das Verhältnis von Philosophie und Theologie
- Das Wesen des menschlichen Daseins und die Überwindung der Uneigentlichkeit
- Die Bedeutung des christlichen Heils und die Rolle der Rechtfertigung
- Der Einfluss der Phänomenologie auf die Philosophie Heideggers
- Die Frage nach dem Sein und die Grenzen des menschlichen Verstehens
Zusammenfassung der Kapitel
- Einführung: Diese Einleitung stellt die Thematik der Hausarbeit vor und beleuchtet die aktuelle Debatte um die Relevanz des christlichen Glaubens in der heutigen Zeit. Sie fragt nach dem geistigen Zustand des Menschen und dem Kampf um seine Seele und seinen Verstand.
- Das Fragen nach dem Sein und die Überwindung der Uneigentlichkeit: Dieses Kapitel analysiert die phänomenologische Denktradition, in der Heidegger steht. Es beleuchtet die Bedeutung der phänomenologischen Reduktion und ihre Anwendung auf die Frage nach dem Sein.
- Das christlich-reformatorische Verständnis des Heils: Dieses Kapitel widmet sich dem evangelischen Verständnis des Heils nach Martin Luther und Paul Tillich. Es erörtert die anthropologischen Grundprinzipien des reformierten Denkens sowie die Bedeutung der Rechtfertigung und die Rolle des Kreuzes.
- Philosophie und Glaube im Gespräch: In diesem Kapitel wird die Verbindung zwischen Philosophie und Glaube betrachtet. Es beleuchtet die These, dass nur Gott den Menschen retten kann und diskutiert die Frage nach der Beziehung zwischen philosophischer und theologischer Erkenntnis.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Martin Heidegger, evangelische Heilslehre, Soteriologie, Phänomenologie, Uneigentlichkeit, Rechtfertigung, Existenzphilosophie, Martin Luther, Paul Tillich, Sein, Dasein, Glaube, Philosophie, Theologie.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Thema des Gesprächs zwischen Heidegger und der Theologie?
Die Arbeit untersucht die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Martin Heideggers Existenzphilosophie und der reformatorischen Heilslehre von Luther und Tillich.
Was bedeutet "Uneigentlichkeit" bei Heidegger?
Uneigentlichkeit beschreibt einen Zustand, in dem der Mensch sich im "Man" verliert und nicht sein eigenes, authentisches Dasein lebt.
Wie definiert Martin Luther die "evangelische Anthropologie"?
Luthers Sicht betont die Sündhaftigkeit des Menschen und die Unfähigkeit, sich selbst zu retten, was zur zentralen Bedeutung der Rechtfertigung allein durch den Glauben führt.
Was ist die "Torheit des Kreuzes" in der Soteriologie?
Es beschreibt das paradoxe Ereignis der Rechtfertigung, bei dem Gott durch das Leiden und Sterben Christi das Heil wirkt, was dem menschlichen Verstand oft widersinnig erscheint.
Warum nannte man Heidegger den "Zauberer von Meßkirch"?
Dieser Begriff stammt von seinem Biographen Rüdiger Safranski und spielt auf Heideggers faszinierende, fast prophetische Sprache und seine tiefe Verwurzelung in seiner Heimat an.
- Arbeit zitieren
- Dariusz Bruncz (Autor:in), 2002, Das Ringen um den Menschen – die evangelische Heilslehre und die Philosophie von Martin Heidegger, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5600