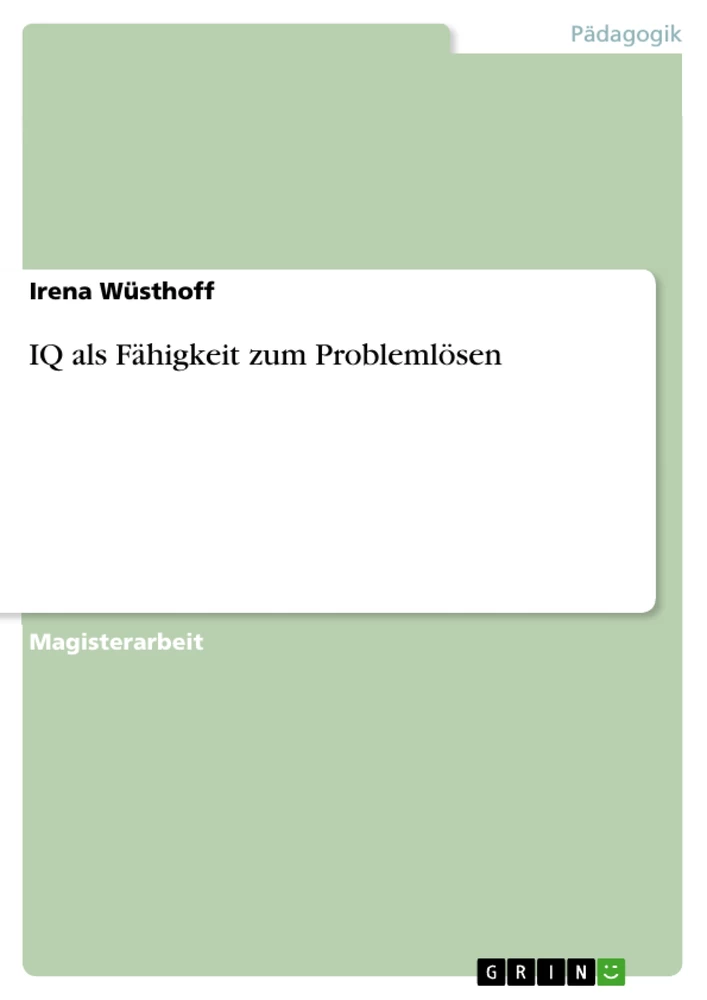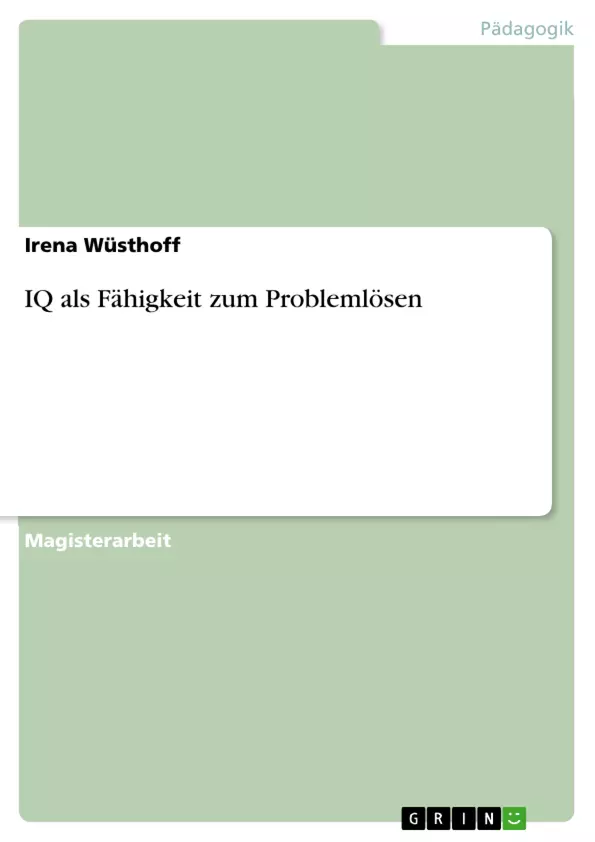Auf den Zusammenhang zwischen Intelligenz und Problemlösen wurden die Psychologen erst Anfang der 80er Jahre aufmerksam, als vor allem im deutschsprachigen Raum das Lösen von komplexen Problemen untersucht wurde. Eine kleine Stadt oder eine Werkstatt wurde vom Computerprogramm simuliert und es wurden nicht nur die Leistungen der Probanden in der Rolle des Bürgermeisters bzw. des Managers untersucht, sondern auch die Korrelationen der Leistungen mit ausgewählten Persönlichkeitsmerkmalen, u.a. mit der Intelligenz.
Die besonders niedrig ausfallende Korrelation zwischen der Problemlösefähigkeit und der Intelligenz sorgte für unglaubliche Überraschung und Verwirrung und löste eine Reihe wissenschaftlicher Untersuchungen aus, die allerdings nicht unbedingt größere Klarheit verschaffen konnten.
Dietrich Dörner, einer der bedeutendsten deutschen Psychologen, der auf dem Gebiet der Forschung zum Thema Intelligenz und Problemlösen eine besondere Rolle spielt, kommt sogar zur Schlussaussage, dass zwischen der Intelligenz und der Fähigkeit Probleme zu lösen, kein Zusammenhang besteht.
Demzufolge taucht eine Reihe von Fragen auf:
Ist Dörners These, Intelligenz hätte mit Problemlösefähigkeit nur wenig zu tun, tatsächlich berechtigt? Auf welche Fakten stützt sich seine These? Kann sie durch spätere Forschungsergebnisse bestätigt oder widerlegt werden?
Ebenso ist zu fragen, auf welchen Ursachen die fehlende Korrelation beruht? Welche Anforderungen stellen einerseits die IQ-Tests und anderseits die komplexen Probleme an die Probanden? Ist es überhaupt gerechtfertigt die Leistungen der Probanden in IQ-Tests mit ihren Leistungen beim Lösen von komplexen Problemen zu vergleichen?
Welche konkreten Ergebnisse liefert die Forschung und wie sehen die Zukunftsaussichten aus?
Um die eben gestellten Fragen beantworten zu können, wird folgende Vorgehensweise gewählt:
Anfangs wird auf die o.e. provozierende These von Dörner eingegangen.
In Kapitel 2.2 wird das Lohhausen-Paradigma von Dörner vorgestellt. Es werden ausführlich der Aufbau des Szenarios und die Aufgaben der Probanden beschrieben. Ebenso wird analysiert, welche Ergebnisse das Lohhausen-Paradigma liefert, die Dörner zu seiner These führten.
In 4. Kapitel wird der neue Ansatz in der Intelligenz-Problemlöse-Forschung von Professor Hermann Rüppell vorgestellt. QI statt IQ heißt das neue originelle Konzept der qualitativen Informationsverarbeitung (QI).
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Dörner: Intelligenz und Problemlösen
- 2.1 Problemdefinition
- 2.2 Lohhausen-Paradigma
- 2.2.1 Ergebnisse des Lohhausen-Paradigma
- 2.3 Diskussion der Ergebnisse des Lohhausen-Paradigma
- 3. Schneiderwerkstattproblem (SWS)
- 3.1 SWS & Putz-Osterloh und Lüer
- 3.1.1 Ergebnisse
- 3.2 SWS & Funke
- 3.2.1 Ergebnisse
- 3.3 SWS & Hussy
- 3.3.1 Ergebnisse
- 3.4 Zusammenfassende Betrachtung
- 3.1 SWS & Putz-Osterloh und Lüer
- 4. Rüppell: QI statt IQ
- 4.1 GIN & CHIPS - Modell
- 4.1.1 Das Konzept der produktiven Intelligenz
- 4.1.2 GIN – Die Struktur der produktiven Intelligenz
- 4.1.3 CHIPS Die Prozesse der produktiven Intelligenz
- 4.1.4 GIN & CHIPS
- 4.1.5 Die Lehre der produktiven Intelligenz
- 4.1.5a Die Lehre der Mikrooperationen
- 4.1.5b Die Lehre der handlungsanalogen Schemata
- 4.1.5c Ein Lehr- und Lernmodell für die Ausbildung der CHIPS
- 4.2 Der DANTE-Test
- 4.2.1 Analogie-Empfänglichkeit (AE)
- 4.2.2 Selektive Elaboration (SE)
- 4.2.3 Koordinationskapazität (KK)
- 4.2.4 Strukturierungsflexibilität (SF)
- 4.2.5 Synergetisches Denken (SD)
- 4.2.6 Operationalisierung der Qualitäten des erfinderischen Denkens
- 4.2.7 Entwurf des DANTE-Tests
- 4.3 Zusammenfassende Betrachtung
- 4.1 GIN & CHIPS - Modell
- 5. Die Diskussion der bisherigen Befunde
- 6. Internetbeiträge zum Thema der Intelligenz- und Problemlöseforschung
- 6.1 Komplexes Problemlösen, Funke
- 6.2 Determinanten komplexen Problemlösens, Wittman, Süß & Oberauer
- 6.3 Erfassung fächerübergreifender Problemlösekompetenzen in PISA, Baumert et al.
- 7. Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Magisterarbeit analysiert den Zusammenhang zwischen menschlicher Intelligenz und der Fähigkeit, Probleme zu lösen. Sie untersucht, ob und inwieweit Intelligenz eine Rolle beim erfolgreichen Lösen komplexer Aufgaben spielt und welche Faktoren darüber hinaus eine Rolle spielen.
- Die Analyse der Beziehung zwischen Intelligenz und Problemlösen anhand klassischer Studien
- Die Untersuchung verschiedener Ansätze und Modelle zur Erfassung der Problemlösefähigkeit
- Die Auseinandersetzung mit der Bedeutung von Faktoren wie kognitive Prozesse, Wissensstrukturen, Problemlösestrategien und persönlichkeitspsychologischen Variablen
- Die Diskussion von Forschungsbefunden und der aktuellen Debatte über die Rolle der Intelligenz im komplexen Problemlösen
- Der Vergleich verschiedener Testverfahren und die Suche nach geeigneten Methoden zur Messung von Problemlösefähigkeiten
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Forschungsstand und die Relevanz der Thematik beleuchtet. Kapitel 2 widmet sich der Arbeit von Dietrich Dörner und seinem „Lohhausen-Paradigma“, einem klassischen Modell für die Untersuchung des komplexen Problemlösens. Hier werden Ergebnisse und Interpretationen der Forschungsarbeiten vorgestellt. Kapitel 3 analysiert das „Schneiderwerkstattproblem“ (SWS) als weiteres Modell für die Untersuchung von Problemlösefähigkeiten. Die Ergebnisse verschiedener Studien mit dem SWS werden vorgestellt und diskutiert. Kapitel 4 befasst sich mit dem Konzept der „produktiven Intelligenz“ nach Rüppell und dem GIN & CHIPS-Modell. Dieses Modell beschreibt die Struktur und Prozesse der produktiven Intelligenz und stellt den DANTE-Test vor, der zur Messung dieser Fähigkeiten eingesetzt wird.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beleuchtet die Themenfelder Intelligenz und Problemlösen im Kontext komplexer Aufgaben und Situationen. Die Schlüsselbegriffe umfassen Konzepte wie Intelligenzquotient (IQ), Problemlösefähigkeiten, komplexes Problemlösen, kognitive Prozesse, Wissensstrukturen, Problemlösestrategien, produktive Intelligenz, GIN & CHIPS-Modell, DANTE-Test, Lohhausen-Paradigma und Schneiderwerkstattproblem (SWS). Die Arbeit analysiert Studien und Ergebnisse, um die Zusammenhänge zwischen diesen Konzepten zu verstehen und die Bedeutung der verschiedenen Faktoren für das erfolgreiche Problemlösen aufzuzeigen.
Häufig gestellte Fragen
Besteht ein Zusammenhang zwischen IQ und Problemlösefähigkeit?
Die Forschung zeigt überraschend niedrige Korrelationen zwischen klassischen IQ-Tests und der Fähigkeit, komplexe, computer-simulierte Probleme zu lösen.
Was ist das Lohhausen-Paradigma von Dietrich Dörner?
Es ist eine Computersimulation einer Kleinstadt, bei der Probanden als Bürgermeister agieren müssen. Dörner stellte hierbei fest, dass Intelligenztests den Erfolg in diesem Szenario kaum vorhersagen.
Was bedeutet „QI statt IQ“ nach Hermann Rüppell?
Das Konzept der „Qualitativen Informationsverarbeitung“ (QI) fokussiert auf produktive Intelligenz und erfinderisches Denken statt auf rein akademisches Testwissen.
Was ist der DANTE-Test?
Ein von Rüppell entwickelter Test zur Messung von Qualitäten des erfinderischen Denkens, wie Analogie-Empfänglichkeit und Strukturierungsflexibilität.
Warum versagen klassische IQ-Tests bei komplexen Problemen?
Komplexe Probleme erfordern fächerübergreifende Kompetenzen, den Umgang mit Unsicherheit und dynamische Strategien, die in statischen IQ-Tests oft nicht abgefragt werden.
- Citar trabajo
- Irena Wüsthoff (Autor), 2006, IQ als Fähigkeit zum Problemlösen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56028