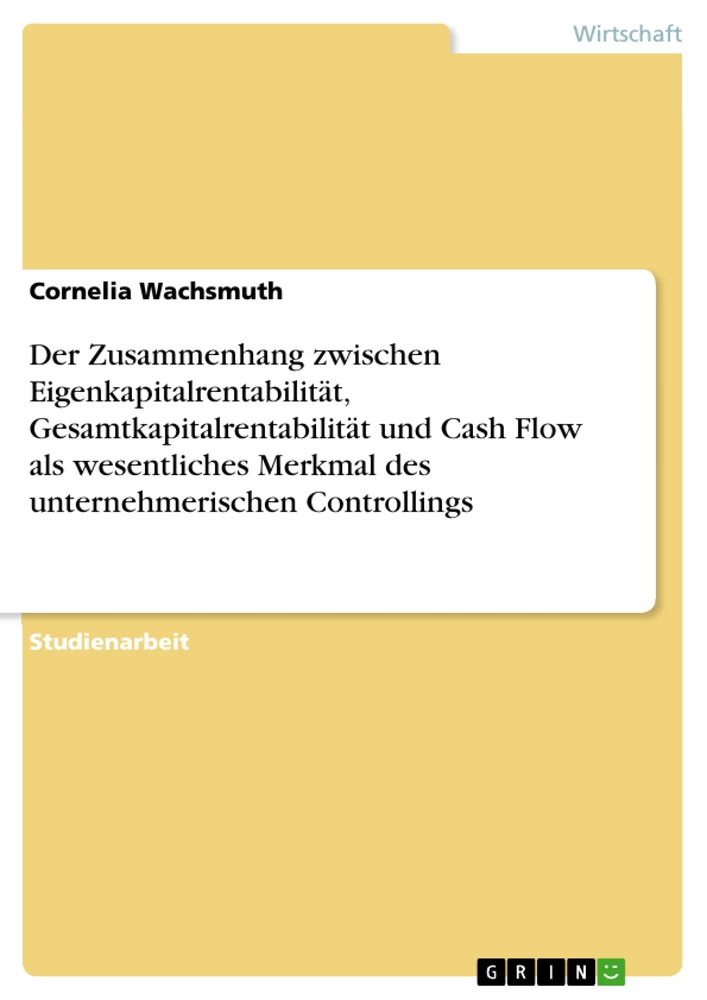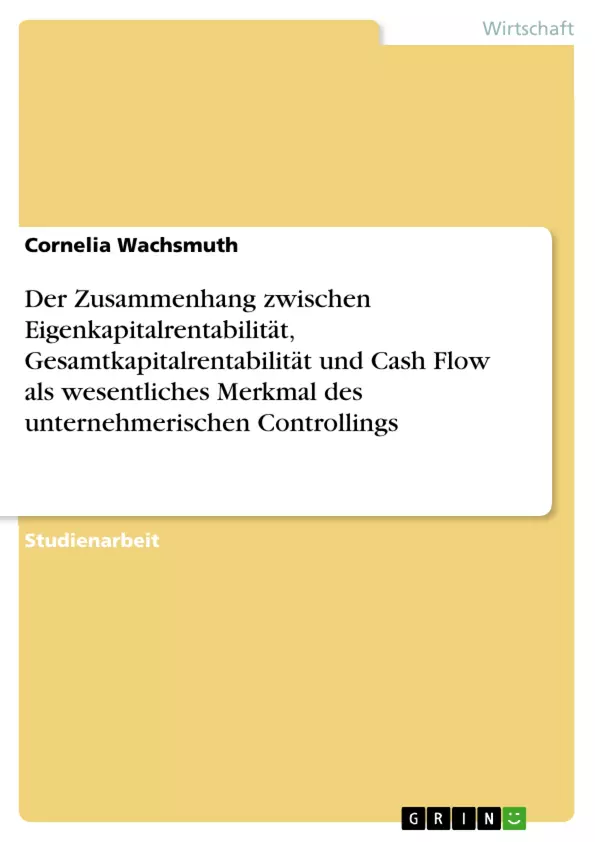Das Controlling ist ein Teilgebiet der Betriebswirtschaftslehre. Ein bedeutendes Instrument des Controllings sind die Kennzahlen. Die Eigenkapitalrentabilität, die Gesamtkapitalrentabilität und der Cash flow gehören zu den wichtigsten Kennzahlen.
Die Aufgabe dieser Arbeit ist es, den Zusammenhang zwischen Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität und Cash flow als wesentliches Merkmal des unternehmerischen Controllings zu erläutern.
Im Kapitel Zwei der Arbeit wird auf den Begriff des unternehmerischen Controllings und dessen Merkmale, insbesondere Aufgaben und Instrumente, eingegangen. Des Weiteren werden kurz die Ziele des Controllings erläutert.
Im Kapitel Drei wird erst der Begriff der Kennzahl allgemein erklärt und dann die Bedeutung der Kennzahlen für das Controlling herausgestellt. Im Kapitel 3.1. wird kurz die Rentabilität erläutert und im Folgenden wird auf die Eigenkapital- und die Gesamtkapitalrentabilität näher eingegangen. Im Kapitel 3.2. wird der Cash flow beschrieben.
Zum Schluss wird die Bedeutung dieser Kennzahlen für das unternehmerische Controlling genannt und somit eine Schlussbemerkung gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Unternehmerisches Controlling
- Begriff und Merkmale
- Ziele
- Rentabilität
- Eigenkapitalrentabilität (EKR)
- Gesamtkapitalrentabilität (GKR)
- Cash Flow (CF)
- Schlussbemerkung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Erläuterung des Zusammenhangs zwischen Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität und Cash Flow im Kontext des unternehmerischen Controllings. Sie analysiert, wie diese Kennzahlen als wesentliche Merkmale des Controllings fungieren und welche Bedeutung sie für die Entscheidungsfindung in Unternehmen besitzen.
- Begriff und Merkmale des unternehmerischen Controllings
- Ziele des Controllings
- Eigenkapitalrentabilität als Kennzahl
- Gesamtkapitalrentabilität als Kennzahl
- Cash Flow als Kennzahl
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik des Controllings ein. Es werden grundlegende Definitionen und Merkmale des unternehmerischen Controllings erläutert, sowie die wichtigsten Ziele dieses Bereichs.
Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Rentabilität allgemein erklärt und darauf aufbauend die Bedeutung der Eigenkapitalrentabilität und der Gesamtkapitalrentabilität für das Controlling herausgestellt.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Cash Flow als einer weiteren wichtigen Kennzahl im unternehmerischen Controlling. Es werden die wichtigsten Eigenschaften und Funktionen dieser Kennzahl erläutert.
Schlüsselwörter
Unternehmerisches Controlling, Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität, Cash Flow, Kennzahlen, Planung, Kontrolle, Steuerung, Entscheidungsfindung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist Eigenkapitalrentabilität?
Sie gibt an, wie hoch sich das vom Eigentümer investierte Kapital innerhalb einer Periode verzinst hat.
Wie unterscheidet sich die Gesamtkapitalrentabilität davon?
Die Gesamtkapitalrentabilität misst die Verzinsung des gesamten im Unternehmen eingesetzten Kapitals (Eigen- und Fremdkapital).
Was sagt der Cash Flow über ein Unternehmen aus?
Der Cash Flow bildet den tatsächlichen Zu- oder Abfluss liquider Mittel ab und zeigt somit die finanzielle Selbstfinanzierungskraft eines Unternehmens.
Warum sind diese Kennzahlen für das Controlling wichtig?
Sie dienen als Steuerungs- und Kontrollinstrumente, um die Wirtschaftlichkeit und Liquidität des Unternehmens zu überwachen und Entscheidungen vorzubereiten.
Gibt es einen Zusammenhang zwischen Rentabilität und Cash Flow?
Ja, ein Unternehmen kann profitabel sein (hohe Rentabilität), aber dennoch Liquiditätsprobleme haben (niedriger Cash Flow), weshalb beide Kennzahlen gemeinsam betrachtet werden müssen.
- Citation du texte
- Cornelia Wachsmuth (Auteur), 2006, Der Zusammenhang zwischen Eigenkapitalrentabilität, Gesamtkapitalrentabilität und Cash Flow als wesentliches Merkmal des unternehmerischen Controllings, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56197