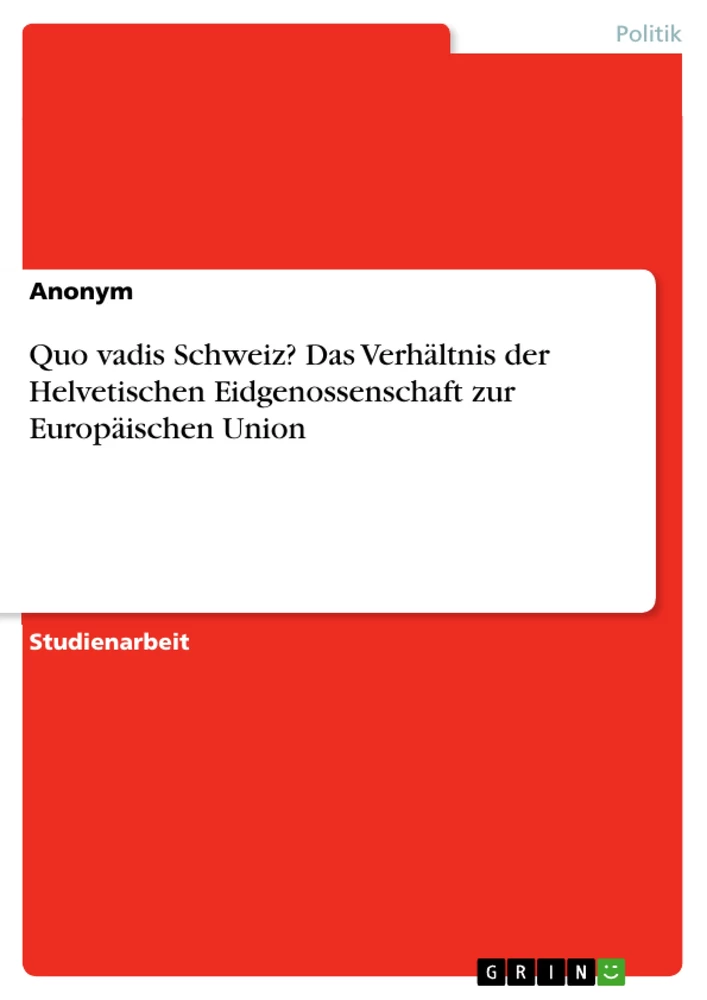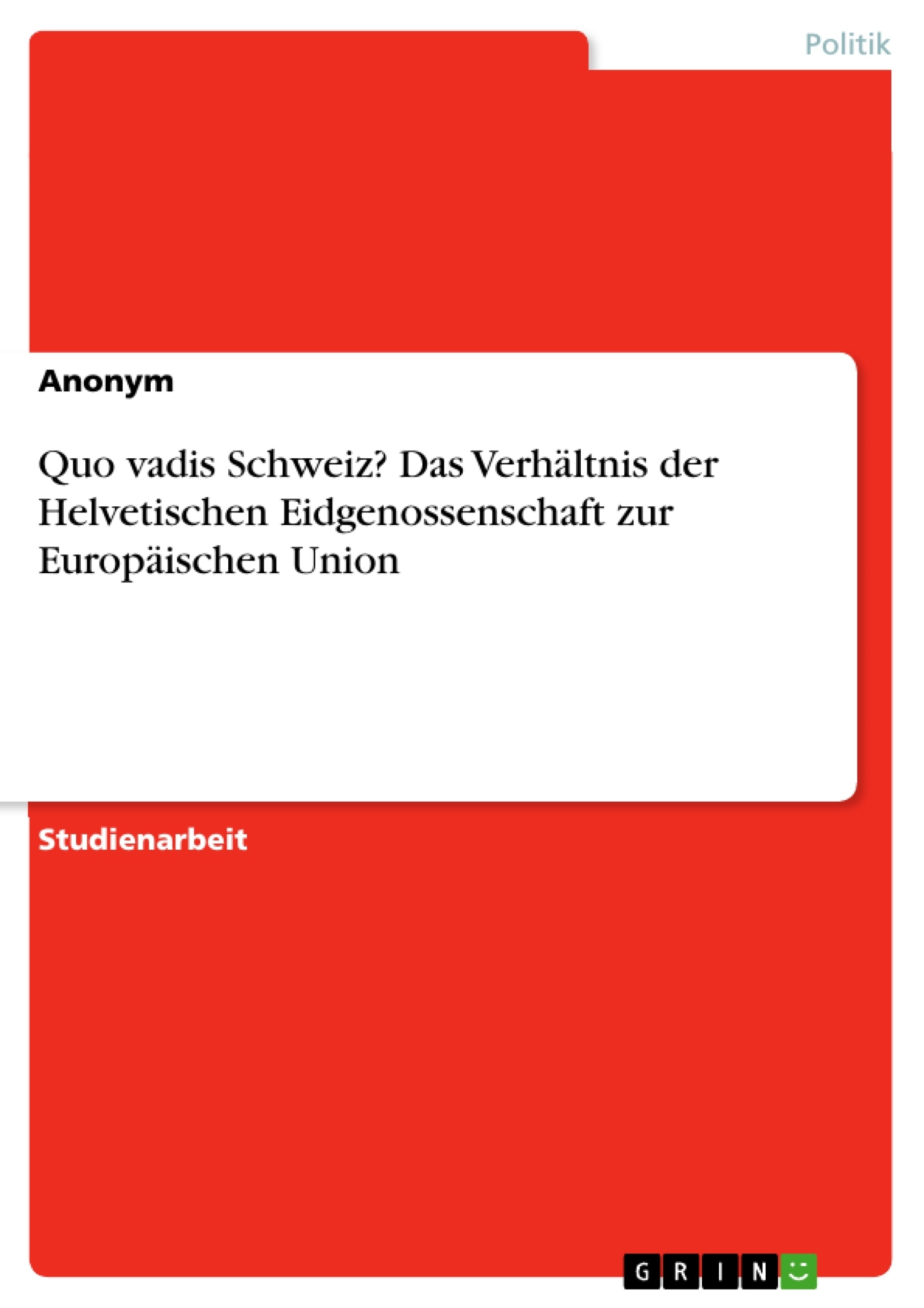„Der Bundesrat verfolgt die Entwicklungen in der EU mit grosser Aufmerksamkeit und analysiert kontinuierlich den sich daraus ergebenden Handlungsbedarf.“
Betrachtet man die auf einer politischen Karte dargestellte Europäische Union (EU) in ihrer Ausbreitung, so ist eines auf Anhieb auffällig: In ihrer Mitte, im Zentrum Europas, ist ein weißer Fleck zu finden, der offensichtlich isoliert von einer einheitlichen Farbe umgeben scheint. Sogleich entpuppt sich dieser Fleck als die Helvetische Eidgenossenschaft oder viel gebräuchlicher Schweiz genannt. Dabei ist diese Erkenntnis gleichsam so überraschend wie einsichtig. Überraschend, da man es als selbstverständlich ansehen könnte, dass ein so wohlhabendes und wirtschaftlich starkes Land der EU angehört. Warum auch nicht? Schließlich gehören alle anderen westlichen Staaten, so würde der Eindruck sein, doch auch zu dieser Europa umfassend prägenden Organisation. Dagegen einsichtig, weil dieses Staatsgebilde Schweiz schon immer eine Sonderrolle einnahm, sich in seinem politischen Engagement stets zurückhielt und schon immer sein „eigenes Süppchen zu kochen“ schien. Und es ist genau dieser Widerspruch, der die reale Situation und Stellung der Schweiz in Europa wiedergibt. Es ist die außenpolitische Asymmetrie, die sich einerseits in der wirtschaftlichen Eingebundenheit der Schweiz in das Weltmarktsystem und andererseits in ihrem Abseitsstehen auf internationaler politischer Ebene zeigt. Das starke Interesse an einem liberalen Wirtschaftssystem und die damit verbundene Partizipation an vielen wirtschaftlichen Organisationen wie der WTO oder OECD steht der umso mehr politischen Zurückhaltung und geringen Einbindung in politischen Bündnissen entgegen. Während die Schweiz wirtschaftlich gesehen alles andere als ein Kleinstaat ist und zu den wettbewerbsfähigsten Ländern der Welt gehört, wirkt ihre Außenpolitik, wohlbemerkt nicht ihre Außenwirtschaftspolitik, anachronistisch und stark isolationistisch. Dies wird insbesondere in Hinblick auf die Beziehung zur EU deutlich. So ist die Schweiz, von Norwegen einmal abgesehen, das einzige Land, das sich der europäischen Integration bis heute verwehrt und das, obwohl sich der Kontinent mit der letzten Erweiterungsrunde um zehn neue Mitglieder mehr denn je zu einem „EUropa“ entwickelt hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung: Die Schweiz in „EUropa“
- 2. Politisches System und politische Kultur
- 2.1 Aspekte des politisches System
- 2.2 Politische Kultur
- 3. Die jüngere Vergangenheit der schweizerisch-europäischen Beziehungen
- 3.1 Die Entwicklungen bis 1992
- 3.2 Die Ereignisse des Jahres 1992 und ihre Konsequenzen
- 3.3 Der Weg bilateraler Verhandlungen
- 4. Ein EU-Beitritt und die Auswirkungen
- 4.1 Der Föderalismus
- 4.2 Die direktdemokratischen Rechte
- 4.3 Die Neutralität
- 5. Gegner und Befürworter eines Beitritts
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis der Schweiz zur Europäischen Union (EU) in der jüngeren Vergangenheit und beleuchtet die Debatte um einen möglichen EU-Beitritt. Sie analysiert die politischen und kulturellen Besonderheiten der Schweiz, die diese Debatte prägen, und untersucht die Auswirkungen, die ein EU-Beitritt auf das Schweizer Politiksystem hätte.
- Die politische Kultur und das Selbstverständnis der Schweiz
- Die Auswirkungen eines EU-Beitritts auf den Schweizer Föderalismus
- Die Rolle der direktdemokratischen Rechte in der EU-Debatte
- Die Bedeutung der Neutralität für die Schweiz
- Die Argumente von Gegnern und Befürwortern eines EU-Beitritts
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die besondere Situation der Schweiz in Europa dar und beschreibt das Spannungsverhältnis zwischen wirtschaftlicher Einbindung und politischer Zurückhaltung.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel analysiert das politische System und die politische Kultur der Schweiz. Es beleuchtet Aspekte des politischen Systems und die Bedeutung traditioneller Werte in der schweizerischen Gesellschaft.
- Kapitel 3: Dieses Kapitel beleuchtet die jüngere Vergangenheit der schweizerisch-europäischen Beziehungen. Es untersucht die Entwicklungen bis 1992, die Ereignisse von 1992 und die anschließende Entwicklung hin zu bilateralen Verhandlungen.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel untersucht die Auswirkungen, die ein EU-Beitritt auf die Schweiz hätte. Es analysiert die Folgen für den Föderalismus, die direktdemokratischen Rechte und die Neutralität des Landes.
- Kapitel 5: Dieses Kapitel stellt die Argumente von Gegnern und Befürwortern eines EU-Beitritts gegenüber.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Arbeit sind: Schweiz, Europäische Union, EU-Beitritt, politische Kultur, Föderalismus, direktdemokratische Rechte, Neutralität, Globalisierung, Interdependenz, Selbstverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Schweiz kein Mitglied der Europäischen Union?
Dies liegt an einer Mischung aus politischer Kultur, dem Wunsch nach Neutralität und der Sorge um den Verlust direktdemokratischer Rechte.
Was sind die "bilateralen Verträge" zwischen der Schweiz und der EU?
Da die Schweiz nicht der EU beitritt, regelt sie ihr Verhältnis durch bilaterale Abkommen, die eine wirtschaftliche Integration ohne volle politische Mitgliedschaft ermöglichen.
Welchen Einfluss hätte ein EU-Beitritt auf die direkte Demokratie?
Kritiker befürchten, dass Volksabstimmungen durch übergeordnetes EU-Recht ausgehebelt werden könnten, was den Kern des Schweizer politischen Systems berühren würde.
Wie steht es um die Neutralität der Schweiz im Falle eines Beitritts?
Die Neutralität ist ein zentraler Pfeiler der Schweizer Außenpolitik. Ein EU-Beitritt wird oft als unvereinbar mit einer strikten neutralen Haltung angesehen.
Was geschah bei der EWR-Abstimmung 1992?
Das Schweizer Volk lehnte den Beitritt zum Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) knapp ab, was den Weg für den heutigen bilateralen Sonderweg ebnete.
- Quote paper
- Anonym (Author), 2005, Quo vadis Schweiz? Das Verhältnis der Helvetischen Eidgenossenschaft zur Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56383