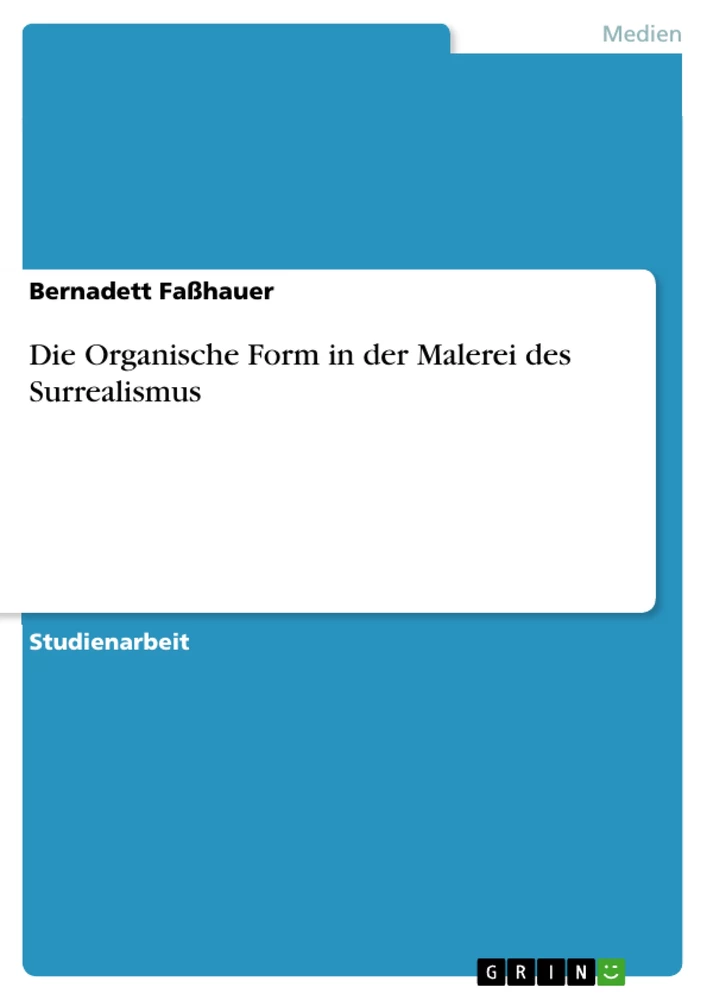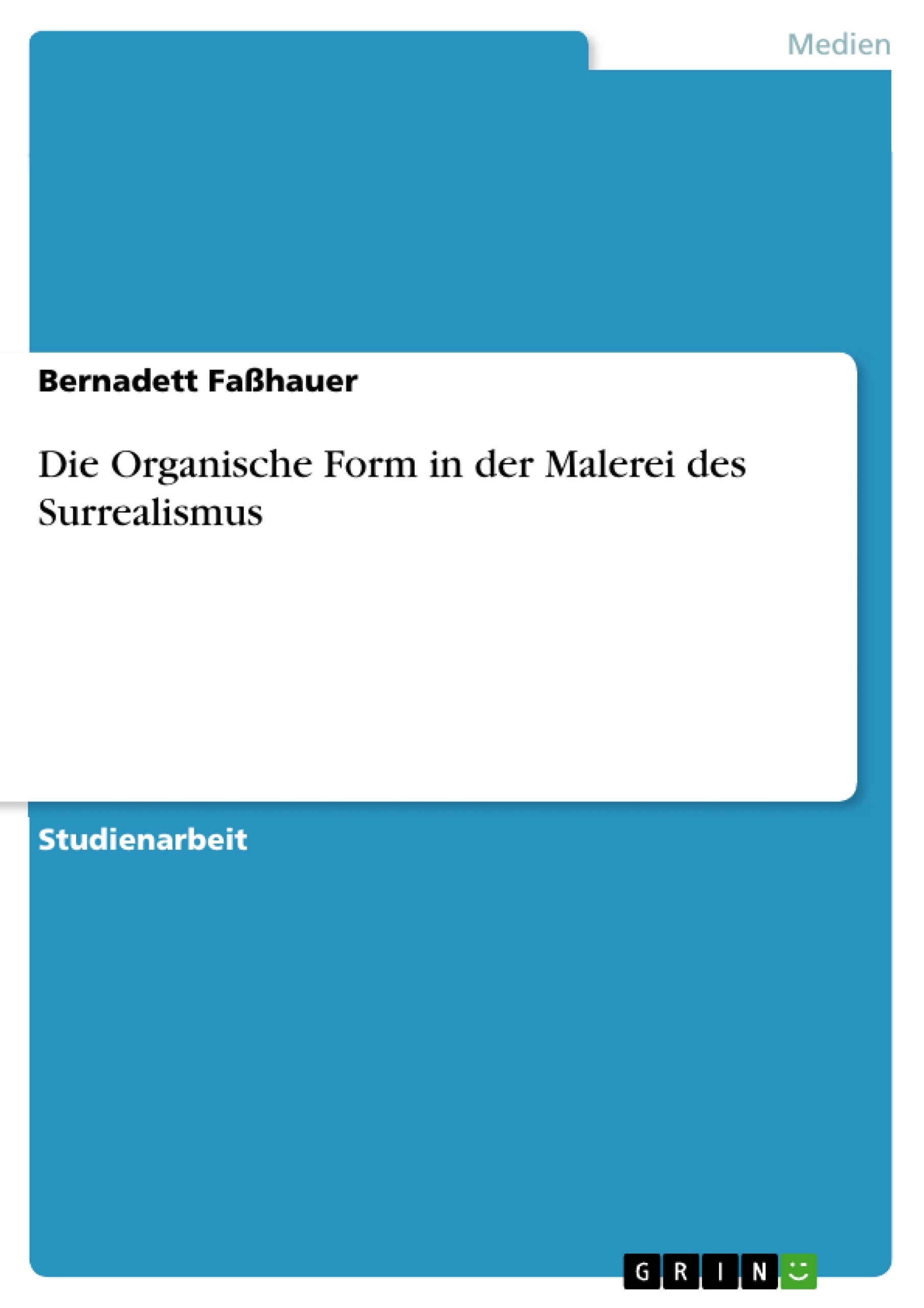„Ich glaube an die künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sagen kann: Surrealität.“ [André Breton, 1977 : S. 18] So formulierte André Breton im Manifest des Surrealismus von 1924 seine Vision von einer neuen literarischen und künstlerischen Bewegung und ihrem programmatischen Inhalt. Unter Berufung auf die Lehren Sigmund Freuds entdeckten die Surrealisten die Tiefen des Unterbewusstseins, den Traum, die Sexualität und den Rausch als Quellen der künstlerischen Eingebung. Die Methode des Automatismus wurde zu einer der wichtigsten surrealistischen Grundlagen, um den Ausschluss jeder Kontrolle des Willens und des Verstandes beim kreativen Schaffen zu erreichen. In der surrealistischen Malerei traten Künstler wie Max Ernst, René Magritte, Joan Miró und Salvador Dalí hervor, die, basierend auf dem Surrealismus, ganz unterschiedliche Werke schufen.
Seit Anfang des 20. Jahrhunderts entwickelte sich ein plastischer Stil, dessen schwellende und fließende Formen im Gegensatz zur verbreiteten technizistischen Formensprache verschiedener Kunstrichtungen stand. Die Organische Form wurde nicht zu einem kurzlebigen künstlerischen Phänomen, sie wurde von den verschiedensten Kunstrichtungen aufgegriffen, weiterentwickelt und findet ihre volle Entfaltung in den zwanziger Jahren des 20. Jahrhunderts, insbesondere in den Werken der Bildhauer Henry Moore und Hans Arp.
Die folgende Arbeit soll zeigen, dass auch in der Malerei des Surrealismus Formen auftauchen, die als organisch bezeichnet werden können.
Im zweiten Kapitel werde ich zunächst auf den Surrealismus eingehen. Im Vordergrund steht dabei zum einen die Entwicklung des Begriffs „Surrealismus“, von seinem ersten Auftauchen bis zu seiner endgültigen Definition durch Breton, und zum anderen ein geschichtlicher Abriss, der die Entwicklung der künstlerischen Bewegung von ihren theoretischen Prämissen bis hin zu ihrem scheinbaren Ende, dem Tode Bretons, verfolgt. Die Organische Form, ihre Entwicklung, Beschreibung und Definition bilden den Inhalt des dritten Kapitels. Auf dieser Grundlage soll im Folgenden analysiert werden, wie sich organische Formen in den Werken surrealistischer Künstler niederschlagen, wo sie ihren Ursprung haben und mit welchen möglichen Konnotationen sie in Verbindung stehen. Beispielhaft werden mehrere Werke der Künstler Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dalí und Pablo Picasso untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Surrealismus
- 2.1. Das Wort „Surrealismus“
- 2.2. Zur Geschichte der surrealistischen Bewegung
- 3. Die Organische Form
- 4. Organische Formen in der Malerei des Surrealismus
- 4.1. Joan Miró
- 4.2. Yves Tanguy
- 4.3. Salvador Dalí
- 4.4. Pablo Picasso
- 5. Abschließende Betrachtungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Auftreten organischer Formen in der Malerei des Surrealismus. Das Hauptziel ist es, aufzuzeigen, wie sich diese Formen in den Werken surrealistischer Künstler manifestieren, woher sie ihren Ursprung nehmen und welche möglichen Bedeutungen und Konnotationen ihnen zugeschrieben werden können.
- Entwicklung des Begriffs „Surrealismus“
- Geschichte der surrealistischen Bewegung
- Definition und Beschreibung der organischen Form
- Analyse organischer Formen in der surrealistischen Malerei
- Untersuchung ausgewählter Künstler (Miró, Tanguy, Dalí, Picasso)
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt die Forschungsfrage nach dem Auftreten organischer Formen in der surrealistischen Malerei. Sie beschreibt den Gegensatz zwischen organischer und technizistischer Formensprache im frühen 20. Jahrhundert und benennt die im weiteren Verlauf zu analysierenden Künstler. Die Arbeit skizziert den Aufbau und die Vorgehensweise der Untersuchung, die den Surrealismus, die organische Form und deren Manifestation in der Malerei ausgewählter Künstler umfasst.
2. Der Surrealismus: Dieses Kapitel beleuchtet den Surrealismus, beginnend mit der Entwicklung des Begriffs „Surrealismus“ selbst. Es wird die Erstverwendung durch Apollinaire und die spätere Definition durch Breton untersucht, inklusive der philosophischen und literarischen Aspekte. Des Weiteren wird ein historischer Überblick über die Bewegung gegeben, von ihren theoretischen Grundlagen bis hin zum Einfluss von Freud und dem automatischen Schreiben. Die Rolle von Schlüsselfiguren wie Breton und Apollinaire und der Einfluss wichtiger literarischer Vorbilder wird diskutiert.
3. Die Organische Form: Dieses Kapitel widmet sich der Definition und Beschreibung der organischen Form als Gegenpol zur technizistischen Ästhetik des frühen 20. Jahrhunderts. Es beleuchtet die Entwicklung und Verbreitung dieses Stils in verschiedenen Kunstrichtungen und verortet ihn innerhalb des historischen Kontextes der Kunstgeschichte. Die Kapitel untersucht die charakteristischen Merkmale organischer Formen in der Bildhauerei und legt so den Grundstein für die Analyse dieser Formen in der surrealistischen Malerei.
4. Organische Formen in der Malerei des Surrealismus: Dieses Kapitel analysiert die Verwendung organischer Formen in der Malerei von Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dalí und Pablo Picasso. Es untersucht die jeweiligen künstlerischen Herangehensweisen und die spezifische Interpretation des Konzepts der organischen Form durch jeden Künstler. Dabei werden ausgewählte Werke detailliert analysiert und die Bedeutung der organischen Formen im Kontext der surrealistischen Ästhetik erörtert, unter Berücksichtigung der individuellen künstlerischen Stile und der jeweiligen kontextuellen Hintergründe.
Schlüsselwörter
Surrealismus, organische Form, Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dalí, Pablo Picasso, Automatismus, Unterbewusstsein, Traum, technizistische Formensprache, Kunstgeschichte 20. Jahrhundert, André Breton, Guillaume Apollinaire.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Text "Organische Formen in der Malerei des Surrealismus"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht das Auftreten organischer Formen in der Malerei des Surrealismus. Sie analysiert, wie diese Formen in den Werken surrealistischer Künstler dargestellt werden, woher sie stammen und welche Bedeutung ihnen zugeschrieben werden kann.
Welche Künstler werden untersucht?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse organischer Formen bei vier wichtigen Surrealisten: Joan Miró, Yves Tanguy, Salvador Dalí und Pablo Picasso.
Welche Themen werden im Text behandelt?
Der Text behandelt die Entwicklung des Surrealismus, die Definition und Beschreibung organischer Formen im Gegensatz zu technizistischen Formen, sowie eine detaillierte Analyse der Verwendung organischer Formen in den Werken der genannten Künstler. Dabei werden historische und philosophische Aspekte des Surrealismus berücksichtigt, inklusive des Einflusses von Freud und dem automatischen Schreiben.
Wie ist der Text aufgebaut?
Der Text ist in fünf Kapitel gegliedert: Einleitung, Der Surrealismus, Die Organische Form, Organische Formen in der Malerei des Surrealismus und Abschließende Betrachtungen. Jedes Kapitel behandelt einen spezifischen Aspekt des Themas, beginnend mit einer Einführung in den Surrealismus und organische Formen, gefolgt von der detaillierten Analyse der Künstler und abschließenden Betrachtungen.
Was sind die Schlüsselbegriffe dieser Arbeit?
Die wichtigsten Schlüsselbegriffe sind Surrealismus, organische Form, die Namen der untersuchten Künstler (Miró, Tanguy, Dalí, Picasso), Automatismus, Unterbewusstsein, Traum, technizistische Formensprache, und die Namen wichtiger Figuren der Surrealismusbewegung wie André Breton und Guillaume Apollinaire.
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel der Arbeit ist es, aufzuzeigen, wie sich organische Formen in der surrealistischen Malerei manifestieren und welche Bedeutung und Konnotationen ihnen zugeschrieben werden können. Die Arbeit beleuchtet den Kontext der Entwicklung des Surrealismus und die charakteristischen Merkmale organischer Formen in der Kunst.
Gibt es eine Zusammenfassung der einzelnen Kapitel?
Ja, der Text enthält eine detaillierte Zusammenfassung jedes Kapitels, die den Inhalt und die Schwerpunkte jedes Abschnitts kurz beschreibt. Diese Zusammenfassungen geben einen Überblick über die behandelten Themen und den Verlauf der Argumentation.
Welchen historischen Kontext betrachtet die Arbeit?
Die Arbeit betrachtet den historischen Kontext des frühen 20. Jahrhunderts, in dem sich der Surrealismus entwickelte und in dem der Gegensatz zwischen organischer und technizistischer Formensprache eine wichtige Rolle spielte. Der Einfluss von Freud und die Entwicklung des automatischen Schreibens werden ebenfalls im historischen Kontext betrachtet.
- Citation du texte
- Bernadett Faßhauer (Auteur), 2005, Die Organische Form in der Malerei des Surrealismus, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56453