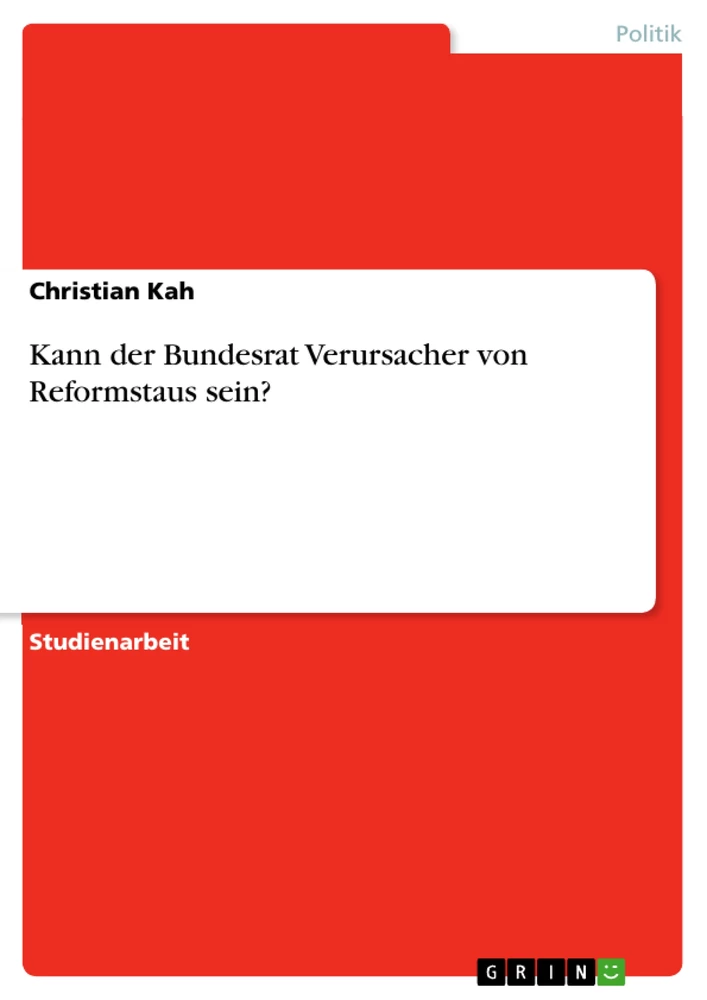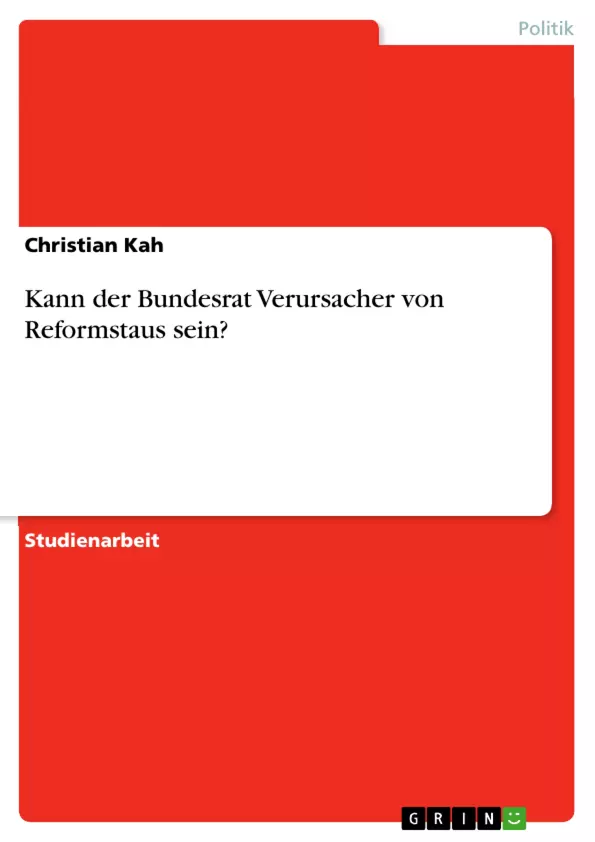Auf der Insel Helgoland schrieb der Literaturprofessor August Heinrich Hoffmann von Fallersleben im Jahre 1841 das „Lied der Deutschen“, dessen dritte Strophe mit dem Wahlspruch „Einigkeit und Recht und Freiheit“, beginnt. Er zielte mit seinem Text auf die seinerzeit als Utopie anmutende Einheit einer deutschen Nation ab. Zu diesem Zeitpunkt bestand das Gebiet in dem weitgehend deutsch gesprochen wurde aus 39 Einzelstaaten. In den späteren Jahren sollte diese Hymne als Symbol deutscher Einheit zum Zweck eines gemeinsamen Nationalstaates dienen. Durch den späteren Zusammenschluss deutscher Kleinstaaten, entstand somit ein gemeinsamer Bundesstaat föderaler Prägung. Dies ist nicht zuletzt der Grund, weshalb die heutige Bundesrepublik Deutschland (BRD) als eines ihrer fünf Verfassungsorgane neben Bundestag, Bundesregierung, Bundesverfassungsgericht und Bundespräsidenten über ein weltweit einzigartiges ständiges Organ - den Bundesrat verfügt (vgl. Stüwe 2004: 25, Sturm 2001: 55). Hierbei wird im Bundesstaat den 16 Gliedstaaten (vgl. Bundesrat 2005: o. S.), welche die nahezu 82,5 Mio. Einwohner (vgl. Harenberg 2004: 494) repräsentieren, die Möglichkeit eingeräumt an der Willensbildung des Bundes mitzuwirken (vgl. König 1999: 24). Oftmals wurde in der Vergangenheit die Zweckmäßigkeit des Bundesrates kritisiert oder gar in Frage gestellt. Im Wesentlichen steht in Zentrum der Kritik der durch Blockadepolitik verursachte sog. Reformstau, welcher bei unterschiedlichen Mehrheitsverhältnissen zwischen Opposition und Regierung in Bundesrat und Bundestag möglich wird (vgl. Kilper und Lhotta 1996: 112). Nicht zuletzt deshalb und wegen seiner Einzigartigkeit (vgl. Kielmannsegg 1989: 43) steht dieses bundesdeutsche Verfassungsorgan unter dem Fokus des ständigen
politikwissenschaftlichen Interesses. Um ein Verständnis für die Problemsituation des Reformstaus erlangen zu können, sollen vorab die formalen Strukturen, Kompetenzen und Zuständigkeiten dieses Verfassungsorgans beschrieben werden. Weiterhin ist es Aufgabe die formal gegebenen Ursachen für eine Blockadepolitik, die in einen Reformstau münden kann, zu erörtern. Hierzu soll auf die Materie der Mitwirkung der Gesetzgebung sowie die Kompetenten bei Zustimmungs- und Einspruchsgesetzen mit dem Instrument des Vermittlungsausschusses eingegangen werden. Ob der Bundesrat tatsächlich die Möglichkeit besitzt einen Reformstau auszulösen und von diesem Mittel Gebrauch macht, steht hierbei im Zentrum der Erkenntnisfindung.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Strukturen und Kompetenzen
- Vollversammlung
- Mitglieder des Bundesrates
- Gesetzgebung
- Mitwirkung bei der Gesetzgebung
- Ausschließliche Gesetzgebung
- Konkurrierenden Gesetzgebung
- Rahmengesetzgebungskompetenz
- Zustimmungsbedürftige Gesetze
- Einspruchgesetze
- Vermittlungsausschuss
- Besetzung
- Einberufungsmöglichkeiten
- Funktion
- Zustimmungspflichtige Gesetze versus Einspruchsgesetze
- Blockadepolitik
- Blockade aus landespolitischen Interessen
- Blockade aus parteipolitischen Interessen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Rolle des Bundesrates im politischen System der Bundesrepublik Deutschland. Insbesondere wird untersucht, ob der Bundesrat durch Blockadepolitik zu einem Reformstau beitragen kann.
- Strukturen und Kompetenzen des Bundesrates
- Gesetzgebungsverfahren und die Rolle des Bundesrates
- Möglichkeiten und Formen der Blockadepolitik des Bundesrates
- Auswirkungen von Blockadepolitik auf den Reformprozess
- Die Bedeutung des Bundesrates als ständiges Verfassungsorgan
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik des Bundesrates und der Frage des Reformstaus ein. Sie beleuchtet die historische Entwicklung des Bundesrates und die Kritik an seiner Rolle im politischen System.
Kapitel 2 befasst sich mit den Strukturen und Kompetenzen des Bundesrates. Es erläutert die Zusammensetzung des Bundesrates, die Mitgliedschaft und die Verfahrensweisen innerhalb dieses Organs.
Kapitel 3 behandelt die Gesetzgebungskompetenzen des Bundesrates. Es werden verschiedene Formen der Mitwirkung bei der Gesetzgebung, die Unterscheidung zwischen Einspruchs- und Zustimmungsgesetzen sowie die Funktion des Vermittlungsausschusses beleuchtet.
Kapitel 4 untersucht die Möglichkeiten und Formen der Blockadepolitik des Bundesrates. Es werden die Motive für Blockaden aus landespolitischen und parteipolitischen Interessen analysiert.
Schlüsselwörter
Bundesrat, Bundesrepublik Deutschland, Gesetzgebung, Reformstau, Blockadepolitik, Vermittlungsausschuss, Ständisches Organ, Föderalismus, Landespolitik, Parteipolitik, Interessenvertretung, Verfassungsorgan.
Häufig gestellte Fragen
Kann der Bundesrat Reformen blockieren?
Ja, bei zustimmungsbedürftigen Gesetzen kann der Bundesrat ein Veto einlegen, was bei unterschiedlichen Mehrheiten in Bundestag und Bundesrat oft zu einem Reformstau führt.
Was ist der Vermittlungsausschuss?
Der Vermittlungsausschuss ist ein Gremium aus Mitgliedern des Bundestages und des Bundesrates, das bei Uneinigkeiten im Gesetzgebungsverfahren einen Kompromiss finden soll.
Was unterscheidet Einspruchsgesetze von Zustimmungsgesetzen?
Bei Einspruchsgesetzen kann der Bundestag den Bundesrat überstimmen, während bei Zustimmungsgesetzen (z.B. bei Finanzen der Länder) das Gesetz ohne den Bundesrat nicht zustande kommen kann.
Warum wird der Bundesrat oft parteipolitisch genutzt?
Da die Landesregierungen oft von den Oppositionsparteien des Bundes geführt werden, dient der Bundesrat häufig als Machtinstrument, um die Bundesregierung zur Kooperation zu zwingen.
Wer sind die Mitglieder des Bundesrates?
Der Bundesrat besteht aus Mitgliedern der Landesregierungen (Ministerpräsidenten und Minister), nicht aus gewählten Abgeordneten.
- Arbeit zitieren
- Christian Kah (Autor:in), 2005, Kann der Bundesrat Verursacher von Reformstaus sein?, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56519