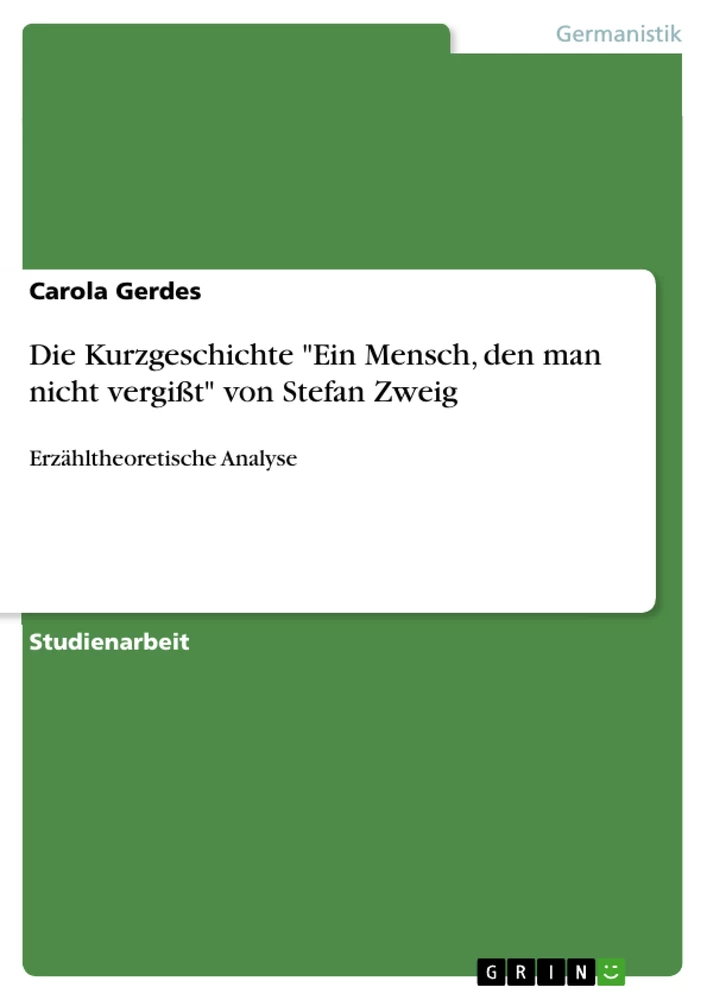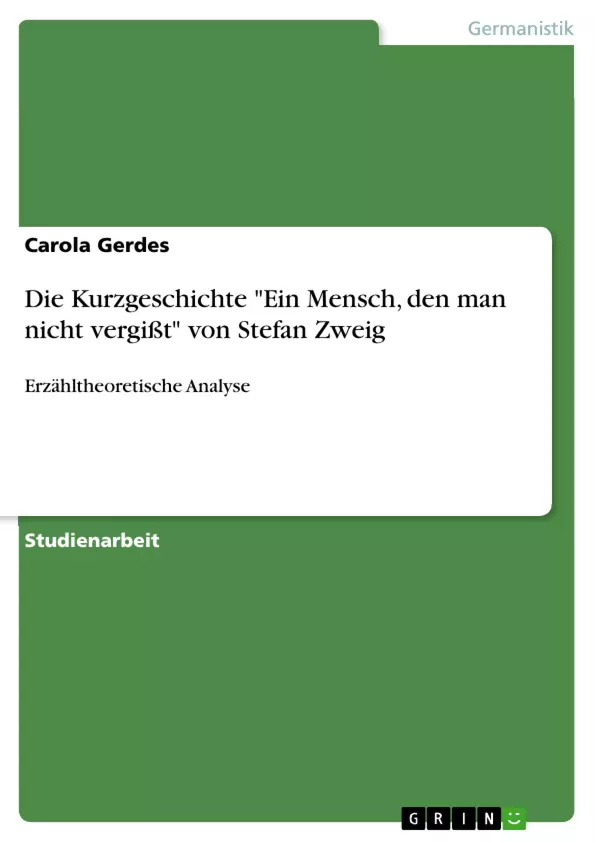In dieser Hausarbeit werde ich eine Kurzgeschichte nach erzähltheoretischen Aspekten analysieren und so versuchen mehr über die Geschichte zu erfahren, als es nur durch oberflächliches Lesen möglich ist. Als Grundlage für diese erzähltheoretische Analyse stütze ich mich auf die schon im Seminar genutzte Literatur „Einführung in die Erzähltheorie“ von Martinez und Scheffel. Bei der von mir ausgewählten Kurzgeschichte handelt es sich um die Erzählung „Ein Mensch, den man nicht vergißt“ von Stefan Zweig, die in einem Sammelband mit seinen Erzählungen mit dem Titel „Brennendes Geheimnis“ erschienen ist.
Meine Wahl fiel auf diese Erzählung, weil ich im Allgemeinen die Erzählungen von Stefan Zweig sehr interessant finde, und weil gerade diese Kurzgeschichte vom Inhalt her sehr schön und gut zu lesen ist. Zudem handelt es sich um eine relativ kompakte Erzählung, die mir für den Zweck einer solchen Analyse gut geeignet erscheint. Wie bereits aus dem Inhalt ersichtlich ist, habe ich die einzelnen Aspekte gemäß Martinez und Scheffel in eben der Reihenfolge analysiert, wie sie auch in dem Buch zu finden ist. Einige Punkte auslassend habe ich mich auf die mir für diese Erzählung interessant erscheinenden Punkte konzentriert. Angefangen mit der Analyse unter dem Aspekt der Zeit und den dazugehörigen Fragen nach der Ordnung, der Dauer und der Frequenz dieser Kurzgeschichte, habe ich mich dann mit der näheren Analyse unter dem Aspekt Stimme befasst.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Analyse der Kurzgeschichte unter dem Aspekt der Zeit
- Ordnung
- Dauer
- Frequenz
- Stimme
- Zeitpunkt des Erzählens
- Ort des Erzählens
- Stellung des Erzählers zum Geschehen
- Schlusswort
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit analysiert Stefan Zweigs Kurzgeschichte "Ein Mensch, den man nicht vergißt" unter Anwendung erzähltheoretischer Prinzipien. Ziel ist es, die Geschichte jenseits oberflächlicher Lektüre zu erforschen und ihre erzählerischen Besonderheiten zu beleuchten.
- Analyse der Zeitstruktur: Untersuchung von Ordnung, Dauer und Frequenz in der Erzählung.
- Die Stimme des Erzählers: Analyse des Zeitpunkts und Orts des Erzählens sowie der Beziehung des Erzählers zum Geschehen.
- Erzähltechniken: Fokus auf die Verwendung von Analepsen, d.h. Rückblenden, und ihre Rolle in der Konstruktion der Geschichte.
- Die Bedeutung des Lernens: Untersuchung der Botschaft der Geschichte über die Macht des Geldes und die Wichtigkeit der Lebenskunst.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Analyse der Kurzgeschichte "Ein Mensch, den man nicht vergißt" ein und erklärt die methodischen Grundlagen. Der Fokus liegt auf der erzähltheoretischen Analyse, die auf der Literatur "Einführung in die Erzähltheorie" von Martinez und Scheffel basiert.
Im zweiten Kapitel werden verschiedene Aspekte der Zeitstruktur untersucht. Genettes Konzepte von Ordnung, Dauer und Frequenz werden auf die Geschichte angewandt, um die Darstellung der Zeit in der Erzählung zu beleuchten. Insbesondere wird die Verwendung von Analepsen, d.h. Rückblenden, analysiert.
Schlüsselwörter
Erzähltheorie, Kurzgeschichte, Stefan Zweig, Zeitstruktur, Ordnung, Dauer, Frequenz, Analepsen, Rückblenden, Stimme, Erzähler, Lernprozess, Lebenskunst, Geldmacht.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es in Zweigs Erzählung 'Ein Mensch, den man nicht vergißt'?
Die Kurzgeschichte thematisiert eine Begegnung, die tiefe Einsichten über die Macht des Geldes und die Kunst des Lebens vermittelt. Sie ist Teil des Sammelbands 'Brennendes Geheimnis'.
Welche erzähltheoretischen Aspekte werden analysiert?
Die Analyse stützt sich auf Martinez und Scheffel und untersucht insbesondere die Zeitstruktur (Ordnung, Dauer, Frequenz) sowie die Erzählstimme.
Was ist eine Analepse in dieser Kurzgeschichte?
Eine Analepse ist eine Rückblende. Zweig nutzt sie, um vergangene Ereignisse in die aktuelle Handlung einzuflechten und so die Charakterentwicklung zu vertiefen.
Wie wird die Zeitstruktur bei Stefan Zweig dargestellt?
Die Arbeit untersucht, wie Zweig durch Dehnung oder Raffung der Erzählzeit die Aufmerksamkeit des Lesers steuert und emotionale Schwerpunkte setzt.
Welche Rolle spielt der Erzähler in der Geschichte?
Die Analyse betrachtet den Standort des Erzählers zum Geschehen sowie den Zeitpunkt und Ort des Erzählens, um die Perspektive der Geschichte zu klären.
- Quote paper
- Carola Gerdes (Author), 2003, Die Kurzgeschichte "Ein Mensch, den man nicht vergißt" von Stefan Zweig, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56569