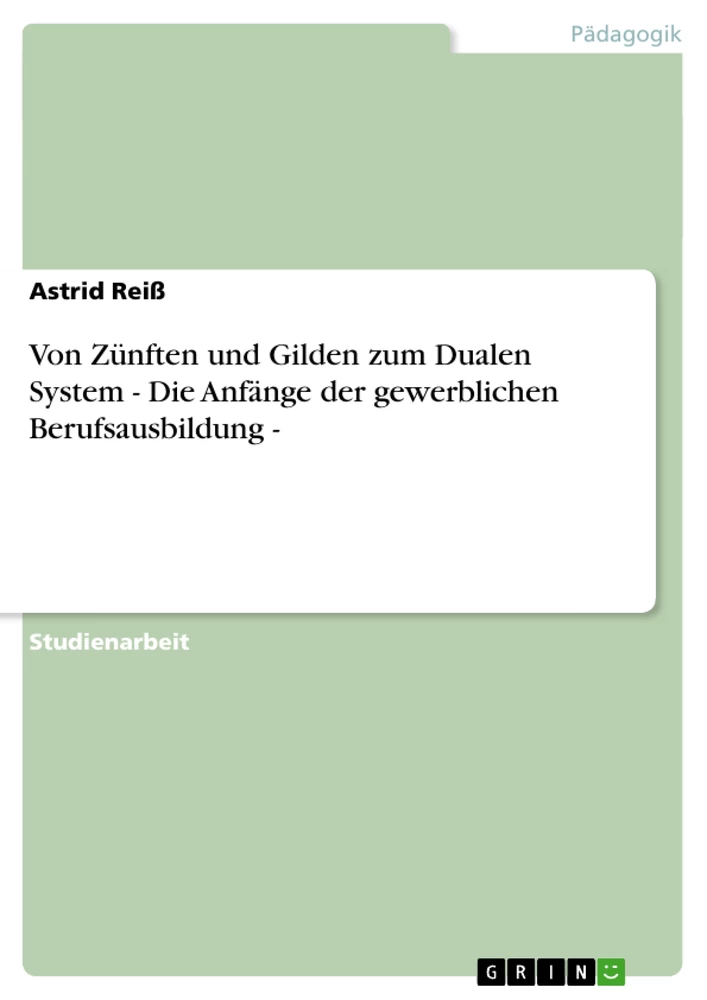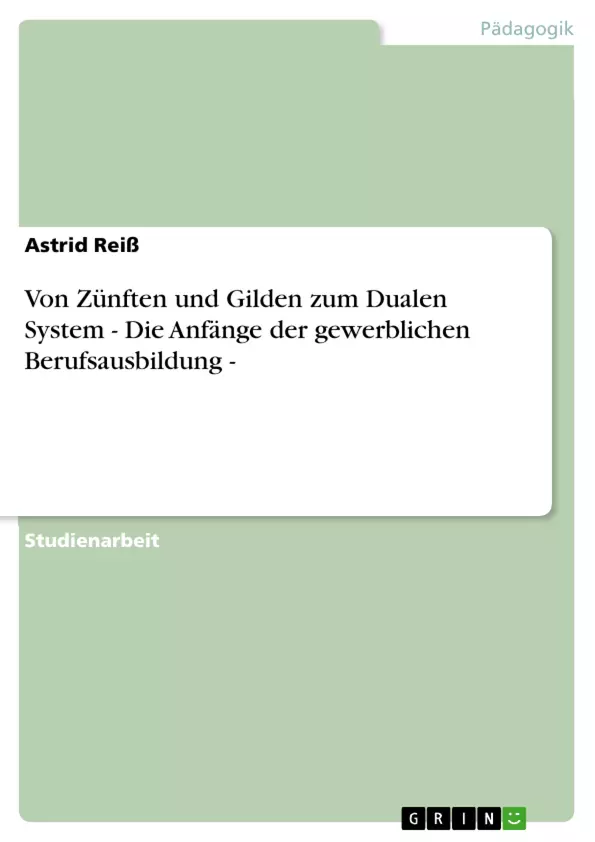Das deutsche Modell der Berufsausbildung genießt weltweit hohes Ansehen.
Die Berufsausbildung im Betrieb und in der Berufsschule (duales System) ist die mit Abstand wichtigste Form der beruflichen Erstausbildung in Deutschland. Der Lernende ist im dualen System zugleich Auszubildender und Berufsschüler. Die Lehre am Arbeitsplatz regelt ein Berufsausbildungsvertrag; der Besuch der Berufsschule ist Teil der Schulpflicht.
In der hier angefertigten Hausarbeit wird dargestellt, dass das duale System der Berufsausbildung in Deutschland nicht das Ergebnis bewusster Planung und Entwicklung ist. Die Berufsausbildung entstammt vielmehr einem komplexen historischen Prozess.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Gilden, Zünfte und Innungen
- 2.1. Forderungen einer ordentlichen Lehrzeit
- 2.2. Die Aufnahme eines Lehrlings
- 2.3. Das Alter der Lehrlinge
- 2.4. Die Dauer der Lehrzeit
- 2.5. Die Probezeiten der Lehrlinge
- 2.6. Der Hauptzweck der Bürgschaft über einen Lehrling
- 2.7. Maßnahmen gegen das Entlaufen eines Lehrjungen
- 2.8. Das Zahlen von Lehrgeld
- 2.9. Das Lossprechen vor der Lade
- 3. Die staatliche Gewerbeförderung
- 3.1. Die ersten Ansätze zur Verbesserung der Lehrausbildung
- 3.2. Die Berufsausbildung nach Karl Büchers Konzept 1876
- 3.3. Innovation durch preußische Staats-Eisenbahnbetriebe 1878
- 3.4. Gewerbeverordnungsnovelle 1897 – „Duales Prinzip der Berufsausbildung"
- 3.5. Gründung des DATSch 1908
- 3.6. Arbeitsstelle für gewerbliche Berufserziehung 1947
- 3.7. Bundesinstitut für Berufsbildungsforschung 1969
- 4. Die Spaltung von Industrie- und Handwerkerausbildung
- 4.1. Das Handwerk unter dem Druck der „Großen Industrie“ im 19. Jh.
- 4.2. Veränderungen in der Handwerkerausbildung
- 4.3. Die industrietypische Berufsausbildung
- 5. Die Berufsschulen und die Reform der Ausbildung
- 5.1. Die Auslagerung der Ausbildung aus der Produktion
- 5.2. Die ersten Anfänge der Berufsschule in der Lern- und Buchschule
- 5.3. Die Arbeitsschule
- 5.4. Die Fortbildungsschule
- 5.5. Die Frankfurter Methodik
- 6. Abschließende Bemerkungen
- 7. Selbständigkeitserklärung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit verfolgt das Ziel, die historischen Entwicklungen der gewerblichen Berufsausbildung in Deutschland nachzuzeichnen und aufzuzeigen, dass das heutige duale System kein Ergebnis bewusster Planung, sondern ein komplexer historischer Prozess ist. Die Arbeit analysiert die Rolle von Zünften und Gilden als Vorläufer des dualen Systems und untersucht die zunehmende staatliche Einflussnahme auf die Berufsausbildung.
- Die Entwicklung der Berufsausbildung von den mittelalterlichen Zünften bis zum dualen System.
- Der Einfluss von Zunftordnungen und staatlichen Regulierungen auf die Ausbildung.
- Die Herausforderungen und Veränderungen in der Ausbildung im 19. und 20. Jahrhundert.
- Die Rolle der Berufsschulen in der Reform der Ausbildung.
- Die zunehmende Spezialisierung und Differenzierung der Berufsausbildung.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt das deutsche duale System der Berufsausbildung vor und hebt dessen internationale Bedeutung hervor. Sie kündigt die zentrale These der Arbeit an: Das duale System ist nicht geplant entstanden, sondern ein Resultat eines komplexen historischen Prozesses.
2. Gilden, Zünfte und Innungen: Dieses Kapitel untersucht Zünfte und Gilden als Vorläufer der betrieblichen Ausbildung. Es beleuchtet die Ausbildungsmethoden (Vormachen und Nachmachen), die Regulierung der Lehrzeit (Dauer, Anzahl der Lehrlinge), und die Rolle von Lehrverträgen und Zunftordnungen. Die Kapitel diskutiert unterschiedliche Interpretationen der historischen Beziehungen zwischen Gilden und Zünften.
3. Die staatliche Gewerbeförderung: Dieses Kapitel beschreibt die zunehmende staatliche Einflussnahme auf die gewerbliche Berufsausbildung. Es analysiert verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrausbildung, beginnend mit ersten Ansätzen bis hin zur Gründung des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung. Wichtige Meilensteine wie die Gewerbeverordnungsnovelle von 1897 und die Gründung des DATSch werden detailliert betrachtet.
4. Die Spaltung von Industrie- und Handwerkerausbildung: Dieses Kapitel analysiert die Entwicklung unterschiedlicher Ausbildungswege in Industrie und Handwerk im 19. Jahrhundert. Es untersucht den Druck der „Großen Industrie“ auf das Handwerk und die daraus resultierenden Veränderungen in der Handwerkerausbildung. Die Entstehung der industrietypischen Berufsausbildung wird im Detail erläutert.
5. Die Berufsschulen und die Reform der Ausbildung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung von Berufsschulen und deren Rolle in der Reform der Ausbildung. Verschiedene Ansätze wie die Lern- und Buchschule, die Arbeitsschule und die Fortbildungsschule werden diskutiert, sowie die Bedeutung der Frankfurter Methodik.
Schlüsselwörter
Duales System, Berufsausbildung, Gewerbe, Zünfte, Gilden, Innungen, Handwerk, Industrie, Berufsschule, staatliche Regulierung, historische Entwicklung, Lehrzeit, Lehrlinge, Meisterlehre.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Historische Entwicklung der gewerblichen Berufsausbildung in Deutschland
Was ist der Gegenstand dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht die historische Entwicklung der gewerblichen Berufsausbildung in Deutschland. Sie verfolgt das Ziel, aufzuzeigen, dass das heutige duale System kein Ergebnis bewusster Planung, sondern ein komplexer historischer Prozess ist.
Welche Themen werden in der Hausarbeit behandelt?
Die Arbeit analysiert die Rolle von Zünften und Gilden als Vorläufer des dualen Systems, die zunehmende staatliche Einflussnahme auf die Berufsausbildung, die Herausforderungen und Veränderungen im 19. und 20. Jahrhundert, die Rolle der Berufsschulen in der Reform der Ausbildung, sowie die zunehmende Spezialisierung und Differenzierung der Berufsausbildung. Die Entwicklung wird von den mittelalterlichen Zünften bis zum dualen System nachgezeichnet.
Welche Phasen der Berufsausbildung werden betrachtet?
Die Hausarbeit betrachtet verschiedene Phasen, beginnend mit der Ausbildung in mittelalterlichen Zünften und Gilden, über die zunehmende staatliche Regulierung und Förderung im 19. und 20. Jahrhundert (inkl. wichtiger Meilensteine wie die Gewerbeverordnungsnovelle von 1897 und die Gründung des DATSch), bis hin zur Entwicklung unterschiedlicher Ausbildungswege in Industrie und Handwerk und der Rolle der Berufsschulen (Lern- und Buchschule, Arbeitsschule, Fortbildungsschule, Frankfurter Methodik).
Welche Rolle spielten Zünfte und Gilden?
Die Hausarbeit untersucht Zünfte und Gilden als Vorläufer der betrieblichen Ausbildung. Sie beleuchtet deren Ausbildungsmethoden (Vormachen und Nachmachen), die Regulierung der Lehrzeit (Dauer, Anzahl der Lehrlinge), und die Rolle von Lehrverträgen und Zunftordnungen. Es werden auch unterschiedliche Interpretationen der historischen Beziehungen zwischen Gilden und Zünften diskutiert.
Wie beeinflusste der Staat die Berufsausbildung?
Die Hausarbeit beschreibt die zunehmende staatliche Einflussnahme auf die gewerbliche Berufsausbildung. Sie analysiert verschiedene Maßnahmen zur Verbesserung der Lehrausbildung von frühen Ansätzen bis zur Gründung des Bundesinstituts für Berufsbildungsforschung. Wichtige Meilensteine wie die Gewerbeverordnungsnovelle von 1897 und die Gründung des DATSch werden detailliert betrachtet.
Wie entwickelte sich die Spaltung zwischen Industrie- und Handwerkerausbildung?
Die Arbeit analysiert die Entwicklung unterschiedlicher Ausbildungswege in Industrie und Handwerk im 19. Jahrhundert. Sie untersucht den Druck der „Großen Industrie“ auf das Handwerk und die daraus resultierenden Veränderungen in der Handwerkerausbildung. Die Entstehung der industrietypischen Berufsausbildung wird im Detail erläutert.
Welche Rolle spielten die Berufsschulen?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Entstehung und Entwicklung von Berufsschulen und deren Rolle in der Reform der Ausbildung. Verschiedene Ansätze wie die Lern- und Buchschule, die Arbeitsschule und die Fortbildungsschule werden diskutiert, ebenso wie die Bedeutung der Frankfurter Methodik.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Duales System, Berufsausbildung, Gewerbe, Zünfte, Gilden, Innungen, Handwerk, Industrie, Berufsschule, staatliche Regulierung, historische Entwicklung, Lehrzeit, Lehrlinge, Meisterlehre.
Welche zentrale These vertritt die Hausarbeit?
Die zentrale These der Arbeit ist, dass das deutsche duale System der Berufsausbildung nicht geplant entstanden ist, sondern das Ergebnis eines komplexen historischen Prozesses.
- Quote paper
- Astrid Reiß (Author), 2002, Von Zünften und Gilden zum Dualen System - Die Anfänge der gewerblichen Berufsausbildung -, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5658