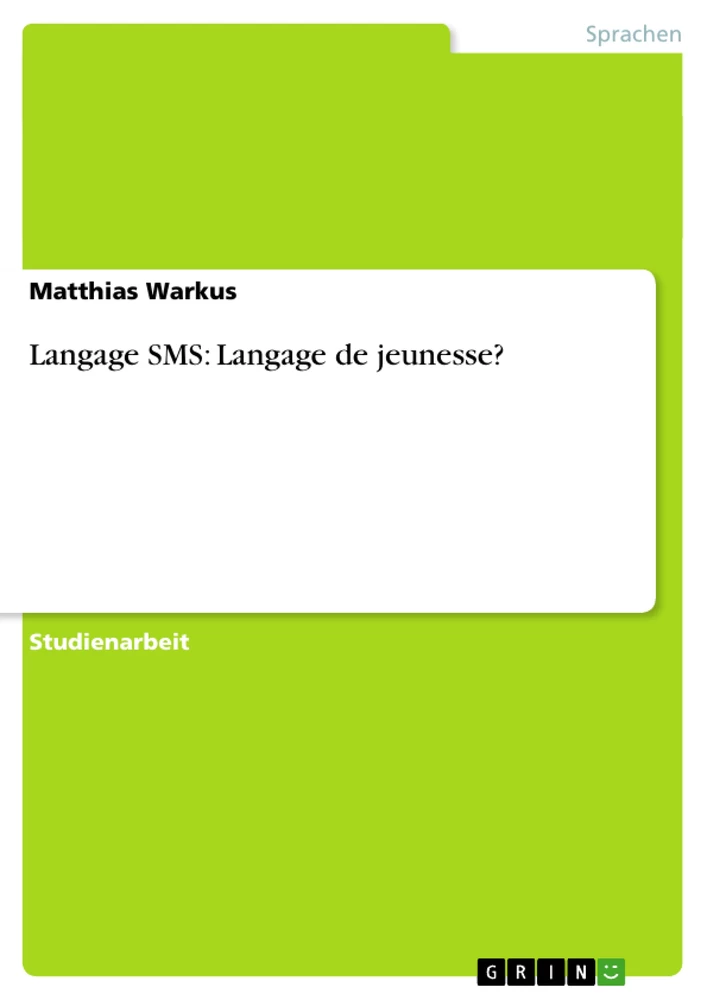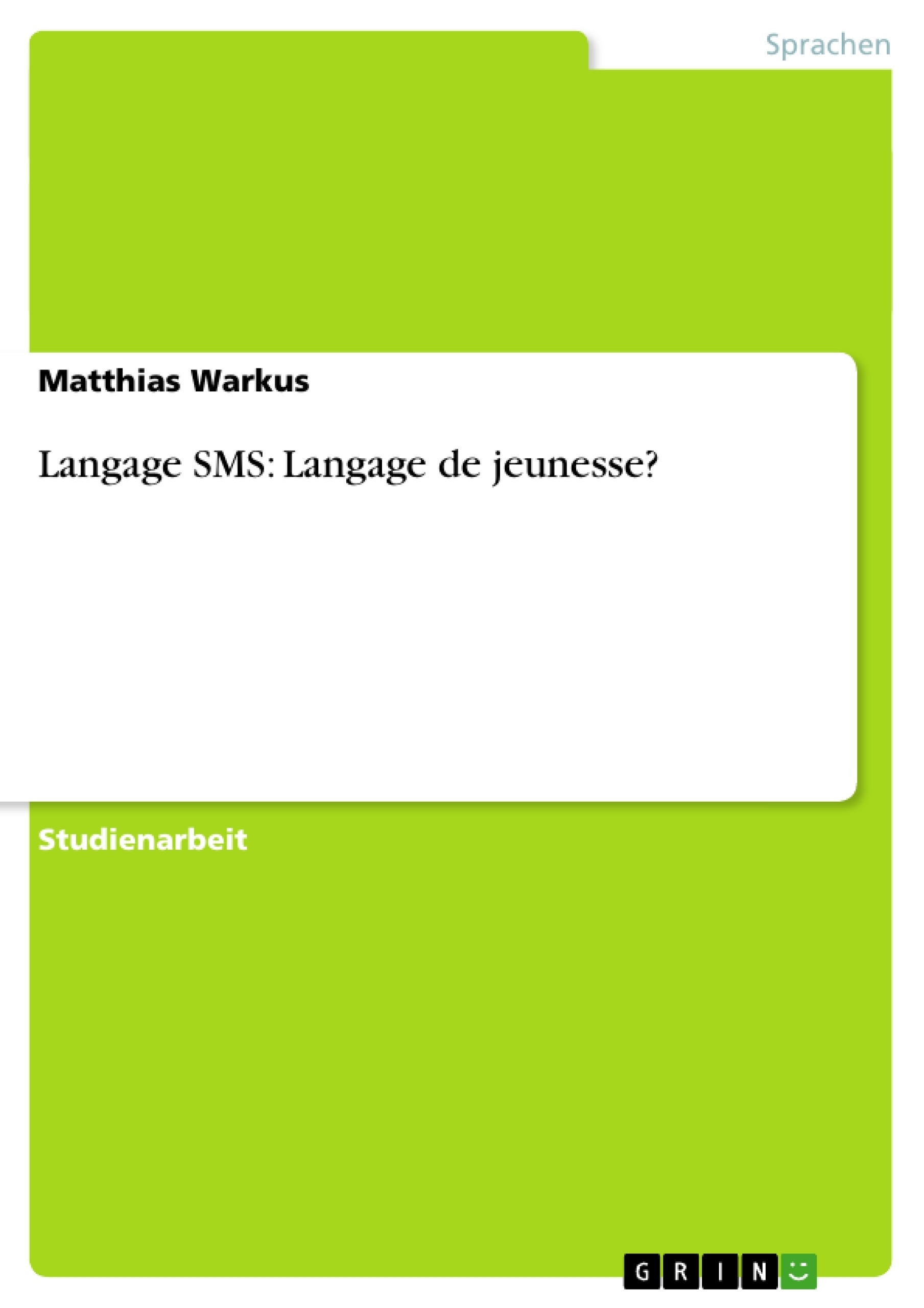Depuis la popularisation du télégraphe dans la première moitié du XIXe siècle, chaque nouveau moyen de télécommunication a développé son propre langage. Le SMS n'a pas failli faire de même.
Ce média est souvent perçu par le public comme utilisé principalement par les jeunes. Dans le travail ici présent, j'essayerai de relever ce qui caractérise le «langage SMS » et d'analyser si et comment ce langage peut être considéré un langage de jeunesse.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Introduction
- 1.1. Procédé
- 1.2. Notes à propos de l'analyse du corpus
- 2. Le SMS comme canal
- 2.1. Brièveté
- 2.2. Limites du clavier numérique.
- 3. Le « langage SMS >>
- 3.1. Économie d'espace (réduction graphique)
- 3.1.1. Logogrammes
- 3.1.2. Abréviations.
- 3.1.3. Squelettes consonantiques
- 3.1.4. Notations sémio-phonologiques
- 3.1.5. Notations phonétiques
- 3.1.6. Agglutination
- 3.2. Économie de temps
- 3.2.1. Substitution de minuscules pour des majuscules
- 3.2.2. Substitution d'espaces pour des ponctuations.
- 3.2.3. Substitution ou suppressions des diacritiques
- 3.3. Quasi-oralité. . .
- 3.3.1. Marqueurs de débit
- 3.3.2. Expressivité .
- 3.3.3. Marqueurs émotionaux
- 4. Le langage de jeunesse - différences et communautés
- 4.1. Niveau lexical
- 4.1.1. Métaphorisation et métonymisation
- 4.1.2. Anglicismes lexicaux
- 4.1.3. Emprunts issus de sources autres que l'anglais
- 4.1.4. Modes spécifiques de néologisation
- 4.1.5. Eléments du verlan
- 4.1.6. Expressions formulaires.
- 4.2. Niveau lexico-syntaxique
- 4.2.1. Usage intransitif des verbes transitifs
- 4.2.2. Usage réflexif des verbes non-réflexifs
- 4.2.3. Conversions adjectif substantif etc.
- 4.3. Niveau de la graphie : l'orthographe créative
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Werk untersucht das "SMS-Sprache", indem es die technischen Besonderheiten des Mediums untersucht und die Frage stellt, ob und wie diese Sprache als Jugendslang betrachtet werden kann.
- Die technischen Einschränkungen des SMS-Mediums, wie z.B. die Begrenztheit der Zeichenanzahl und die Tastatur des Mobiltelefons.
- Die Analyse der im SMS-Medium auftretenden sprachlichen Besonderheiten.
- Der Vergleich dieser Besonderheiten mit denjenigen, die als typisch für den Jugendslang angesehen werden.
- Die Untersuchung der Gründe für die Entwicklung dieser sprachlichen Besonderheiten.
- Die Bestimmung des Stellenwerts des "SMS-Sprache" im Verhältnis zum Jugendslang.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel führt in die Thematik ein und erklärt die methodischen Schritte der Analyse. Es wird der Corpus von SMS-Nachrichten vorgestellt, auf dem die Analyse basiert.
Das zweite Kapitel beleuchtet die technischen Besonderheiten des SMS-Mediums, die die Entstehung einer spezifischen Sprache beeinflussen. Hier werden die Begrenztheit der Zeichenanzahl und die Tastatur des Mobiltelefons als wichtige Faktoren herausgestellt.
Das dritte Kapitel untersucht die sprachlichen Besonderheiten des "SMS-Sprache" im Detail. Es werden verschiedene Arten von Abkürzungen, Veränderungen der Orthographie und des Satzbaus sowie die Verwendung von Ausdrucksformen analysiert.
Das vierte Kapitel widmet sich dem Vergleich des "SMS-Sprache" mit dem Jugendslang. Dabei werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf den Wortschatz, die Syntax und die Orthographie beleuchtet.
Schlüsselwörter
SMS-Sprache, Jugendslang, Textnachrichten, Kommunikationstechnologie, sprachliche Besonderheiten, Orthographie, Syntax, Wortschatz, Anglizismen, Verlan.
Häufig gestellte Fragen zur SMS-Sprache
Was charakterisiert die sogenannte SMS-Sprache?
Sie ist geprägt durch extreme Kürze, Reduktion der Grafik (Logogramme, Abkürzungen) und eine Quasi-Oralität (Annäherung an die gesprochene Sprache).
Warum werden Abkürzungen und Squelettes consonantiques genutzt?
Dies dient der Zeit- und Platzersparnis aufgrund der technischen Begrenzung der Zeichenanzahl pro SMS und der mühsamen Eingabe über die Zehnertastatur.
Ist die SMS-Sprache ein reiner Jugendslang?
Die Arbeit untersucht, ob die SMS-Sprache als "langage de jeunesse" gelten kann, da viele Merkmale wie Verlan oder Anglizismen typisch für die Jugendsprache sind.
Welche Rolle spielen Emoticons und emotionale Marker?
Sie dienen dazu, die fehlende Mimik und Gestik in der textbasierten Kommunikation auszugleichen und Expressivität zu verleihen.
Was bedeutet "orthographe créative"?
Es bezeichnet die bewusste Abweichung von Rechtschreibnormen, um Identität auszudrücken oder Wörter phonetisch verkürzt wiederzugeben.
- Quote paper
- Matthias Warkus (Author), 2006, Langage SMS: Langage de jeunesse?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56625