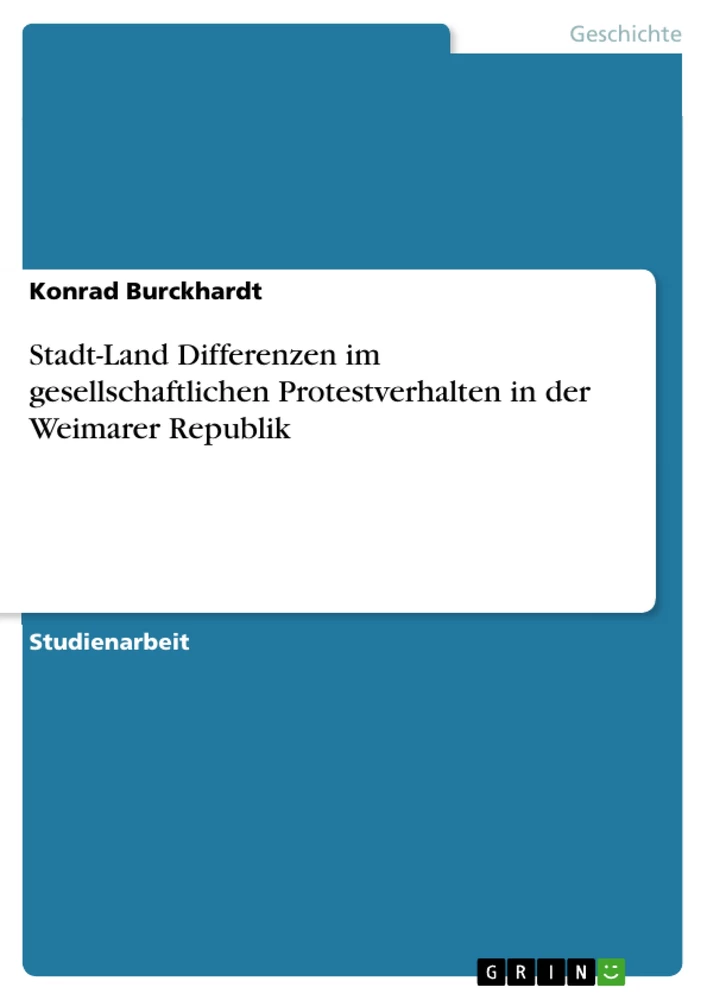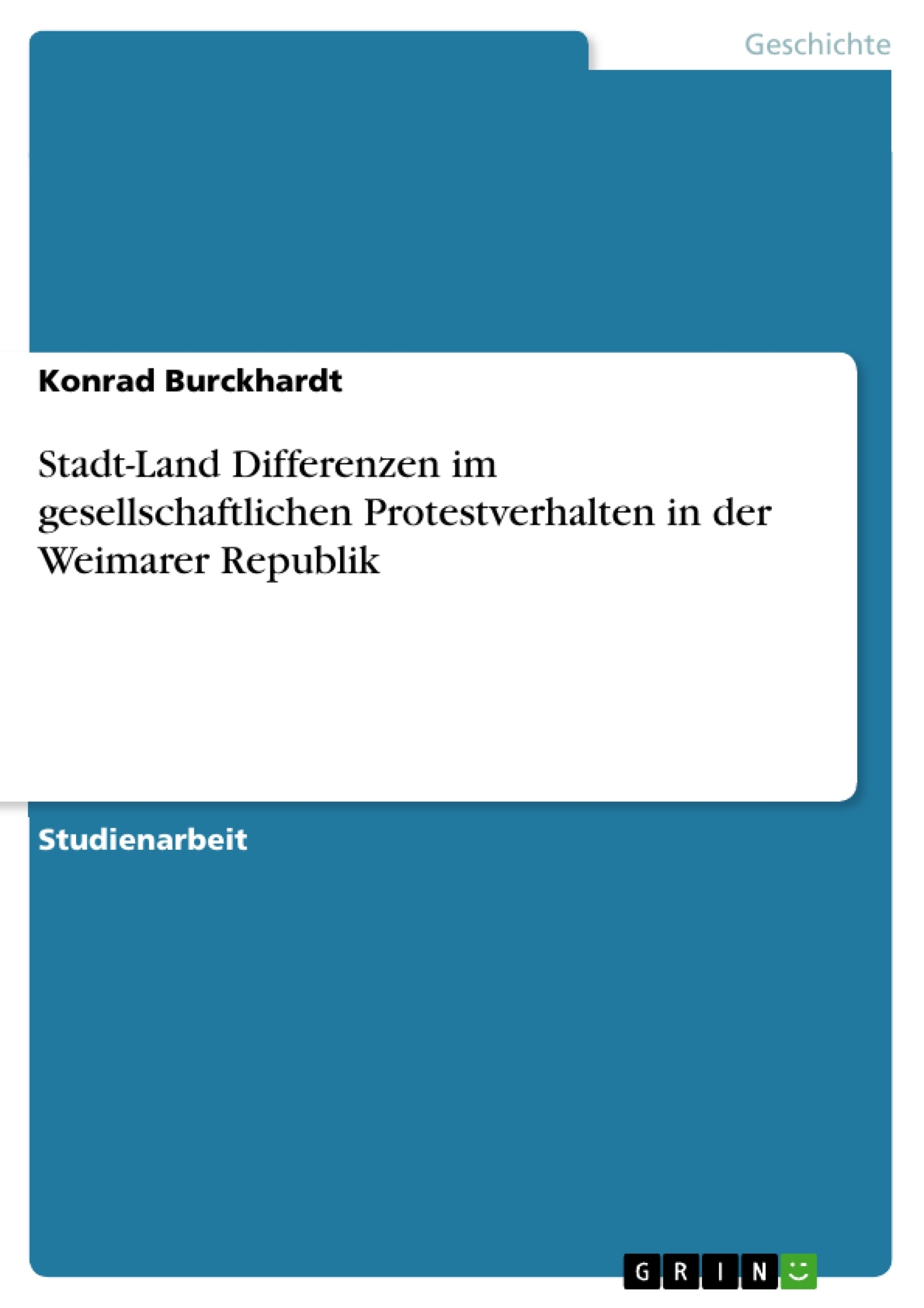Die erste deutsche Republik scheiterte an inneren Kämpfen, in denen politische Extreme immer mehr das Heft des Handelns in die Hand bekamen. Die Gewalt gegen den innenpolitischen Gegner und gegen die demokratische Ordnung kennzeichnete die politische (Un)Kultur der untergehenden Weimarer Republik. Doch warum gewinnen nationalsozialistische sowie kommunistische Propaganda erst in der Gesellschaft der späten Republik an Einfluss? Warum gelang es ihnen erst hier, die gesellschaftliche Unzufriedenheit für sich zu instrumentalisieren? Schon von Anbeginn an hatte die Weimarer Republik mit politischen und ökonomischen Unsicherheiten und Krisen zu kämpfen, die immer auch gesellschaftliche Gruppen belasteten und sie zu Protesten animierten. Aber zunächst schlug die Unsicherheit und Unzufriedenheit nicht in eine systemfeindliche Grundhaltung breiter Massen um. Das gesellschaftliche Protestverhalten soll in dieser Arbeit für eine Frühphase (1918-1923) und eine Endphase (1928-1933) der Weimarer Republik untersucht werden, da hier entsprechende Verhaltensweisen verstärkt auftraten. In der Frühphase dominierten Proteste, die sich um Lebensmittelpreise drehten und zumeist mit der persönlichen Sicherheit zu tun hatten. In der Endphase der Republik dominierte der politisch motivierte Protest. Die Republik entstand in einer Zeit, in der technische Entwicklungen die Landwirtschaft revolutionieren und einhergingen mit einer schon seit dem 19. Jahrhundert fortschreitenden Urbanisierung und industriellen Entwicklung. Die städtischen Gesellschaften entwickelten eigene Lebensformen und spezifische Milieus, wie das industrielle Arbeitermilieu großer Industriegebiete. Im zunehmenden Maße fordern diese Milieus Mitsprache und Emanzipation. Auf dem Land blieben alte Hierarchien mit traditionellen Autoritäten besonders auf ostelbischen Großgrundbesitz zunächst scheinbar resistenter gegen Emanzipationsbestrebungen unterer Bevölkerungsschichten. Doch auch die ländliche Gesellschaft war tief greifenden Veränderungen unterworfen. Diese Arbeit soll daher den Unterschieden städtischer und ländlicher Gesellschaften Rechnung tragen, indem sie städtisches und ländliches Protestverhalten differenziert. Die Protesterscheinungen reichen von einfachen Demonstrationen bis hin zu offener Gewalt gegen politische Gegner oder staatliche Institutionen. Schließlich sollen Aussagen getroffen werden, in wie weit verändertes gesellschaftliches Protestverhalten zum Untergang der Weimarer Republik beitrug.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Gesellschaftlicher Protest in der Mangelwirtschaft nach dem Krieg bis zum Ende der Inflation (1918-1923)
- 1. Subsistenz- und Teuerungsprotest in den Städten
- 2. Die Ländliche Gesellschaft zwischen Tradition und Emanzipation
- II. Die destruktive Radikalisierung gesellschaftlicher Unzufriedenheit in der Spätphase der Weimarer Republik (1928-1933)
- 1. Politisierter Protest in den Städten
- 2. Politisierter Protest auf dem Land
- III. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht das gesellschaftliche Protestverhalten in der Weimarer Republik, insbesondere in einer Frühphase (1918-1923) und einer Endphase (1928-1933). Die Untersuchung zielt darauf ab, zu verstehen, wie sich die soziale Unzufriedenheit in unterschiedlichen Phasen der Weimarer Republik manifestierte und welche Rolle sie für den Aufstieg der extremen politischen Kräfte spielte.
- Differenzierung des Protestverhaltens in Städten und auf dem Land
- Entwicklung des Protestverhaltens von Subsistenz- und Teuerungsprotest hin zu politischem Protest
- Die Rolle von Kriegswirtschaft, Inflation und Mangelwirtschaft im Protestgeschehen
- Der Einfluss von sozialen Milieus, wie dem industriellen Arbeitermilieu, auf das Protestverhalten
- Die Bedeutung von Gewerkschaften und anderen sozialen Bewegungen für die Organisation des Protests
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit betrachtet zunächst die Frühphase der Weimarer Republik, in der vor allem Subsistenz- und Teuerungsproteste in den Städten dominierten. Die Kriegswirtschaft und die Inflation führten zu einer Verknappung von Grundnahrungsmitteln und einem starken Anstieg der Preise. Die städtischen Unterschichten und Teile der Mittelschichten waren besonders von den Folgen der Inflation betroffen, während auf dem Land traditionelle Hierarchien und Strukturen bislang weitgehend erhalten blieben.
In der Spätphase der Weimarer Republik fand eine Radikalisierung des Protestverhaltens statt, das zunehmend politisch motiviert war. Der Aufstieg nationalsozialistischer und kommunistischer Propaganda verstärkte die gesellschaftliche Unzufriedenheit und führte zu einer Polarisierung der politischen Landschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse des gesellschaftlichen Protestverhaltens in der Weimarer Republik, wobei die Themen der Kriegswirtschaft, Inflation, Mangelwirtschaft, Subsistenz- und Teuerungsprotest, politischer Protest, soziale Milieus, Gewerkschaften und politische Radikalisierung im Vordergrund stehen. Die Analyse bezieht sich auf städtische und ländliche Gesellschaften und deren spezifische Erfahrungen mit den Herausforderungen der Weimarer Republik.
Häufig gestellte Fragen
Wie unterschied sich der Protest in Stadt und Land in der Weimarer Republik?
In den Städten dominierten anfangs Subsistenzproteste gegen Hunger und Inflation, während ländliche Gebiete länger an traditionellen Hierarchien festhielten, sich später aber ebenfalls radikalisierten.
Warum radikalisierte sich der Protest am Ende der Republik (1928-1933)?
Wirtschaftliche Krisen und die Instrumentalisierung der Unzufriedenheit durch nationalsozialistische und kommunistische Propaganda führten zu politisch motivierter Gewalt.
Was waren Subsistenz- und Teuerungsproteste?
Dabei handelte es sich um Demonstrationen und Unruhen, die durch Mangelwirtschaft, hohe Lebensmittelpreise und existenzielle Not nach dem Ersten Weltkrieg ausgelöst wurden.
Welche Rolle spielten soziale Milieus beim Protest?
Besonders das industrielle Arbeitermilieu in den Städten forderte verstärkt Mitsprache und Emanzipation, was oft in organisierten Protesten mündete.
Trug das Protestverhalten zum Untergang der Weimarer Republik bei?
Ja, die Destabilisierung durch extreme politische Gewalt und die Unfähigkeit des Staates, soziale Sicherheit zu garantieren, schwächten die demokratische Ordnung massiv.
- Arbeit zitieren
- Konrad Burckhardt (Autor:in), 2006, Stadt-Land Differenzen im gesellschaftlichen Protestverhalten in der Weimarer Republik, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56681