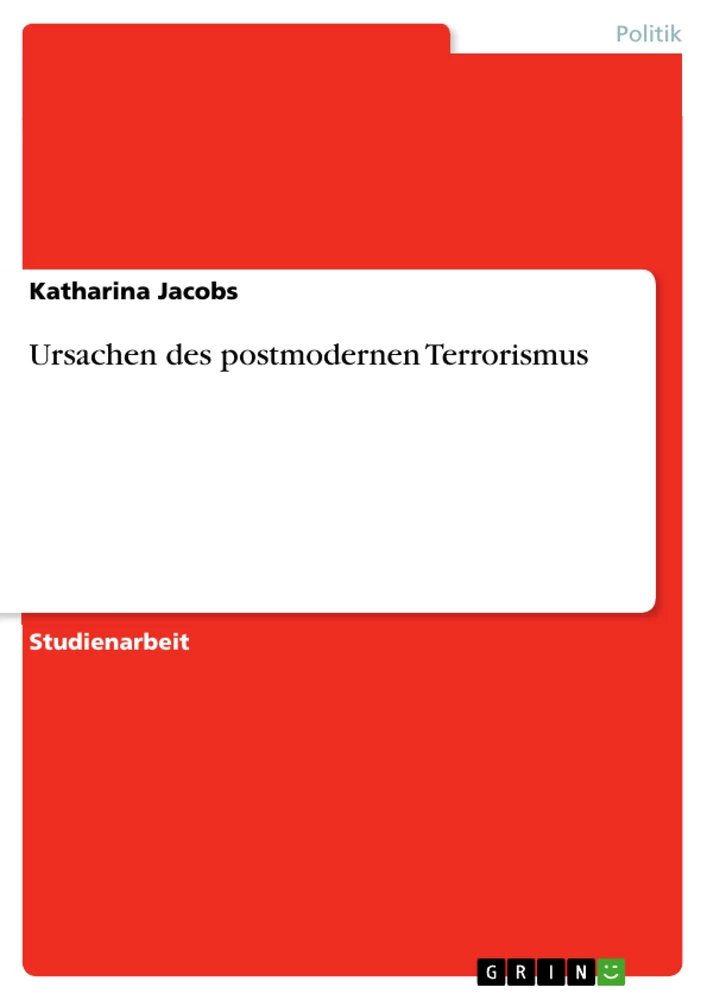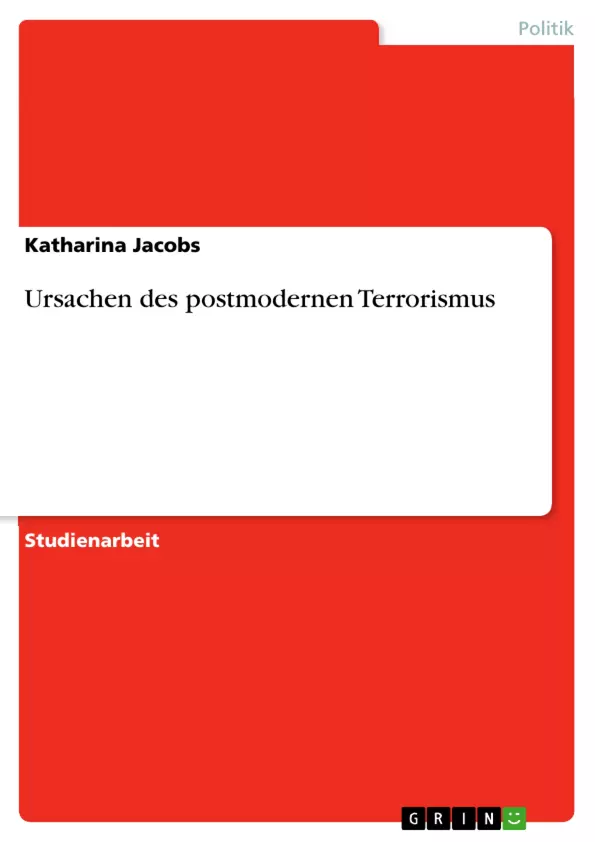Durch die Epochen der Zeit haben sich bestimmte kulturelle Aspekte in bestimmten Regionen bzw. Nationen besonders herausgebildet. In den Ländern des Nahen und Mittleren Osten war vor allem der Aspekt Religion, vorrangig die des Islam, Ausdruck der Kultur. Der Islam beeinflusst das alltägliche Leben durch bestimmte Riten, geregelte Tagesabläufe und Wertvorstellungen. Für viele Muslime ist ihr Glaube die Basis ihres Seins und seine Grundsätze, so fremdartig sie Westeuropäern erscheinen mögen, sind Gesetz.
Es ist nicht immer ganz leicht nachvollziehbar, dass fremde Kulturen Handlungen legitimieren, denen die eigene Kultur ablehnend gegenübersteht.
Nach den Anschlägen des 11. Septembers 2001 wurde oft vorschnell die Gleichung "Islamist = Terrorist" aufgestellt. So pauschal kann und darf das nicht gelten. In der Tat liegen terroristischen Handlungen oft ideologische, nicht selten von Religion geprägte Denkansätze zu Grunde. Doch reicht Religion als Erklärung aus? Ist religiöser Fanatismus die Antwort auf das Warum oder ist Religion für die Terroristen selbst lediglich ein schwacher Versuch der Legitimation? Inwiefern beeinflusst die Religion des Islam und die damit verbundene arabische Kultur den Terrorismus unserer Zeit?
Bevor man vorschnell Werturteile fällt, sollte man sich mit fremden Kulturen eingehender befasst haben. Daher sind der Islam, seine Geschichte, Traditionen und Auswirkungen, speziell im Kontext des postmodernen Terrorismus, Gegenstand der Betrachtung der vorliegenden Arbeit.
Inhaltsverzeichnis
- Religion als kulturspezifisches Merkmal
- Religiöses Leben der arabisch-muslimischen Welt
- Wie sich Alltag im Islam definiert
- Der kulturelle Einfluss des Westens
- Entwicklung der Gewaltbereitschaft auf religiöser Grundlage
- Die historische Grundlage des „Djihad“
- Die Rolle des Islam im Terrorismus - am Beispiel der „fatwa“ von 1998 und ihren Folgen
- Ob und in wie weit lässt sich Terrorismus aus der Religion ableiten?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Frage, inwieweit sich der moderne Terrorismus aus religiösen Aspekten, speziell im Kontext des Islam, erklären lässt. Die Arbeit analysiert den Einfluss der Religion auf die Kultur der arabisch-muslimischen Welt und die Entwicklung von Gewaltbereitschaft auf religiöser Grundlage.
- Der Islam als kulturspezifisches Merkmal im Nahen und Mittleren Osten
- Der Einfluss des Westens auf das religiöse Leben der arabisch-muslimischen Welt
- Die historische Entwicklung des „Djihad“ und seine Bedeutung im modernen Kontext
- Die Rolle religiöser Ideologie im Terrorismus
- Die Grenzen der Erklärung von Terrorismus allein durch religiöse Faktoren
Zusammenfassung der Kapitel
Religion als kulturspezifisches Merkmal: Das Kapitel untersucht die vielschichtige Bedeutung von Kultur und beleuchtet den Islam als prägenden Aspekt der Kultur im Nahen und Mittleren Osten. Es wird der Einfluss des Islams auf den Alltag, die Riten und Wertvorstellungen muslimischer Gesellschaften erläutert, und die Schwierigkeit, fremde Kulturpraktiken ohne eingehendes Verständnis zu beurteilen, hervorgehoben. Die Arbeit betont, dass die einfache Gleichsetzung von "Islamist = Terrorist" falsch ist, jedoch ideologische, oft religiös geprägte, Denkansätze terroristischen Handlungen zugrunde liegen. Die zentrale Frage nach der Legitimation von Gewalt durch Religion wird aufgeworfen.
Religiöses Leben der arabisch-muslimischen Welt: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Alltag im Islam, einschließlich religiöser Riten und Gebräuche. Es untersucht den starken Gegensatz zwischen dem Einfluss des Westens und der traditionellen arabischen Kultur. Die Arbeit analysiert verschiedene Konfessionen innerhalb des Islams (Sunniten und Schiiten), die unterschiedliche Gewaltpotenziale aufweisen, und verdeutlicht, dass die Gewaltbilanz schiitischer Gruppen, im Verhältnis zu ihrer Größe, besonders hoch ist. Beispiele wie die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad illustrieren die Rolle religiöser Überzeugung, insbesondere des Märtyrertums, in terroristischen Handlungen.
Entwicklung der Gewaltbereitschaft auf religiöser Grundlage: Der Abschnitt erforscht die historische Entwicklung der Gewaltbereitschaft, unter besonderer Berücksichtigung des „Djihad“. Die Arbeit untersucht, wie sich der „heilige Krieg“ im Laufe der Geschichte entwickelt hat und wie er im Kontext des modernen Terrorismus interpretiert wird. Der Zusammenhang zwischen der historischen Bedeutung des „Djihad“ und seiner Rolle im postmodernen Terrorismus wird aufgezeigt. Die Arbeit verschiebt sich hier weg von allgemeinen Betrachtungen des Islams hin zur Untersuchung spezifischer Entwicklungen und Interpretationen innerhalb der religiösen Doktrin.
Schlüsselwörter
Islam, Terrorismus, Djihad, arabische Kultur, religiöse Ideologie, Gewaltbereitschaft, Fundamentalismus, Märtyrertum, westlicher Einfluss, Kulturvergleich.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Seminararbeit: Der Islam und der moderne Terrorismus
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen dem Islam und dem modernen Terrorismus. Sie analysiert, inwieweit religiöse Aspekte, insbesondere im Kontext des Islam, den modernen Terrorismus erklären können. Die Arbeit betrachtet dabei den Einfluss der Religion auf die Kultur der arabisch-muslimischen Welt und die Entwicklung von Gewaltbereitschaft auf religiöser Grundlage.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themenschwerpunkte: Der Islam als kulturspezifisches Merkmal im Nahen und Mittleren Osten; der Einfluss des Westens auf das religiöse Leben der arabisch-muslimischen Welt; die historische Entwicklung des „Djihad“ und seine Bedeutung im modernen Kontext; die Rolle religiöser Ideologie im Terrorismus; und die Grenzen der Erklärung von Terrorismus allein durch religiöse Faktoren.
Welche Kapitel umfasst die Seminararbeit?
Die Seminararbeit gliedert sich in Kapitel zu folgenden Themen: Religion als kulturspezifisches Merkmal; Religiöses Leben der arabisch-muslimischen Welt (inkl. Alltag im Islam und westlicher Einfluss); Entwicklung der Gewaltbereitschaft auf religiöser Grundlage (inkl. historischer Entwicklung des „Djihad“); Die Rolle des Islam im Terrorismus – am Beispiel der „fatwa“ von 1998 und ihren Folgen; und die Frage, ob und inwieweit sich Terrorismus aus der Religion ableiten lässt.
Wie wird der „Djihad“ in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die historische Entwicklung des „Djihad“ und seine Interpretation im Kontext des modernen Terrorismus. Sie beleuchtet den Zusammenhang zwischen der historischen Bedeutung des „Djihad“ und seiner Rolle im postmodernen Terrorismus und geht dabei über allgemeine Betrachtungen des Islams hinaus, um spezifische Entwicklungen und Interpretationen innerhalb der religiösen Doktrin zu analysieren.
Welche Rolle spielt der westliche Einfluss?
Die Arbeit analysiert den starken Gegensatz zwischen dem Einfluss des Westens und der traditionellen arabischen Kultur auf das religiöse Leben der arabisch-muslimischen Welt. Dieser Einfluss wird als ein wichtiger Faktor im Kontext der Entstehung von Gewaltbereitschaft betrachtet.
Wie wird die Gewaltbereitschaft im Kontext des Islams betrachtet?
Die Arbeit untersucht die Entwicklung von Gewaltbereitschaft auf religiöser Grundlage und analysiert verschiedene Konfessionen innerhalb des Islams (Sunniten und Schiiten) hinsichtlich ihres Gewaltpotenzials. Sie hebt hervor, dass die einfache Gleichsetzung von „Islamist = Terrorist“ falsch ist, aber ideologische, oft religiös geprägte, Denkansätze terroristischen Handlungen zugrunde liegen können. Beispiele wie die Hamas und der Palästinensische Islamische Dschihad veranschaulichen die Rolle religiöser Überzeugung, insbesondere des Märtyrertums, in terroristischen Handlungen.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter der Arbeit sind: Islam, Terrorismus, Djihad, arabische Kultur, religiöse Ideologie, Gewaltbereitschaft, Fundamentalismus, Märtyrertum, westlicher Einfluss, Kulturvergleich.
Welche Schlussfolgerung zieht die Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht kritisch, inwieweit sich der moderne Terrorismus aus religiösen Aspekten, speziell im Kontext des Islams, erklären lässt. Sie betont die Komplexität des Themas und vermeidet vereinfachende Schlussfolgerungen. Die Arbeit hinterfragt die Grenzen der Erklärung von Terrorismus allein durch religiöse Faktoren.
- Arbeit zitieren
- Katharina Jacobs (Autor:in), 2003, Ursachen des postmodernen Terrorismus, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56709