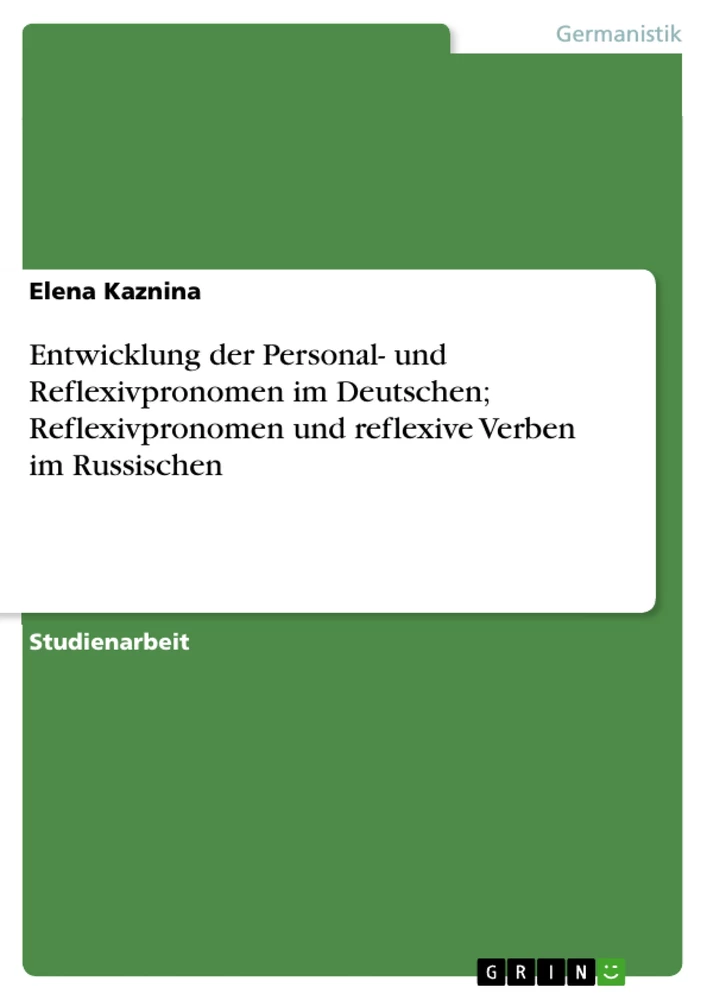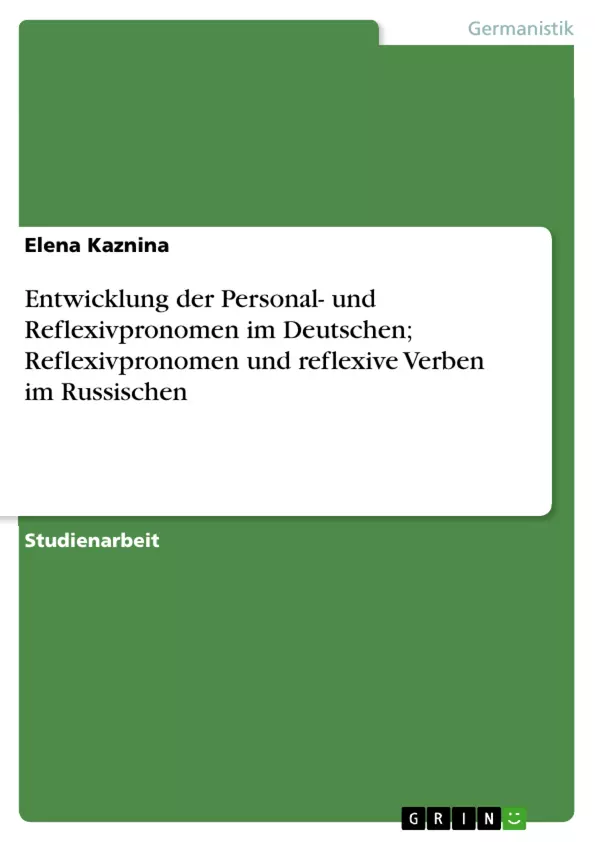Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte
Die Gliederung des Entwicklungsprozess der deutschen Sprache in einzelne und zeitlich fassbare und überzeugend begründbare Abschnitte wird von den Sprachhistorikern unterschiedlich vorgenommen. Das liegt vor allem daran, dass keine einheitliche Auffassung darüber besteht, welche Kriterien der Periodisierung zugrunde gelegt werden sollen. Es fehlt noch an einer allgemeinen anerkannten Theorie der Periodisierung sprachlicher Entwicklungen, wobei es fraglich ist, ob jemals eine Theorie erarbeitet werden kann, die auf die Periodisierung der Geschichte einer jeden Sprache anzuwenden ist.
Die bisher benutzten Kriterien lassen sich grob in folgende Gruppen zusammenfassen:
— sprachliche Kriterien
— soziolinguistische Kriterien: Hierhin gehören u.a. die Varietäten und ihr Verhältnis zueinander, die Rolle fremder Sprachen und ihr Einfluss auf das Deutsche
— außersprachliche Kriterien, insbesondere historische, sozialgeschichtliche, ökonomische und kulturelle Faktoren
— pragmatische und mediengeschichtlichen Kriterien
Probleme der Periodisierung des Deutschen liegen in der zeitlich differenzierten Durchsetzung sprachlicher Wandlungen, im unterschiedlichen Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache.
In der älteren Sprachgeschichtsforschung wird die Geschichte der deutschen Sprache in die folgenden Abschnitte eingeteilt:
Althochdeutsch von den Anhängen bis 1100
Mittelhochdeutsch von 1100 bis 1500
Neuhochdeutsch von 1500 bis zur Gegenwart
Die Perioden vor 1500 werden mitunter als Altdeutsch zusammengefasst und dem Neu(hoch)deutschen gegenübergestellt.
Dadurch, dass die Sprache sich ständig entwickelt, werden die Sprachhistoriker in der nächsten Zeit vor dem Problem stehen, neue Periodisierung auszuarbeiten und modernes Deutsch als nächstes Abschnitt der Sprache einfügen. Alle Sprachwissenschaftler haben zu Problem der Gliederung der deutschen Sprache unterschiedliche Meinungen. Sie sind aber einig, dass man die Periodisierung der Sprache stärker beachten werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte
- 2. Althochdeutsch
- 2.1 Zeitliche Einordnung
- 2.2 Pronomen im Althochdeutschen
- 2.3 Personalpronomen
- 2.4 Reflexivpronomen
- 2.5 Gotisch (Personal- und Reflexivpronomen)
- 3. Mittelhochdeutsch
- 3.1 Zeitliche Grenzen
- 3.2 Pronomen im Mittelhochdeutschen
- 3.3 Personalpronomen
- 3.4 Reflexivpronomen
- 4. Frühneuhochdeutsch
- 4.1 Zeitliche Grenzen
- 4.2 Pronomen im Frühneuhochdeutschen
- 4.3 Personalpronomen
- 4.4 Reflexivpronomen
- 4.5 Die wichtigsten Veränderungen im Frühneuhochdeutschen:
- 5. Neuhochdeutsch
- 5.1 Zeitliche Grenzen
- 5.2 Pronomen im Neuhochdeutschen
- 5.3 Personalpronomen
- 5.4 Reflexivpronomen
- 6. Personal- und Reflexivpronomen im Russischen. Reflexive Verben.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit verfolgt das Ziel, die Entwicklung der Personal- und Reflexivpronomen im Deutschen nachzuvollziehen. Sie untersucht die Veränderungen dieser Pronomen über verschiedene Sprachperioden hinweg und beleuchtet die Unterschiede zu den entsprechenden Formen im Russischen.
- Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte
- Entwicklung der Personalpronomen im Deutschen
- Entwicklung der Reflexivpronomen im Deutschen
- Vergleichende Betrachtung der Reflexivpronomen und reflexiven Verben im Deutschen und Russischen
- Sprachliche Kriterien der Periodisierung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen bei der Einteilung der deutschen Sprachgeschichte in verschiedene Perioden. Es werden unterschiedliche Kriterien, wie sprachliche, soziolinguistische, außersprachliche und pragmatische Aspekte, erörtert, die bei der Periodisierung berücksichtigt werden müssen. Die Schwierigkeiten entstehen durch die zeitlich differenzierte Durchsetzung sprachlicher Veränderungen und das unterschiedliche Verhältnis von gesprochener und geschriebener Sprache. Die Arbeit vergleicht verschiedene etablierte Periodisierungen und hebt die Kontroverse um die Einteilung in Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch hervor, wobei die Grenzen zwischen diesen Epochen fließend und diskutabel sind. Die fortlaufende Entwicklung der Sprache führt zu einem andauernden Bedarf an neuen Periodisierungen.
2. Althochdeutsch: Dieses Kapitel behandelt die erste Entwicklungsphase des Deutschen, die Althochdeutsche Periode. Es beleuchtet die Herausbildung des Deutschen aus den Sprachen der germanischen Großstämme und den Einfluss des politischen Zusammenschlusses dieser Stämme und der Verbreitung des Christentums. Die althochdeutsche Lautverschiebung wird als wesentliche sprachliche Erscheinung für den Übergang von den germanischen Stammessprachen zum Deutschen hervorgehoben. Das Kapitel unterteilt den althochdeutschen Zeitraum in eine vorliterarische und eine schriftliche Phase, wobei der Übergang von der mündlichen zur schriftlichen Kommunikation einen wichtigen Aspekt darstellt. Es wird auch die Verwendung des lateinischen Alphabets aufgrund des Mangels an geeigneten Schriftzeichen für die deutsche Sprache erläutert. Der Abschnitt über Pronomen im Althochdeutschen beschreibt deren syntaktische Verwendung, Flexion und grammatische Kategorien.
Schlüsselwörter
Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Personalpronomen, Reflexivpronomen, Sprachgeschichte, Periodisierung, Sprachwandel, Germanistik, Russisch, reflexive Verben.
Häufig gestellte Fragen zur Entwicklung von Personal- und Reflexivpronomen im Deutschen und Russischen
Welche Sprachperioden werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung von Personal- und Reflexivpronomen über verschiedene Perioden der deutschen Sprachgeschichte: Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch. Zusätzlich wird ein Vergleich mit dem Russischen gezogen.
Welche Themenschwerpunkte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf die Entwicklung der Personal- und Reflexivpronomen im Deutschen über die verschiedenen Sprachperioden hinweg. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Vergleich dieser Pronomen und reflexiver Verben mit dem Russischen. Die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte und die sprachlichen Kriterien, die dabei eine Rolle spielen, werden ebenfalls ausführlich behandelt.
Wie wird die Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte in der Arbeit dargestellt?
Die Arbeit diskutiert die Herausforderungen und Kontroversen bei der Einteilung der deutschen Sprachgeschichte in verschiedene Perioden. Es werden unterschiedliche Kriterien (sprachliche, soziolinguistische, außersprachliche, pragmatische Aspekte) und die Schwierigkeiten aufgrund der zeitlich differenzierten Durchsetzung sprachlicher Veränderungen und des Verhältnisses von gesprochener und geschriebener Sprache erörtert. Verschiedene etablierte Periodisierungen werden verglichen, und die fließenden Grenzen zwischen den Epochen (Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch) werden hervorgehoben.
Wie werden die Personal- und Reflexivpronomen in den einzelnen Sprachperioden beschrieben?
Für jede Sprachperiode (Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch) wird die Entwicklung der Personal- und Reflexivpronomen im Detail beschrieben, einschließlich ihrer syntaktischen Verwendung, Flexion und grammatischen Kategorien. Der Abschnitt zu Althochdeutsch beinhaltet auch einen Vergleich mit dem Gotischen.
Wie wird der Vergleich zwischen Deutsch und Russisch in der Arbeit gestaltet?
Die Arbeit beinhaltet einen Vergleich der Reflexivpronomen und reflexiven Verben im Deutschen und Russischen, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen. Dieser Vergleich dient als zusätzlicher Vergleichspunkt für die Entwicklung der Pronomen im Deutschen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch, Neuhochdeutsch, Personalpronomen, Reflexivpronomen, Sprachgeschichte, Periodisierung, Sprachwandel, Germanistik, Russisch, reflexive Verben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in Kapitel zur Periodisierung der deutschen Sprachgeschichte, jeweils ein Kapitel zu Althochdeutsch, Mittelhochdeutsch, Frühneuhochdeutsch und Neuhochdeutsch mit Fokus auf Personal- und Reflexivpronomen, und abschließend ein Kapitel zum Vergleich von Personal- und Reflexivpronomen sowie reflexiven Verben im Russischen.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Die Arbeit richtet sich an Leser, die sich für die Entwicklung der deutschen Sprache und die Morphologie von Pronomen interessieren. Sie ist besonders relevant für Studenten der Germanistik und Linguistik.
- Citation du texte
- Elena Kaznina (Auteur), 2003, Entwicklung der Personal- und Reflexivpronomen im Deutschen; Reflexivpronomen und reflexive Verben im Russischen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56811