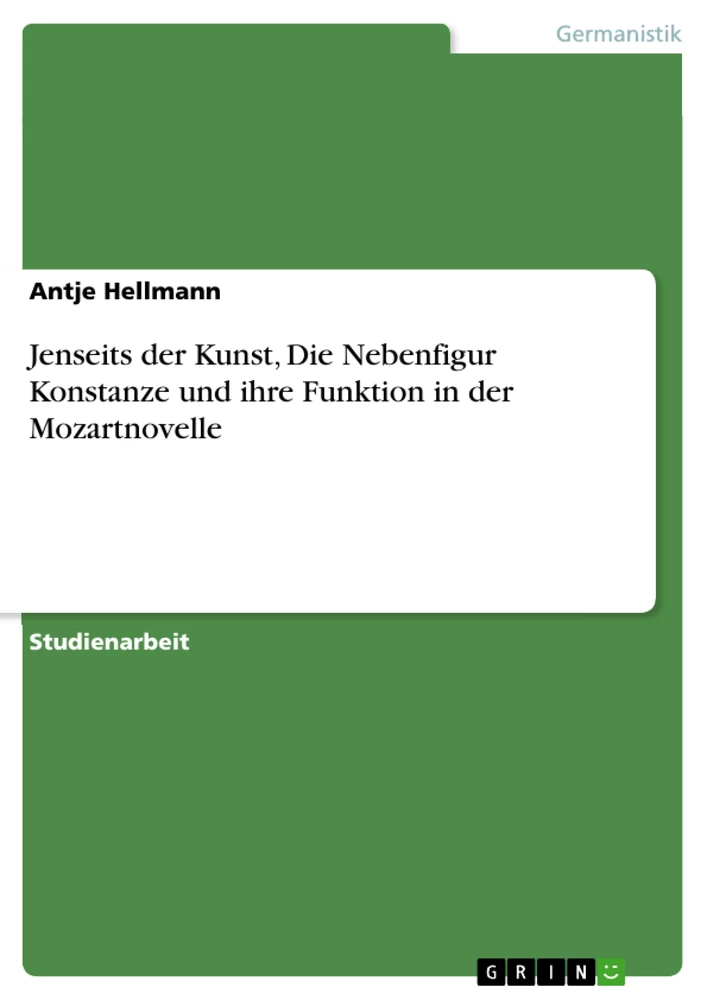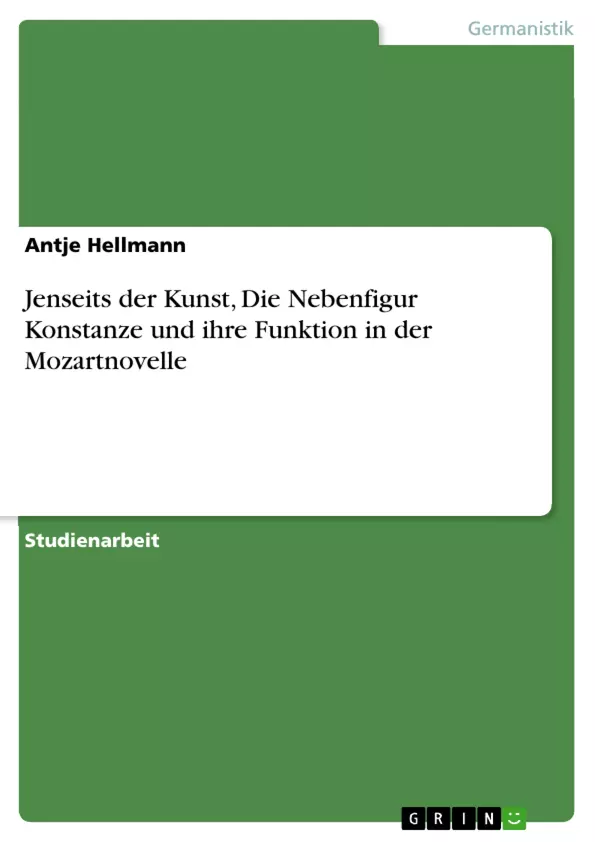Als Eduard Mörike im Mai 1855 das Manuskript von „Mozart auf der Reise nach Prag“ an seinen Verleger, den Freiherrn von Cotta, einsendet, schreibt er: „Meine Aufgabe bei dieser Erzählung war, ein kleines Charaktergemälde Mozarts (das erste seiner Art, soviel ich weiß) aufzustellen, wobei, mit Zugrundelegung frei erfundener Situationen, vorzüglich die heitere Seite zu lebendiger, konzentrierter Anschauung gebracht werden sollte.“ In diesem Brief bezeichnet er seine Erzählung ganz selbstverständlich als „Novelle“, obgleich sie viele Merkwürdigkeiten aufweist und in manchen Punkten mit der klassischen Novellentheorie als unvereinbar erscheint. Für den Dichter Christoph Martin Wieland (1733-1813) zeichnet sich die Textform Novelle durch die „Simplizität des Plans“ und den „kleinen Umfang der Fabel“ aus. Als ein charakteristisches Merkmale für die Novelle gilt denn auch der Umstand, dass sich die Handlung in wenigen Sätzen zusammenfassen lässt. Das gelingt bei Mörikes Novelle jedoch nur ansatzweise: „Mozart auf der Reise nach Prag“ schildert einen Tag in Mozarts Leben. Der Künstler ist mit seiner Frau auf der Reise nach Prag, um seine Oper „Don Juan“ zur Aufführung zu bringen. Das Ehepaar hält zur Rast in einem Wald und später in einem Dorfgasthof. Mozart geht spazieren, gelangt in den Schlossgarten des im Dorfe ansässigen Grafen von Schinzberg und pflückt dort, in Gedanken versunken, eine Pomeranze vom Baum. Er wird vom Gärtner erwischt und zum Schloss gebracht. Der Graf ist entsetzt, als er erfährt, dass die Früchte am Pomeranzenbaum nicht mehr vollständig sind, denn der Baum sollte am Abend der Nichte des Grafen zur Verlobung übergeben werden und sein Sohn Max hatte passend zu den neun Orangen ein Gedicht vorbereitet. Unterdessen erhält die Gräfin ein Schreiben von Mozart, in dem er sich für seine Tat entschuldigt, und da die Gräfin den berühmten Musiker kennt, und weiß, dass ihre Nichte Eugenie ihn sehr schätzt, wird Mozart mit seiner Frau Konstanze zur Abendgesellschaft eingeladen. Mozart spielt den Gästen einige Stücke aus seiner neuen Oper Don Juan vor. Konstanze erzählt den Frauen einige Anekdoten aus dem Wiener Eheleben und findet für die Braut auch noch ein Verlobungspräsent. Am nächsten Morgen wird das Ehepaar Mozart von der Grafenfamilie verabschiedet und erhält als Geschenk eine Kutsche des Grafen. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DIE BIOGRAFISCHE AUSGANGSSITUATION
- KONSTANZE UND MOZART – EIN GEGENSÄTZLICHES PAAR
- Das äußere Erscheinungsbild
- Die Flakonszene
- Der biografische Hintergrundbericht des Erzählers
- DER NOVELLENKONFLIKT
- KONSTANZE ALS ERZÄHLER- UND REFLEKTIONSFIGUR
- Funktion des Erzählerwechsels
- Die Waldszene – die Sehnsucht nach der Natur
- Konstanzes Reaktionen auf die verlorene Zeit
- Hilfe von außerhalb – Die erträumte Zukunft in Berlin
- Die Stockgeheranekdote
- Der Erzählereinschub
- Einkauf im Seilerladen und das Salzfass
- ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Nebenfigur Konstanze in Eduard Mörikes Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“. Ziel ist es, die Funktion der Figur in der Erzählung zu analysieren und ihre Bedeutung für das Verständnis des Gesamtwerks aufzuzeigen.
- Konstanzes Rolle als Gegenfigur zu Mozart
- Die Darstellung des Alltäglichen und die Bedeutung der Detailbeschreibungen
- Die Funktion von Konstanzes Erzählungen und Erinnerungen für die Geschichte
- Die Beziehung zwischen Konstanze und der Natur
- Die Frage nach dem Verhältnis von Kunst und Leben in der Novelle
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und stellt die Novelle „Mozart auf der Reise nach Prag“ sowie die Figur der Konstanze im Kontext der Novellentheorie vor. Das zweite Kapitel widmet sich der biografischen Ausgangssituation der Figuren und beleuchtet die Beziehung zwischen Mozart und Konstanze. Im dritten Kapitel wird Konstanzes äußere Erscheinung beschrieben und die Flakonszene, eine Schlüsselszene in der Novelle, analysiert. Das Kapitel beleuchtet auch den biografischen Hintergrundbericht des Erzählers. Der vierte Abschnitt widmet sich dem Novellenkonflikt und dem zentralen Ereignis der Geschichte, Mozarts „Orangenfrevel“. Das fünfte Kapitel behandelt Konstanzes Rolle als Erzähler- und Reflexionsfigur. Es analysiert die Funktion des Erzählerwechsels, die Waldszene, Konstanzes Reaktionen auf die verlorene Zeit, die erträumte Zukunft in Berlin, die Stockgeheranekdote, den Erzählereinschub sowie den Einkauf im Seilerladen und das Salzfass.
Schlüsselwörter
Eduard Mörike, Mozart auf der Reise nach Prag, Novelle, Nebenfigur, Konstanze, Mozart, Alltäglichkeit, Detailbeschreibungen, Erzählfunktion, Natur, Kunst und Leben, Novellentheorie
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt Konstanze in Mörikes Mozartnovelle?
Konstanze fungiert als wichtige Nebenfigur, die als Gegenpol zum genialischen Mozart das Alltägliche, die Sorge um die Zukunft und die Erdung des Künstlers repräsentiert.
Was ist der zentrale Konflikt in „Mozart auf der Reise nach Prag“?
Der Konflikt entzündet sich am sogenannten „Orangenfrevel“, bei dem Mozart gedankenversunken eine wertvolle Frucht im Schlossgarten pflückt.
Warum wird Konstanze als „Erzähl- und Reflexionsfigur“ bezeichnet?
Durch ihre Anekdoten aus dem Wiener Eheleben gibt sie dem Leser tiefere Einblicke in Mozarts Charakter und die prekäre finanzielle Lage der Familie.
Wie thematisiert Mörike das Verhältnis von Kunst und Leben?
Die Novelle zeigt die Spannung zwischen der heiteren, schöpferischen Welt der Musik (Mozart) und der materiellen, oft mühsamen Realität des Alltags (Konstanze).
Was symbolisiert das Salzfass in der Geschichte?
Der Kauf des Salzfasses steht für die Hinwendung zum Häuslichen und die kleinen Sorgen des Alltags, die im Kontrast zu Mozarts flüchtiger Genialität stehen.
- Quote paper
- Antje Hellmann (Author), 2003, Jenseits der Kunst, Die Nebenfigur Konstanze und ihre Funktion in der Mozartnovelle, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56891