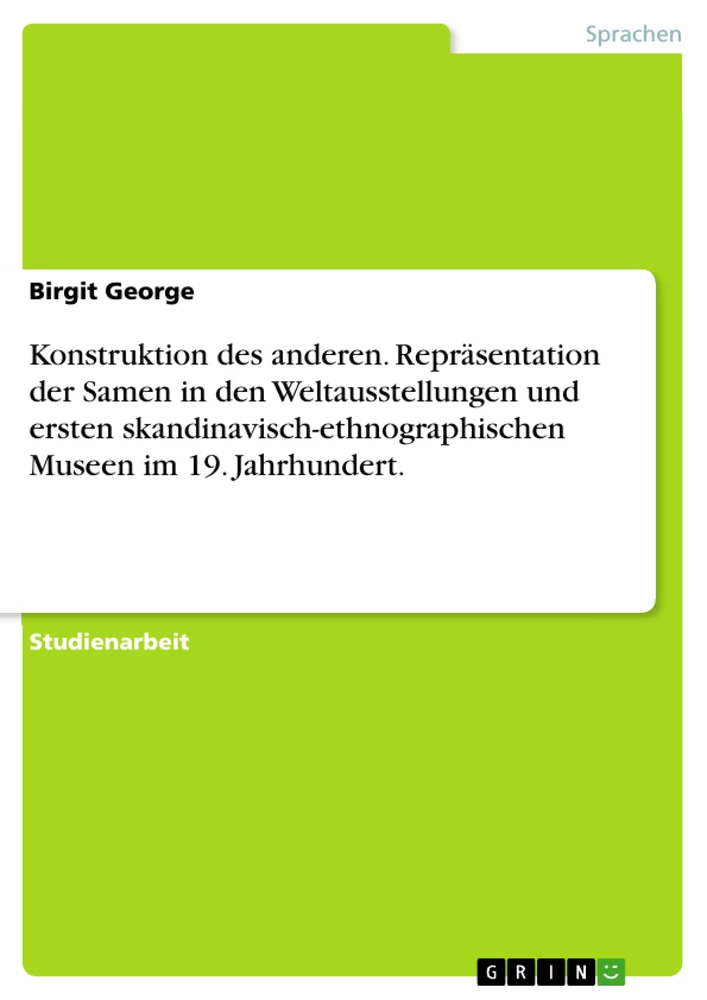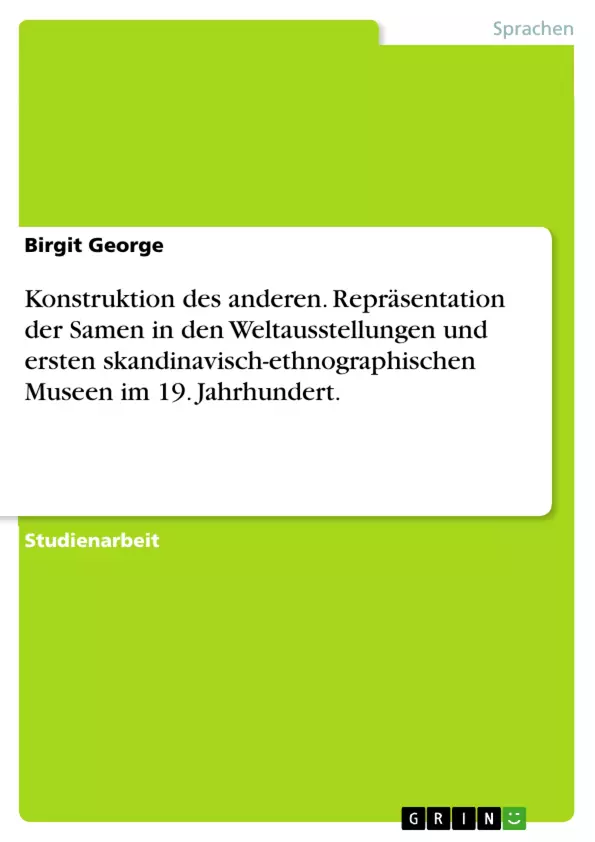Die historische Entwicklung von Museen kann trotz der für die Besucher solcher Institutionen vorgestellten unabdingbaren Wahrheit eines Ausstellungsgegenstandes immer nur im Kontext der Zeit, der politischen und gesellschaftlichen Entwicklungen und Sammlungsgeschichte des ausgestellten Gegenstandes betrachtet und interpretiert werden. Die oftmals angenommene Authentizität eines Objektes kann immer nur als Konstrukt oder Interpretation des Ausstellers begriffen werden, welcher mit der Exposition von Gegenständen durchaus politische Ziele verfolgen mag oder selbst einfach gebunden ist an die gesellschaftlichen Bedingungen seiner Zeit und damit oftmals nur einen mehr oder minder starken Anspruch an Objektivität anzustreben versucht. Ein Ausstellungsgegens-tand ist immer als Teil der Geschichte des Erzählers, also des Ausstellers, zu sehen. Betrachtet man Museen nun im gesellschaftspolitischen Kontext, so wird deutlich, dass Museen - vor allem heute als Teil nationaler Bildungspolitik - politische Institutionen darstellen, welche eine bestimmte Botschaft zu vermitteln suchen. Im Folgenden will ich untersuchen, in welcher Weise die Samen, vormals auch Lappen genannt, im 19. Jahrhundert weltweit öffentlich dargestellt und präsentiert wurden. Ich möchte aufzeigen, welche Stereotype gebildet wurden und wen bzw. was diese repräsentieren sollten. Der Identitätsbildungsprozess von Minderheiten spielt hierbei eine große Rolle. Ebenfalls möchte ich die Veränderungen in der Darstellung der Samen in heutigen Museen aufzeigen und fragen, wie diese Entwicklung vonstatten ging. Nicht nur einzelne Ausstellungen, sondern auch die historische Entstehung von ethnographischen Museen sind eng verbunden mit Entwicklungslinien und Konflikten innerhalb einer Gesellschaft. Die Darbietung von indigenen Völkern im 19. Jahrhundert als exotische Vorstufen damaliger Vorstellungen von Zivilisation entsprang einem ideologischen, kolonialen Zeitgeist, welcher u. a. einen romantischen Kontrast zur technischen Fortentwicklung des 19. Jahrhunderts aufbauen wollte. Insbesondere der Prozess der Nationsbildung in Europa im 19. Jahrhundert und die Entstehung von politischen Interessenbewegungen indigener Völker in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts beeinflussten die Entwicklung von Museen. In den Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts wurden nicht nur den Samen zuzuordnende Objekte ausgestellt, sondern ebenso das Volk an sich. [...]
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- 1.1 Der Begriff der Volkskultur
- 1.2 Die kulturelle Bedeutung der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert
- II. Museale Präsentation der Samen im 19. Jahrhundert
- 2.1 Egyptian Hall in London
- 2.2 Präsentation ethnographischer Dörfer und historischer Ensembles
- 2.3 Die „Hagenbeckschen Völkerschauen“
- 2.4 Die Weltausstellung in Chicago 1893
- III. Die Weltausstellungen als Motor für die Entwicklung des
volkskundlichen Museumswesens
- 3.1 Das „Skandinavisch-Ethnographische Museum in Stockholm“
- 3.2 Das Freilichtmuseum „Skansen“
- IV. „Die Anderen“ – Fremdbild und Stereotypisierung der Samen. Wandel in der Musealen Präsentation von den Weltausstellungen im 19. Jahrhundert bis heute.
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert die Darstellung der Samen in den Weltausstellungen und ersten skandinavisch-ethnographischen Museen des 19. Jahrhunderts. Ziel ist es, die Stereotype zu beleuchten, die in diesen Präsentationen konstruiert wurden und welche Botschaft sie über die samische Kultur vermitteln sollten. Die Arbeit untersucht auch die Veränderungen in der Darstellung der Samen in Museen bis heute und analysiert die Hintergründe dieser Entwicklung.
- Die Konstruktion von „Volkskultur“ im 19. Jahrhundert
- Die Rolle der Weltausstellungen in der Präsentation von indigenen Kulturen
- Stereotype und Fremdbilder der Samen in musealen Darstellungen
- Die Entwicklung des skandinavisch-ethnographischen Museumswesens
- Die Veränderung in der musealen Präsentation der Samen im 20. und 21. Jahrhundert
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel I: Einleitung: Diese Einleitung erläutert den Kontext der Arbeit und stellt den historischen Hintergrund der musealen Präsentation von indigenen Völkern dar. Sie beleuchtet den Begriff der „Volkskultur“ im 19. Jahrhundert und die Rolle der Weltausstellungen in der Konstruktion von nationaler Identität.
- Kapitel II: Museale Präsentation der Samen im 19. Jahrhundert: Dieses Kapitel beleuchtet verschiedene museale Präsentationen der Samen im 19. Jahrhundert, einschließlich der „Egyptian Hall“ in London, ethnographischer Dörfer und „Völkerschauen“ wie den „Hagenbeckschen Völkerschauen“. Es analysiert die Art und Weise, wie die Samen in diesen Präsentationen dargestellt wurden und welche Stereotype sie reproduzierten.
- Kapitel III: Die Weltausstellungen als Motor für die Entwicklung des volkskundlichen Museumswesens: Dieses Kapitel fokussiert auf die Rolle der Weltausstellungen in der Entwicklung des skandinavisch-ethnographischen Museumswesens. Es analysiert die Entstehung des „Skandinavisch-Ethnographischen Museums in Stockholm“ und des Freilichtmuseums „Skansen“ im Kontext der Weltausstellungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit Themen wie Volkskultur, ethnologische Museen, Weltausstellungen, Stereotype, Fremdbilder, indigene Kulturen, samische Identität, Nationsbildung, koloniale Ideologie, Skandinavien, und museale Präsentation. Die Arbeit analysiert die Rolle der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert bei der Konstruktion von „Volkskultur“ und der Darstellung von Minderheiten wie den Samen.
Häufig gestellte Fragen
Wie wurden die Samen im 19. Jahrhundert auf Weltausstellungen präsentiert?
Sie wurden oft als „exotische Vorstufen der Zivilisation“ in sogenannten Völkerschauen oder ethnographischen Dörfern ausgestellt, um einen Kontrast zur technischen Moderne zu bilden.
Was war der Zweck der „Hagenbeckschen Völkerschauen“?
Diese Schauen dienten der Unterhaltung und zur Schaustellung fremder Völker unter einem kolonialen Zeitgeist, wobei Stereotype über die samische Kultur massiv reproduziert wurden.
Welchen Einfluss hatten Weltausstellungen auf die Museumslandschaft?
Sie fungierten als Motor für die Entstehung volkskundlicher Museen, wie etwa des Skandinavisch-Ethnographischen Museums in Stockholm oder des Freilichtmuseums Skansen.
Was bedeutet die „Konstruktion des Anderen“ in diesem Kontext?
Es beschreibt, dass die Darstellung indigener Völker oft kein objektives Bild war, sondern ein Konstrukt der Aussteller, das politischen Zielen oder dem gesellschaftlichen Zeitgeist entsprach.
Wie hat sich die museale Präsentation der Samen bis heute verändert?
Vom exotischen Objekt im 19. Jahrhundert hat sich die Darstellung hin zur Berücksichtigung der samischen Identität und ihrer politischen Interessenbewegungen im 20. und 21. Jahrhundert entwickelt.
- Quote paper
- Birgit George (Author), 2005, Konstruktion des anderen. Repräsentation der Samen in den Weltausstellungen und ersten skandinavisch-ethnographischen Museen im 19. Jahrhundert., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56918