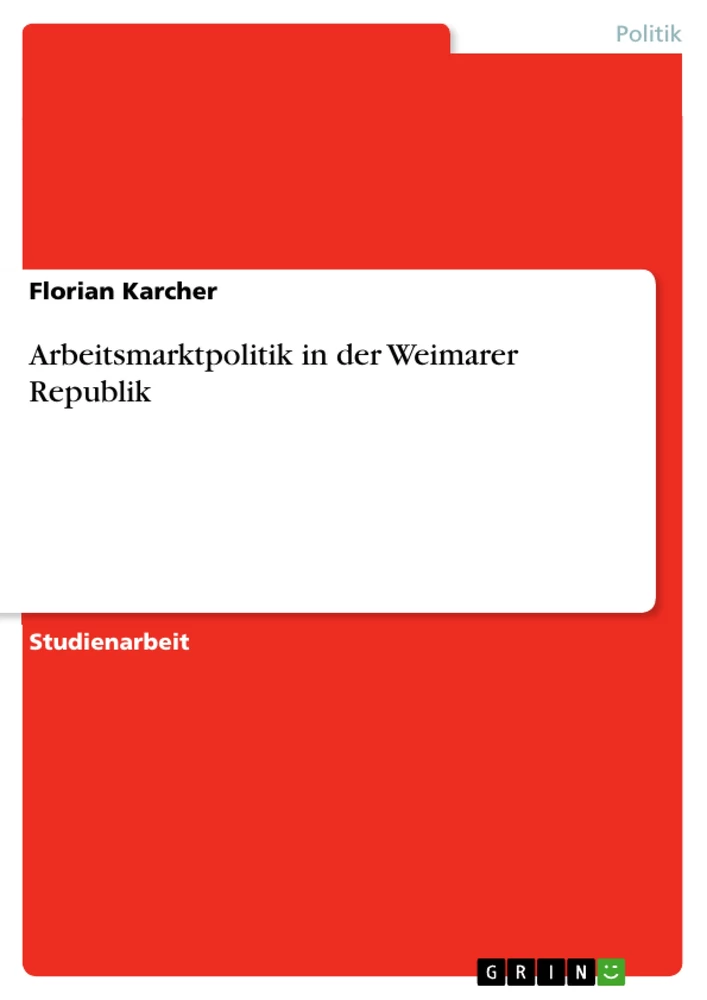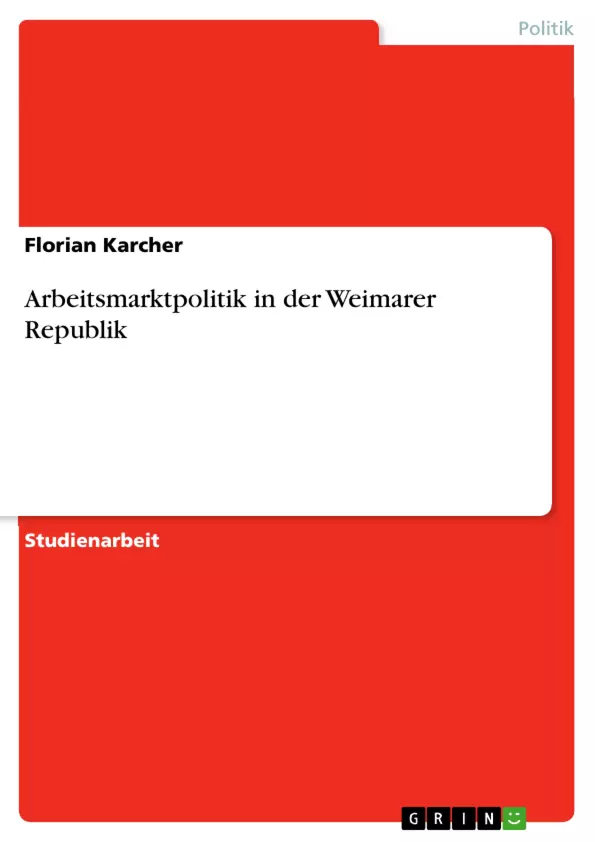„Die neue Regierung darf nicht gestört werden in ihrer Arbeit für den Frieden, in ihrer Sorge um Arbeit und Brot.“ Mit diesem Satz skizzierte Phillip Scheidemann, als er am 9.November 1918 die deutsche Republik ausrief, sei es gewollte oder zufällig, wesentliche sozialpolitische Probleme und Aufgaben der jungen Weimarer Republik. Der Krieg hatte seine Spuren an Deutschland hinterlassen. Zahlreiche Kriegsopfer und deren Familien galt es zu versorgen. Vor und während des Krieges hatte das Kaiserreich in großem Maße Anleihen beim Mittelstand und wohlhabenden Bürgertum gemacht, um die Kriegskosten zu decken. Diese Schulden konnten nun nicht mehr beglichen werden. Dies stellte zahlreiche Familien vor große finanzielle Schwierigkeiten. Auch hier war die Republik zum Handeln aufgefordert. Zusätzlich stellte sich das Problem der Arbeitslosigkeit. Während es unter Bismarck und in der wilhelminischen Ära noch Vollbeschäftigung gegeben hatte, ließen die Einschränkung der Kriegsproduktion, und des Heeres, die Ruhrbesetzung durch Frankreich und nicht zuletzt die anhaltende Rationalisierung das Problem der Massenarbeitslosigkeit entstehen. Alle diesen Versorgungsengpässe sollte nun die Sozialpolitik der Weimarer Republik gerecht werden. Doch die Republik stand, angesichts der immensen Reparationsforderungen, die sich aus dem Versailler Vertrag vom 28.Juni 1919 ergaben, selbst vor unlösbaren finanziellen Problemen. Doch nicht nur die finanzielle Situation war unklar, sondern auch und vor allem die politische.
Scheidemann war mit der Ausrufung der Republik nur wenige Stunden Karl Liebknecht zuvor gekommen, der die „sozialistische Republik“ proklamierte und mit seinem linksrevolutionären Spartakusbund, das System einer „Räterepublik“ nach sowjetischem Vorbild vorantreiben wollte, während Scheidemann und die Mehrheitssozialdemokraten die parlamentarisch-republikanische Staatsform wollten. Es folgten Unruhen und Straßenkämpfe, die in einen offenen Bürgerkrieg mündeten. Die Niederwerfung dieser Aufstände gelang der MSPD nur durch die Zusammenarbeit mit der ehemals kaiserlichen Militärführung und den gemäßigten Parteien, wie dem Zentrum und der Demokratischen Partei (DP). Es kam so zu einer Koalition zwischen linksorientierten Sozialisten und liberalen, sowie eher konservativen Kräften. Die Folge war eine regierungspolitische Instabilität und permanente Krise des Parlamentarismus. In knapp 14 Jahren lösten 14 Kabinette einander ab. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Sozialpolitische Aufgaben und Probleme der Jungen Republik
- Bedeutung von Arbeit in der Weimarer Republik
- Gestaltung der Arbeitsbeziehungen
- Betriebsräte und Gewerkschaften
- Tarifverträge
- Regelungen von Arbeitsstreitigkeiten
- Weiterentwicklung des Arbeitsschutz
- Arbeitslosenversicherung
- Anspruch auf Leistungen
- Umfang der Leistung
- Finanzierung
- Entwicklung der Arbeitslosenversicherung
- Arbeitsvermittlung und Organisation der Arbeitsverwaltung
- Notstandsarbeiten und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Herausforderungen der Arbeitsmarktpolitik in der Weimarer Republik. Sie beleuchtet die Bedeutung von Arbeit und Arbeitslosigkeit in dieser Zeit und die verschiedenen Maßnahmen, die ergriffen wurden, um diese Probleme zu bewältigen.
- Die Bedeutung von Arbeit in der Weimarer Republik
- Gestaltung der Arbeitsbeziehungen und die Rolle von Betriebsräten und Gewerkschaften
- Die Arbeitslosenversicherung und ihre Herausforderungen
- Die Arbeitsvermittlung und die Organisation der Arbeitsverwaltung
- Die politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der Arbeitsmarktpolitik
Zusammenfassung der Kapitel
Sozialpolitische Aufgaben und Probleme der Jungen Republik
Dieses Kapitel stellt die zentralen sozialpolitischen Herausforderungen der Weimarer Republik dar. Die Kriegsfolgen, die Reparationsforderungen des Versailler Vertrags und die einsetzende Massenarbeitslosigkeit werden als prägende Faktoren für die junge Republik beschrieben. Die schwierige politische Situation, geprägt durch den Kampf zwischen verschiedenen politischen Strömungen, wird ebenfalls beleuchtet.
Gestaltung der Arbeitsbeziehungen
Dieses Kapitel befasst sich mit der Gestaltung der Arbeitsbeziehungen zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern in der Weimarer Republik. Die Einrichtung von Betriebsräten und die Stärkung der Gewerkschaften werden als wichtige Schritte zur Verbesserung der Arbeitnehmerrechte dargestellt. Die Bedeutung der Tarifverträge und der Regelung von Arbeitsstreitigkeiten wird ebenfalls thematisiert.
Arbeitslosenversicherung
Dieses Kapitel analysiert die Arbeitslosenversicherung in der Weimarer Republik. Es beschreibt die Anspruchsberechtigung, den Umfang der Leistungen, die Finanzierung und die Entwicklung dieser Sozialversicherungsform. Die finanzielle Belastung der Republik durch die Arbeitslosigkeit und die politischen Konflikte um die Sanierung der Arbeitslosenversicherung werden ebenfalls beleuchtet.
Arbeitsvermittlung und Organisation der Arbeitsverwaltung
Dieses Kapitel betrachtet die Arbeitsvermittlung und die Organisation der Arbeitsverwaltung in der Weimarer Republik. Es beleuchtet die Bedeutung von Notstandsarbeiten und Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen als Reaktion auf die Massenarbeitslosigkeit. Die Herausforderungen der Arbeitsverwaltung in einer Zeit großer sozialer und wirtschaftlicher Unsicherheit werden ebenfalls aufgezeigt.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit wichtigen Themen der Arbeitsmarktpolitik in der Weimarer Republik, wie zum Beispiel Arbeitslosigkeit, Arbeitsbeziehungen, Betriebsräte, Gewerkschaften, Tarifverträge, Arbeitslosenversicherung, Arbeitsvermittlung, Notstandsarbeiten und die politische und wirtschaftliche Situation der Weimarer Republik. Die Arbeit beleuchtet die Herausforderungen der Arbeitsmarktpolitik in einer Zeit großer sozialer und wirtschaftlicher Umbrüche.
Häufig gestellte Fragen
Warum war die Arbeitslosigkeit in der Weimarer Republik so hoch?
Gründe waren die Umstellung der Kriegsproduktion, die Verkleinerung des Heeres, die Ruhrbesetzung und die zunehmende Rationalisierung in der Industrie.
Wie wurde die Arbeitslosenversicherung in der Weimarer Republik finanziert?
Die Arbeit untersucht die Einführung, Finanzierung und die politischen Konflikte um die Leistungen der neu geschaffenen Arbeitslosenversicherung.
Welche Rolle spielten Betriebsräte und Gewerkschaften?
Sie waren zentral für die Gestaltung der Arbeitsbeziehungen, den Abschluss von Tarifverträgen und die Stärkung der Arbeitnehmerrechte in der jungen Republik.
Was waren „Notstandsarbeiten“?
Dies waren staatlich organisierte Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, um die Massenarbeitslosigkeit zu bekämpfen und die soziale Not zu lindern.
Wie beeinflusste der Versailler Vertrag die Sozialpolitik?
Die immensen Reparationsforderungen führten zu finanziellen Engpässen, die den Handlungsspielraum der Republik bei der Versorgung von Kriegsopfern und Arbeitslosen einschränkten.
- Quote paper
- Florian Karcher (Author), 2005, Arbeitsmarktpolitik in der Weimarer Republik, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56921