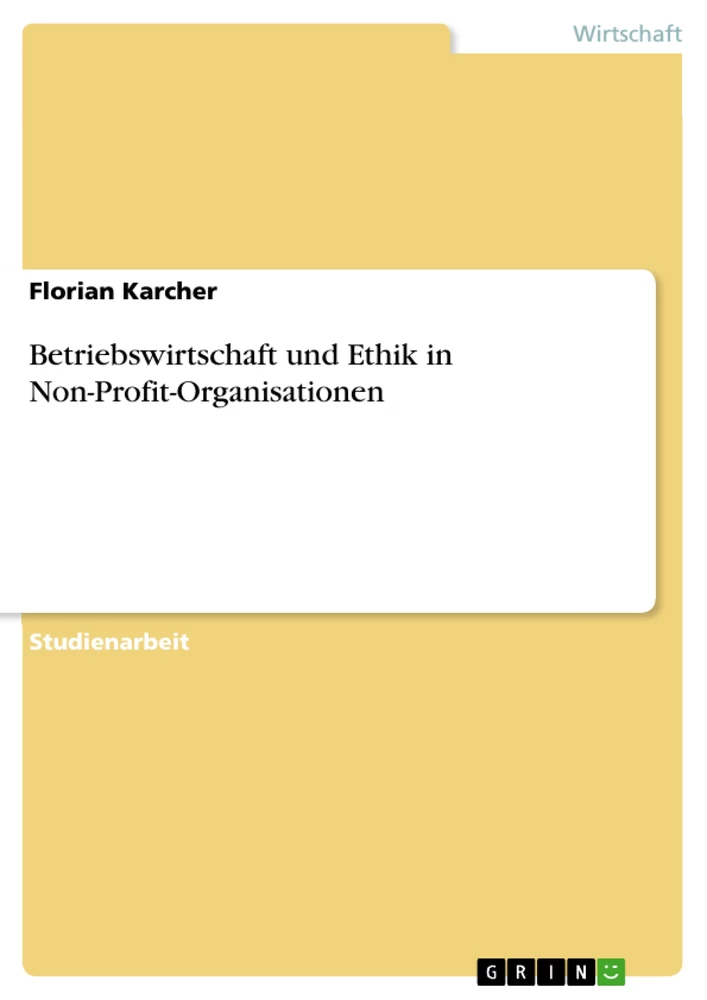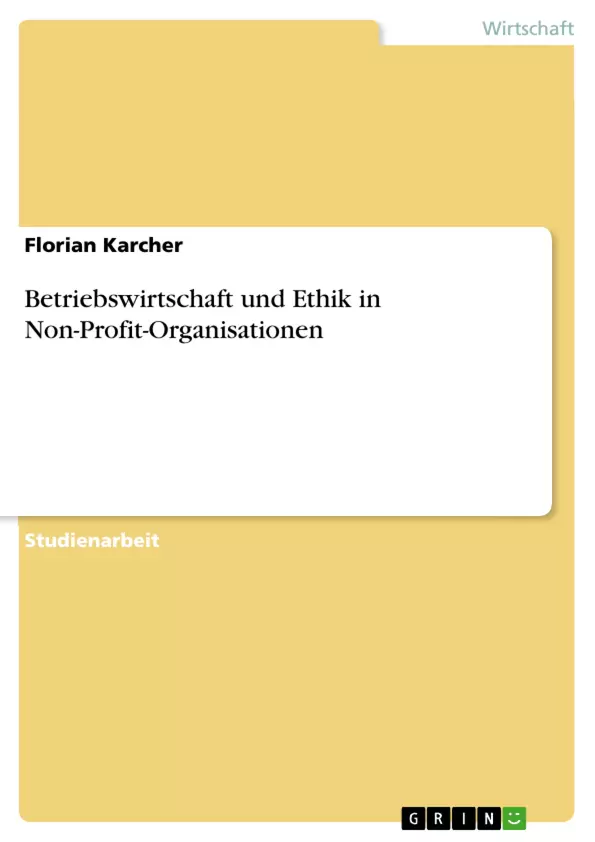Fast alle Bereiche unserer Gesellschaft sind zur Zeit auf Sparkurs ausgerichtet. Große Unternehmen versuchen ihr Produkte möglichst preisgünstig zu produzieren, meist auf Kosten der Angestellten und des Wirtschaftsstandorts Deutschland. In der Politik wird u.a. im Bereich der Sozialleistungen, z.B. Nullrunde bei den Renten, aber auch bei den öffentlichen Zuschüssen, z.B. zur Jugendarbeit, gespart. Auch christliche Einrichtungen, wie CVJM und Gemeinden sind von der Finanznot betroffen. Hier fallen wichtige öffentliche Zuschüsse weg. Fördervereine, Fundraising und Sponsoring werden in diesem Zusammenhang immer wichtiger. Auch auf diesem Spenden- und Sponsoringmarkt ist ein Konkurrenzkampf ausgebrochen. Wie sollen Einrichtungen, den Umfang und die christliche Qualität ihrer Arbeiten mit sinkenden Einnahmen und steigender Ausgabenbelastung gewährleisten? Vor diesem Problem stehen zahlreiche kleinere CVJM, Gemeinden und andere Einrichtungen, aber auch große überregionale Träger, wie u.a. der CVJM-Gesamtverband. Konsequenz müsste eine strikte wirtschaftliche Orientierung sein, d.h. beispielsweise Einkauf beim günstigsten Anbieter, Einsparungen im Personalbereich und Fokussierung auf wirtschaftlich besser gestellte Arbeitsbereiche, z.B. auf die in letzter Zeit stärker geförderte Schulsozialarbeit. Christliche Einrichtungen müssen sich dabei die Frage stellen, in welchem Maße diese wirtschaftliche Orientierung christlich-ethisch vertretbar ist. Dazu ein paar Beispiele: Darf eine christliche Einrichtung aus ethischer Sicht Vollzeitstellen streichen und durch geringfügige Beschäftigungsverhältnisse, die in den Lohnkosten und Sozialbeiträgen bedeutend günstiger sind, ersetzen? Ist es für solche Einrichtungen ethisch vertretbar ihre missionarischen Angebote zu Gunsten gut bezuschusster Aufgaben, wie z.B. Offene Türen oder Schulsozialarbeit, stark zu reduzieren? Wie steht es mit dem Materialeinkauf bei globalisierten Discountern, die ihre geringen Preise durch Marktverdrängungen und Niedriglöhne erreichen können? Unter diesen Voraussetzungen stehen auch grundlegende christliche Werte, wie z.B. Ehrlichkeit, in Frage. Die Versuchung, bspw. bei der Abrechnung öffentlicher Zuschüsse sog. „Tricks“ anzuwenden oder notwendige Reparaturen auch durch Schwarzarbeit durchführen zu lassen, ist groß. Vor allem geht es dabei um Nächstenliebe. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Wirtschaft - ein Problem für christliche Einrichtungen?
- Wirtschaftlichkeit in Bibel und Kirchengeschichte
- Der Mensch als Verwalter Gottes
- Warnung vor dem „Schätzesammeln“
- Perspektiven der Kirchengeschichte
- Verständnis von Betriebswirtschaftslehre
- Chancen und Gefahren des Wirtschaftens im Widerspruch?
- Wirtschaftliches Handeln in christlichen Einrichtungen
- Ziele und Werte als notwendige Voraussetzung
- Verantwortung gegenüber Gott und für den Nächsten
- Grundverständnisse von Wirtschaft und Anthropologie
- Umsetzung in der Praxis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit wirtschaftliches Handeln in christlichen Einrichtungen mit dem christlichen Selbstverständnis und dem Wert der Nächstenliebe vereinbar ist. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, ob und in welchem Umfang christliche Einrichtungen Elemente der Betriebswirtschaftslehre (BWL) anwenden dürfen.
- Die Bedeutung des Menschen als Verwalter Gottes in der biblischen Tradition
- Die ethischen Aspekte des Wirtschaftens im Kontext der Nächstenliebe
- Die Herausforderungen der wirtschaftlichen Orientierung für christliche Einrichtungen
- Die Rolle der Betriebswirtschaftslehre im Kontext christlicher Werte
- Die Umsetzung wirtschaftlicher Prinzipien in der Praxis christlicher Einrichtungen
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die aktuelle wirtschaftliche Situation, die auch christliche Einrichtungen betrifft. Es werden Herausforderungen wie sinkende Einnahmen und steigende Ausgabenbelastung sowie der Konflikt zwischen wirtschaftlicher Orientierung und christlichen Werten dargestellt.
Das zweite Kapitel setzt sich mit dem Konzept der Wirtschaftlichkeit in Bibel und Kirchengeschichte auseinander. Es beleuchtet das biblische Bild vom Menschen als Verwalter Gottes und die Bedeutung der Verantwortung für die Ressourcen, die Gott uns anvertraut.
Das dritte Kapitel befasst sich mit dem Verständnis von Betriebswirtschaftslehre und analysiert die Chancen und Gefahren, die sich aus der Anwendung wirtschaftlicher Prinzipien in christlichen Einrichtungen ergeben.
Das vierte Kapitel untersucht die ethischen Aspekte des wirtschaftlichen Handelns in christlichen Einrichtungen. Dabei wird die Frage nach dem Verhältnis zwischen Wirtschaftlichkeit und Nächstenliebe beleuchtet.
Das fünfte Kapitel analysiert die konkrete Umsetzung wirtschaftlicher Prinzipien in der Praxis christlicher Einrichtungen und die Herausforderungen, die sich dabei stellen.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen dieser Arbeit sind Wirtschaftlichkeit, Nächstenliebe, Betriebswirtschaftslehre, christliche Einrichtungen, Verwalter Gottes, Verantwortung, ethisches Handeln, Ressourcen, und die Anwendung wirtschaftlicher Prinzipien im Kontext christlicher Werte.
Häufig gestellte Fragen
Dürfen christliche Einrichtungen wirtschaftlich orientiert sein?
Ja, die Arbeit argumentiert, dass wirtschaftliches Handeln notwendig ist, aber immer im Einklang mit christlichen Werten wie Nächstenliebe und Ehrlichkeit stehen muss.
Was bedeutet das biblische Bild des Menschen als "Verwalter Gottes"?
Es impliziert die Verantwortung, mit den anvertrauten Ressourcen (Geld, Zeit, Material) sorgsam und im Sinne der göttlichen Schöpfung umzugehen.
Ist der Einkauf bei Billig-Discountern für NPOs ethisch vertretbar?
Dies wird kritisch diskutiert, da Niedrigpreise oft durch Marktverdrängung und unfaire Löhne erkauft werden, was dem Gebot der Nächstenliebe widersprechen kann.
Wie gehen NPOs mit sinkenden öffentlichen Zuschüssen um?
Sie setzen verstärkt auf Fundraising, Sponsoring und Fördervereine, was jedoch zu einem harten Konkurrenzkampf auf dem Spendenmarkt führt.
Was ist die größte Gefahr einer strikten wirtschaftlichen Orientierung?
Dass missionarische oder soziale Kernaufgaben zugunsten von lukrativeren, besser bezuschussten Aufgaben (z. B. Schulsozialarbeit) vernachlässigt werden.
- Quote paper
- Florian Karcher (Author), 2006, Betriebswirtschaft und Ethik in Non-Profit-Organisationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56922