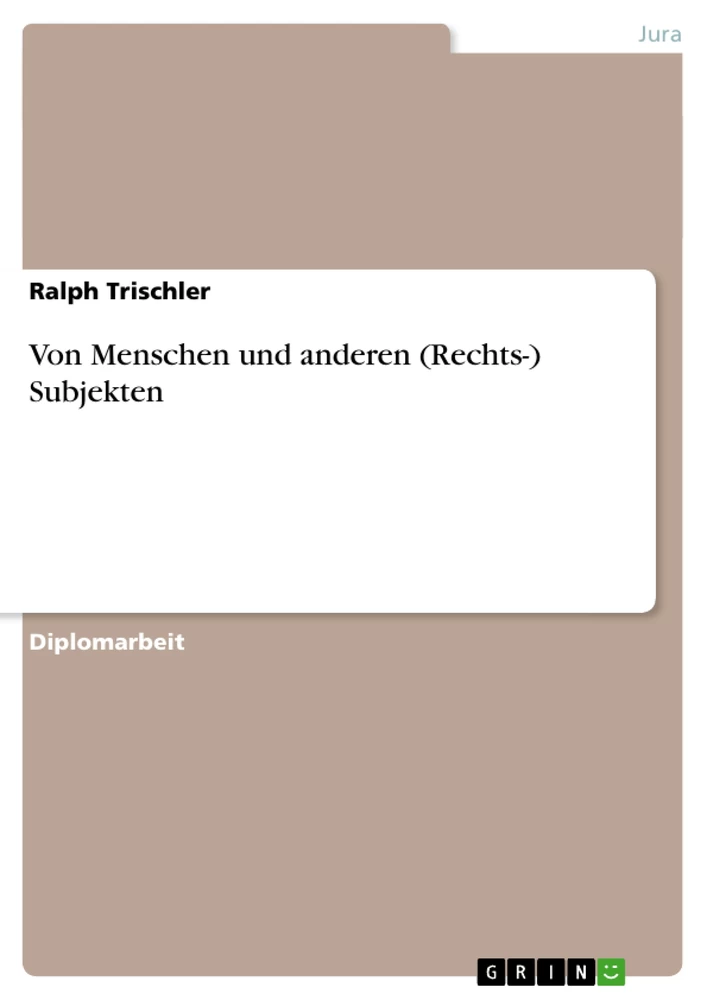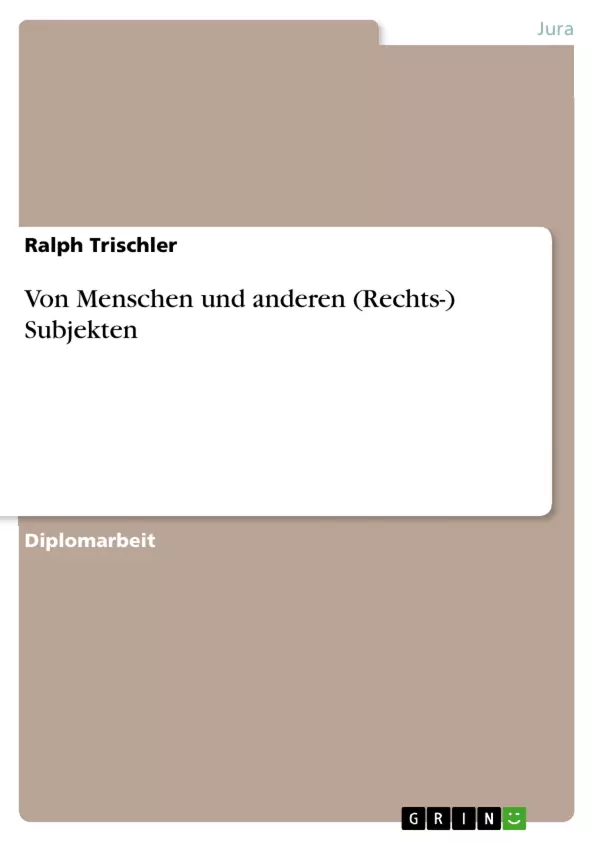Eine Einbeziehung der Tiere in die Ethik ist unabdingbar, sie lässt sich nicht nur dadurch bewerkstelligen, dass die bisher der Ethik zugrunde liegende Axiologie erweitert wird, sondern es bedarf einer grundsätzlich neuen Betrachtungsweise. Daraus muss sich konsequenterweise eine andere, neu überdachte Eingliederung und Berücksichtigung der Tiere in unser Rechtssystem ergeben.
Hauptbestreben dieser Arbeit wird es sein, diese These zu untermauern und Möglichkeiten zu diskutieren, welche Art der Tierrechtsentwicklung sinnvoll und erstrebenswert sein kann – ob zukünftig nur durch direkte Tierrechte, also durch Einbeziehung der Tiere in den Kreis der Träger subjektiver Rechte, oder auch durch indirekte Tierechte wie Schutzgesetze oder Haftungsgesetze erreicht werden kann.
Der Autor wird dabei die Meinung vertreten, dass sich trotz der daraus resultierenden Probleme, eine langfristige Entwicklung zum „Tier als Rechtssubjekt“ die einzig vernünftige Konsequenz sein kann. Fällt die Entscheidung in die andere Richtung und bleibt so der Grundgedanke des Tieres als Untertan des Menschen, als eine Entität ohne Anspruch auf Grundrechte, wird der Mensch, trotz etwaiger Bestrebungen nach besseren, indirekten Tier – und Naturschutzgesetzen, Gefahr laufen, das generelle Bestreben nach Gerechtigkeit innerhalb der eigenen Spezies Mensch als bloße Farce zu entlarven.
Der Autor vertritt somit die Meinung, dass ein entscheidender, rechtsethischer Fortschritt nicht ohne Berücksichtigung und Einbeziehung anderer Spezies in den universalen Kreis von Grundrechtsträgern erreicht werden kann.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Kapitel 1. Die traditionelle Axiologie und ihre Stützen
- 1.1 Die Säule der Gottesebenbildlichkeit“ (I)
- 1.1.1 Die logische Dekonstruktion von Säule I
- 1.1.2 Die tierische\" Dekonstruktion von Säule I
- 1.2 Die Säule der Vernunft“ (II)
- 1.2.1 Die logische Dekonstruktion von Säule II
- 1.2.2 Die tierische\" Dekonstruktion von Säule II
- 1.3 Die Säule des „desengagierten Wertesystems“ (III)
- 1.3.1 Die logische und „tierische\" Dekonstruktion von Säule III
- Kapitel 2. Der Bruch mit der traditionellen Axiologie
- 2.1 Die Theorie(en) von Peter Singer
- 2.1.1 Exkurs: Das Argument der Ersetzbarkeit oder die Tötungsfrage
- 2.2 Die Theorie von Jean-Claude Wolf
- Kapitel 3
- 3.1 Vorbemerkungen
- 3.2 Der Begriff der pathozentrischen Rechtstheorie
- 3.3 Wozu eine pathozentrische Rechtstheorie?
- 3.4 Wieso eigentlich Eigenrechte?
- 3.4.1 Gegenüberstellung von Rechtssubjekten und Rechtsobjekten
- 3.4.2 Einblicke ins geltende österreichische Recht - der rechtliche Deckmantel des Schweigens
- 3.4.2.1 Das Zivilrecht und § 285 a ABGB als rechtspolitisches Ausrufezeichen oder rechtsdogmatische Sinnlosigkeit
- 3.4.2.2 Das öffentliche Recht und das Recht gewordene Sprichwort
- 3.4.2.3 Das Strafrecht mit illustren Beispielen um § 222 StGB
- 3.5 Argument der „ethischen Spirale“ am Beispiel der Menschenrechte
- 3.5.1 Der Kreis der Erweiterung: Die Rechte
- 3.5.2 Der Kreis der Erweiterung: Die Gruppen
- 3.6 Rechtsdogmatische Argumente
- 3.6.1 Argument der Interessen
- 3.6.2 Argument der Gleichheit
- 3.7 Das rechtspositivistische Argument
- 3.8 Das Naturrechtsargument
- 3.9 Das „konsequenter Anthropozentrismus ist im Grunde eigenrechtsbejahend” Argument
- 3.10 Bedeutung für Mensch und Tier
- 3.11 Ein Blick hinter die Tierrechte: weiterführende Theorien
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit strebt danach, die Einbeziehung von Tieren in die Ethik als unerlässlich zu erweisen. Sie argumentiert, dass dies nicht nur durch eine Erweiterung der bestehenden Axiologie erreichbar ist, sondern eine grundlegend neue Sichtweise erfordert. Daraus soll sich eine neu überdachte Integration und Berücksichtigung von Tieren im Rechtssystem ergeben.
- Kritik an der traditionellen Axiologie
- Die Rolle von Tieren in der Ethik
- Entwicklung einer pathozentrischen Rechtstheorie
- Das Konzept der Tierrechte
- Die Bedeutung von Gerechtigkeit zwischen Mensch und Tier
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 beleuchtet die traditionellen Säulen der Axiologie und zeigt deren Schwächen auf. Es analysiert die Gottesebenbildlichkeit und die Vernunft als Grundlage für die menschliche Sonderstellung und untersucht, wie diese Argumente durch die moderne Wissenschaft und die Berücksichtigung tierischer Fähigkeiten widerlegt werden.
Kapitel 2 beleuchtet die Theorien von Peter Singer und Jean-Claude Wolf, die sich mit der Frage der Tierrechte auseinandersetzen. Es wird das Argument der Ersetzbarkeit und die Tötungsfrage im Kontext der Tierethik diskutiert.
Kapitel 3 erörtert die Notwendigkeit einer pathozentrischen Rechtstheorie und die damit einhergehende Frage nach Eigenrechten für Tiere. Es werden die rechtlichen Verhältnisse in Österreich beleuchtet und die Notwendigkeit einer Erweiterung des Kreises der Rechtsträger herausgestellt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Arbeit sind Tierrechte, Axiologie, pathozentrische Rechtstheorie, Ethik, Anthropozentrismus, Rechtsphilosophie, Tierforschung, Rechtssubjektivität, Rechtsobjekt, Gerechtigkeit.
Häufig gestellte Fragen
Sollten Tiere eigene Rechtssubjekte sein?
Der Autor argumentiert, dass eine Weiterentwicklung des Rechts hin zum „Tier als Rechtssubjekt“ die einzig konsequente Folge einer gerechten Ethik ist, um Tiere nicht länger als reine Objekte zu behandeln.
Was ist eine pathozentrische Rechtstheorie?
Diese Theorie stellt die Leidensfähigkeit (Pathozentrik) in den Mittelpunkt und fordert, dass alle empfindungsfähigen Wesen aufgrund ihrer Interessen Schutz und Eigenrechte erhalten sollten.
Was kritisiert der Autor an der traditionellen Axiologie?
Er dekonstruiert die „Säulen“ der Gottesebenbildlichkeit und der Vernunft, die bisher dazu dienten, dem Menschen eine moralische Sonderstellung einzuräumen und Tiere rechtlos zu stellen.
Wie ist der aktuelle Status von Tieren im österreichischen Recht?
Obwohl § 285a ABGB besagt, dass Tiere keine Sachen sind, werden sie in der Praxis meist wie Rechtsobjekte behandelt, was der Autor als „rechtspolitische Sinnlosigkeit“ kritisiert.
Welche Rolle spielt Peter Singer in der Tierethik-Debatte?
Singer ist ein Pionier der modernen Tierethik, der das Prinzip der gleichen Interessenabwägung vertritt und die Tötungsfrage sowie das Argument der Ersetzbarkeit kritisch beleuchtet.
- Citar trabajo
- Ralph Trischler (Autor), 2001, Von Menschen und anderen (Rechts-) Subjekten, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5697