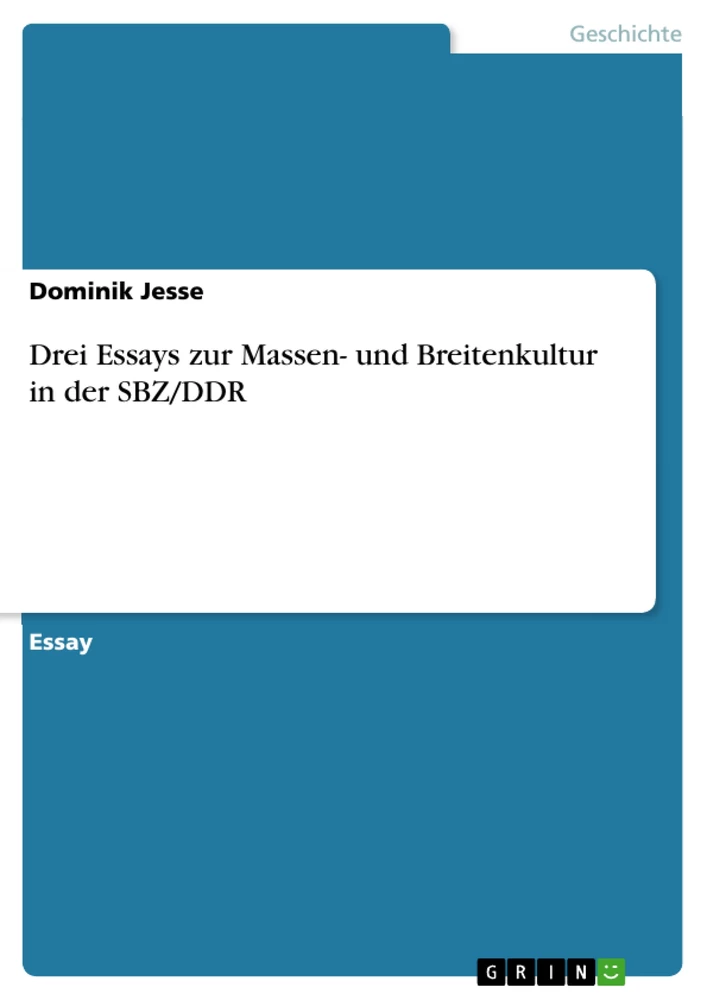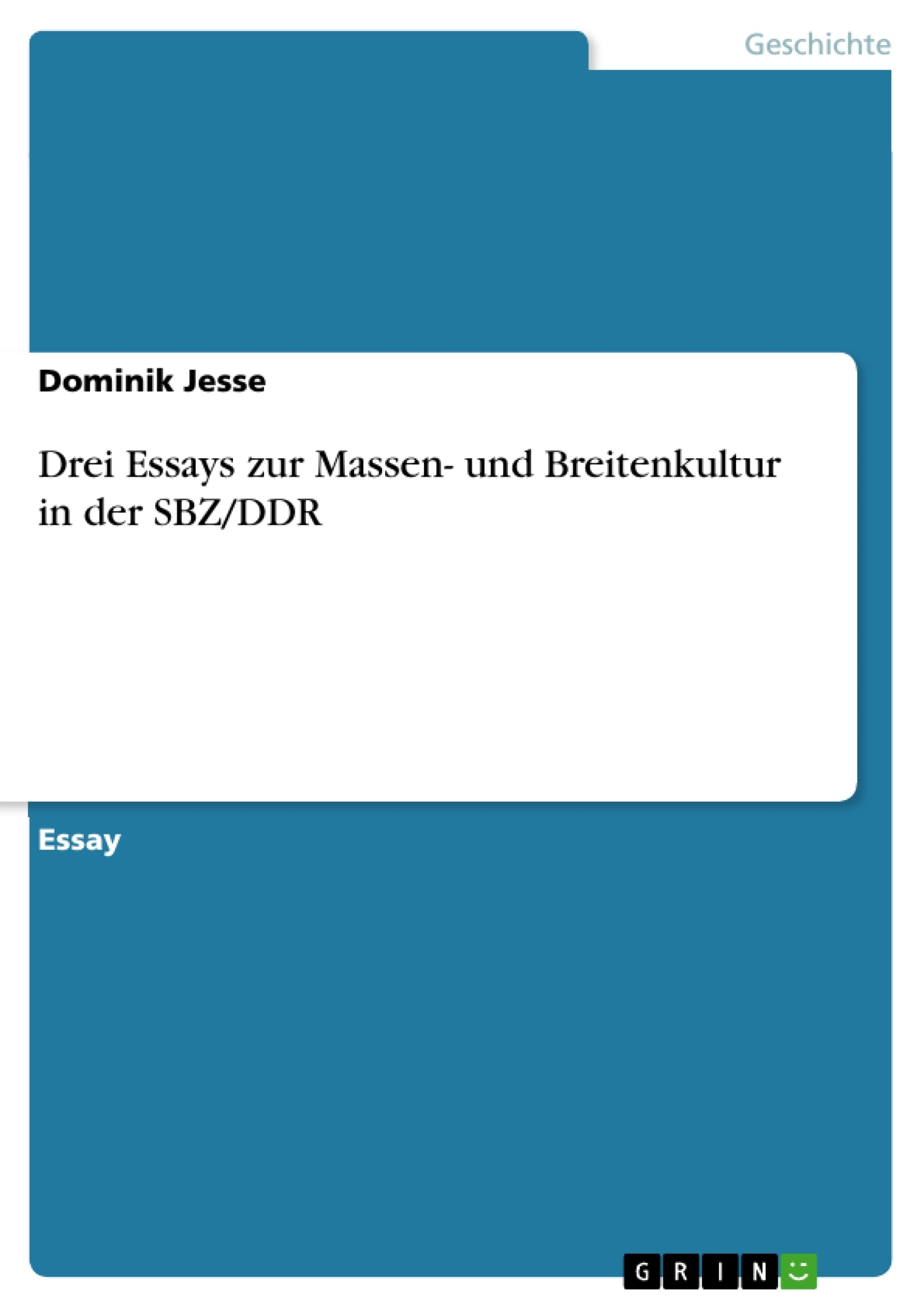Die folgenden Essays zur Massen- und Breitenkultur in der DDR behandeln mehr oder weniger klar abgrenzbar die drei kulturpolitischen Phasen des „anderen deutschen Staates.“ An drei ausgewählten Beispielen soll aufgezeigt werden, welche Rolle der Kultur als wichtiger Garant einer gesellschaftlichen Stabilität in der SBZ/DDR zukam und auf welche Weise die SED diese „kulturelle Machtstütze“ zu nutzen versuchte. Die drei Essays nähern sich diesem höchst interessanten Gegenstand auf völlig verschiedene Weise, aber immer mit dem Blick auf die historischen Zwänge, vor deren Hintergrund eine Einordnung stattfinden muss:
Im ersten Essay wird die Massen- und Breitenkultur in der Umbruchsgesellschaft SBZ/DDR (1945 bis 1957) mit Hilfe eines Blickes auf die Jugendweihe thematisiert, die gewiss keine Neuerfindung der Führungsschicht gewesen, sondern bereits im 19. Jahrhundert in freireligiösen Gemeinden und später auch von Organisationen der politischen Arbeiterbewegung zelebriert worden war. Neu aber ist gewesen, dass sie in der DDR zum Politikum wurde, zu einem vom Staat initiierten, überwachten und durchgeführten atheistischen Initiationsritus, der neben der Verpflichtung der Jugendlichen auf eine aktive Teilnahme am Aufbau des Sozialismus insbesondere eine Schwächung des kirchlichen Einflusses intendierte. Diese beabsichtigte Schwächung lief mit der Jugendweihe auf drei Ebenen zusammen: der kirchenpolitischen, der ideologischen und der rituellen.
Das zweite Essay bezieht sich auf die Massen- und Breitenkultur in der „Kulturgesellschaft“ DDR (1957/58 bis 1971) und wird anhand der „Bitterfelder Konferenz“ zu verdeutlichen suchen, wie die sicherlich berechtigte Forderung nach einem allgemeinen Zugang zur Kultur als Lebensnotwendigkeit aller durch ihre rigide Politisierung letzlich scheitern musste. Gezeigt wird auch, das die SED mit dem „Bitteren Feldwege“ den bis dahin ersten breiten und offiziellen Versuch unternommen hat, eine direkte Einflussnahme auf die Kunst und die Kultur in der DDR zu erlangen.
Das dritte Essay schließlich ist eigentlich auf die gesamte DDR-Geschichte bezogen, fußt aber v.a. in der Massen- und Breitenkultur der "Konsumgesellschaft" DDR (1971 -1989/90). Es soll untersucht werden, wie der politische Witz als wichtiger und fester Bestandteil der DDR-Alltagskultur funktionierte und welche Spezifika ihn vielleicht von den politischen Witzen anderer Gesellschaften unterschieden.
Inhaltsverzeichnis
- I. Essay. Massen- und Breitenkultur in der Umbruchsgesellschaft SBZ/DDR (1945 - 1957)
- I. Die Kirchenpolitik in der SBZ/DDR von 1945 bis 1955.
- II. Die ideologische Ebene
- III. Die rituelle Ebene...
- Kleines Fazit..
- II. Essay.
- Massen- und Breitenkultur in der „Kulturgesellschaft“ DDR (1957/58 - 1971)
- „Kumpel, greif zur Feder!\" – Die Kultur auf dem „Bitterfelder Weg“...........
- III. Essay.....
- Massen- und Breitenkultur in der \"Konsumgesellschaft\" DDR (1971 -1989/90).
- ,,Kenn'ste den schon? - Der Politische Witz in der DDR
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Massen- und Breitenkultur in der DDR. Der Autor untersucht die Entwicklung dieser Kulturphänomene in drei verschiedenen Epochen: der Umbruchsgesellschaft SBZ/DDR (1945-1957), der "Kulturgesellschaft" DDR (1957/58-1971) und der "Konsumgesellschaft" DDR (1971-1989/90). Dabei werden die verschiedenen politischen und gesellschaftlichen Einflussfaktoren auf die Massen- und Breitenkultur in der DDR analysiert.
- Die Etablierung der Jugendweihe als staatlich initiierter und überwachter Ritus zur Schwächung des kirchlichen Einflusses
- Der "Bitterfelder Weg" als Instrument zur kulturellen Mobilisierung und zur Förderung einer sozialistischen Kultur
- Der Politische Witz als Form des Widerstands und der Kritik an den politischen Verhältnissen in der DDR
Zusammenfassung der Kapitel
I. Essay. Massen- und Breitenkultur in der Umbruchsgesellschaft SBZ/DDR (1945 - 1957)
Der erste Essay befasst sich mit der Etablierung der Jugendweihe in der DDR. Der Autor untersucht die politischen und gesellschaftlichen Hintergründe der Einführung dieses Ritus, der in der SED-Doktrin als Gegenstück zur christlichen Konfirmation und Firmung verstanden wurde. Dabei wird die Jugendweihe als Instrument zur Schwächung des kirchlichen Einflusses und zur Förderung der staatlichen Ideologie betrachtet. Die Analyse konzentriert sich auf die drei Ebenen der Kirchenpolitik, der ideologischen und der rituellen Ebene.
II. Essay. Massen- und Breitenkultur in der „Kulturgesellschaft“ DDR (1957/58 - 1971)
Der zweite Essay beschäftigt sich mit dem "Bitterfelder Weg", einer kulturellen Initiative der SED, die im Jahr 1959 ihren Anfang nahm. Ziel des "Bitterfelder Weges" war die Förderung einer sozialistischen Kultur, die aus dem Leben der Arbeiterklasse und dem Kampf für den Sozialismus hervorgehen sollte. Der Autor analysiert die Rolle des "Bitterfelder Weges" in der kulturellen Produktion und im gesellschaftlichen Leben der DDR.
III. Essay. Massen- und Breitenkultur in der \"Konsumgesellschaft\" DDR (1971 -1989/90)
Der dritte Essay befasst sich mit dem Phänomen des Politischen Witzes in der DDR. Der Autor untersucht die Funktion des Witzes als Form des Widerstands und der Kritik an den politischen Verhältnissen in der DDR. Anhand ausgewählter Witze wird gezeigt, wie die Menschen durch den Witz ihren Unmut über die SED-Diktatur und die Lebensbedingungen in der DDR zum Ausdruck brachten.
Schlüsselwörter
Massenkultur, Breitenkultur, DDR, Jugendweihe, Bitterfelder Weg, Politischer Witz, Kirchenpolitik, Sozialismus, Kulturgesellschaft, Konsumgesellschaft, Widerstand, Kritik.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielte die Jugendweihe in der DDR?
Die Jugendweihe wurde als staatlich initiierter atheistischer Initiationsritus genutzt, um den Einfluss der Kirchen zu schwächen und Jugendliche ideologisch auf den Sozialismus zu verpflichten.
Was war der "Bitterfelder Weg"?
Es war eine kulturpolitische Initiative ab 1959 ("Kumpel, greif zur Feder!"), die die Trennung von Kunst und Leben aufheben sollte, indem Arbeiter zum Schreiben und Künstler in die Betriebe animiert wurden.
Welche Funktion hatte der politische Witz in der DDR?
Der politische Witz war ein fester Bestandteil der Alltagskultur und diente als Ventil für Kritik und Widerstand gegen die SED-Diktatur und die Lebensbedingungen.
In welche Phasen wird die DDR-Kulturpolitik in der Arbeit unterteilt?
Die Arbeit unterscheidet die Umbruchsgesellschaft (1945-1957), die Kulturgesellschaft (1957-1971) und die Konsumgesellschaft (1971-1989).
Warum scheiterte der "Bitterfelder Weg" letztlich?
Obwohl der Zugang zur Kultur für alle gefördert werden sollte, führte die rigide Politisierung und die staatliche Einflussnahme auf die Kunst zum Scheitern dieses Ansatzes.
- Citation du texte
- Dominik Jesse (Auteur), 2006, Drei Essays zur Massen- und Breitenkultur in der SBZ/DDR, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56970