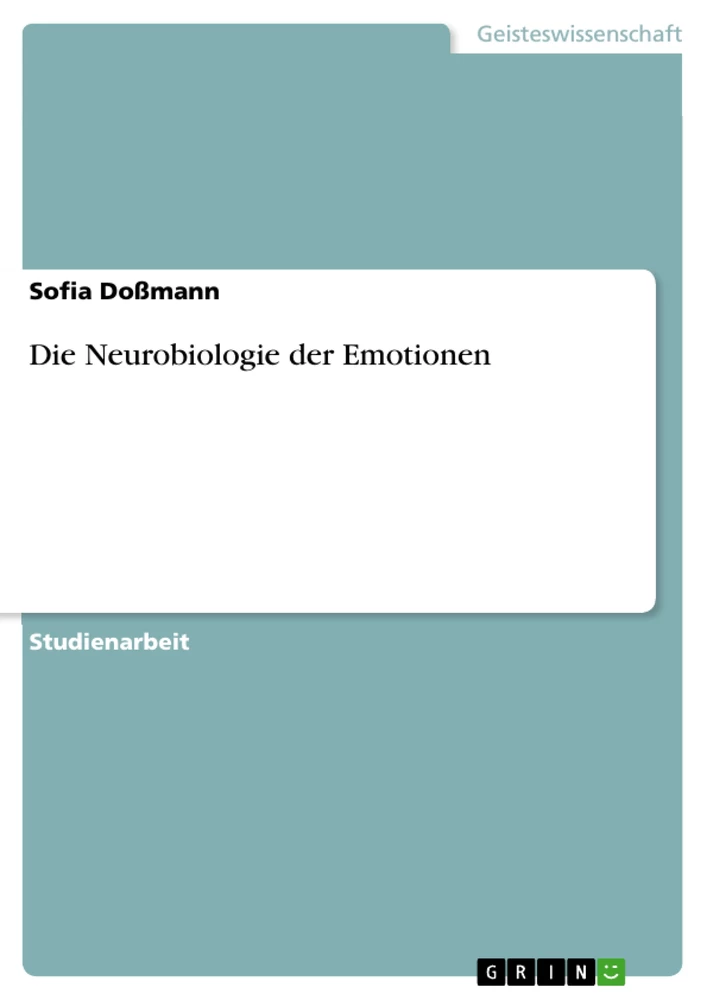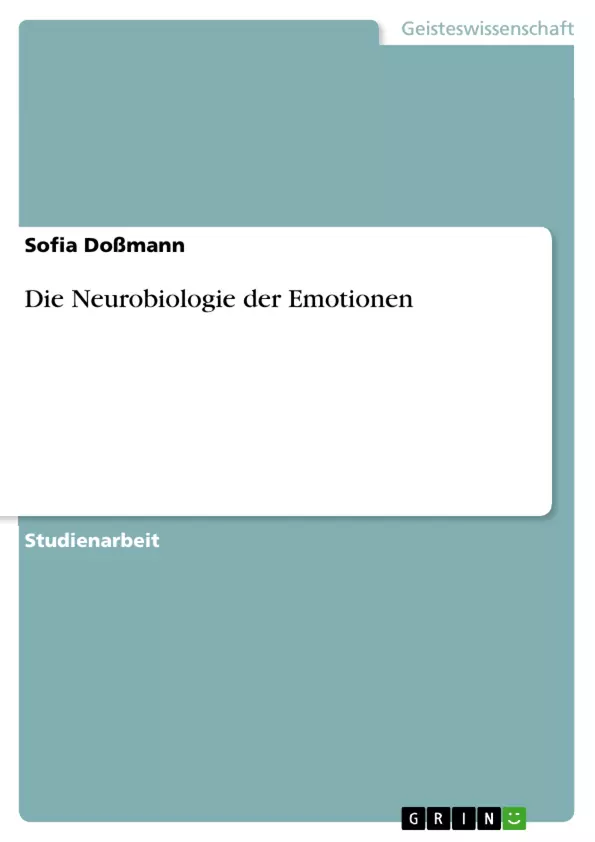Das momentane Interesse an der Erkundung von Phänomenen rund um die Emotionen ist so groß wie nie. In der Anfangszeit der institutionalisierten Psychologie um 1900 war die Beschäftigung mit der Emotion ein beliebtes Themengebiet. John B. Watson, William James, Wilhelm Wundt, Alexius Meinong, Carl Stumpf und William McDougall entwickelten unter anderem Theorien, die bis heute Einfluss haben. Im Zeitraum um 1950 ließ das Interesse der wissenschaftlichen Psychologie an der Emotion deutlich nach, da in dieser Phase die amerikanische Psychologie von den behavioristischen Positionen dominiert wurde. Dabei wurden ausschließlich beobachtbare Reize und Reaktionen als legitimer Gegenstand der Psychologie erachtet. Für den subjektiven Aspekt von Emotionen schien es keinen Platz mehr zu geben. In dieser Zeit sind so gut wie keine Lehrbücher der Emotionspsychologie oder Beiträge in der Fachliteratur erschienen. Jedoch nach dem Niedergang des Behaviorismus und mit der neuen kognitiven Reform der 60er Jahre wurde die Emotionspsychologie spätestens 1980 wieder zentraler Forschungsgegenstand. Zur Zeit greifen sogar Nachrichtenmagazine und Zeitungen solche Themen auf wie „Das Ich hinter der Stirn“, ein Artikel der Süddeutschen Zeitung in der Rubrik Wissen, in dem anhand der neuesten wissenschaftlichen Errungenschaften die Frage beantwortet wird, „ob sich in dem Nervenzellgeflecht ein „Ich“ finden lässt, das die geistigen Prozesse steuert.“2 Auch im Spiegel erschien am 6. März dieses Jahres unter der Überschrift „Zellen zum Gedankenlesen“ ein Interview mit dem amerikanischen Neurologen Vilayanur Ramachandran, der „die Entdeckung der Spiegelneuronen zur Grundlage der Psychologie [erklärt]“3. Während diesem Spiegel-Gespräch erläutert Ramachandran seine Ansichten von der Funktion der Spiegelneuronen. Wir bräuchten sie, meint er, um uns in andere Menschen einzufühlen und ihre Absichten ahnen zu können. Diese Einschätzung läuft automatisch und vom Verstand unbemerkt in unserem Gehirn ab.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Emotion und körperliche Prozesse
- 2.1 Phineas Gage
- 2.2 Elliot
- 3. Ein Blick in das Gehirn
- 3.1 Methoden der Gehirnforschung
- 3.2 Aufbau des Gehirns
- 4. Der Kurzschlussweg der Angst
- 4.1 Die Zwei-Wege-Theorie nach Joseph LeDoux
- 5. Konditionierung der Angst
- 5.1 Angstreaktionen nach unbewusst wahrgenommenen Reizen
- 5.2 Die Willensfreiheit des Menschen
- 6. Unterschiede in der Emotionalität der Menschen
- 6.1 Individuelle Unterschiede in der Emotionalität
- 6.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Emotionalität
- 7. Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die Neurobiologie der Emotionen, indem sie Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und Philosophie vereint. Ziel ist es, die Entstehung von Emotionen und deren neuronalen Grundlagen zu beleuchten und das aktuelle wissenschaftliche Interesse an diesem Thema zu kontextualisieren.
- Der Zusammenhang zwischen Emotionen und körperlichen Prozessen
- Methoden der Gehirnforschung und deren Anwendung auf Emotionsstudien
- Neurobiologische Erklärungen von Angst und deren Konditionierung
- Individuelle und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Emotionalität
- Der aktuelle Forschungsstand und die Bedeutung der Emotionen für das menschliche Handeln.
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung beschreibt das wiedererwachte Interesse an der Erforschung von Emotionen in der Wissenschaft, kontrastiert mit der behavioristischen Vernachlässigung des Themas in der Mitte des 20. Jahrhunderts. Sie verweist auf aktuelle Artikel in populärwissenschaftlichen Medien, die die Bedeutung der Erforschung des Gehirns und der neuronalen Grundlagen von Emotionen und Intuition hervorheben. Die Arbeit kündigt eine interdisziplinäre Herangehensweise an, um das "Mysterium Emotion" zu ergründen, wobei Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und Philosophie integriert werden sollen.
2. Emotion und körperliche Prozesse: Dieses Kapitel präsentiert die Fälle von Phineas Gage und Elliot, um den engen Zusammenhang zwischen körperlichen Prozessen und Emotionen zu verdeutlichen. Phineas Gage, nach einer Hirnverletzung, erfuhr gravierende Persönlichkeitsveränderungen trotz intakter kognitiver Fähigkeiten. Elliot, nach einer Hirnoperation, verlor seine emotionale Verbindung zu seinen Entscheidungen, was seine rationalen Fähigkeiten beeinträchtigte. Diese Fälle unterstreichen Damasios These, dass das Gehirn auf körperliche und emotionale Rückkopplung angewiesen ist und die Wahrnehmung von Gefühlen auf der Abstimmung des Gehirns mit den körperlichen Reaktionen beruht.
3. Ein Blick in das Gehirn: Dieses Kapitel beschreibt verschiedene Methoden der Gehirnforschung, beginnend mit der Untersuchung von Läsionen und der gezielten Stimulation des Gehirns. Es werden die Vor- und Nachteile verschiedener Verfahren wie Elektroenzephalographie (EEG), Positronen-Emissionstomographie (PET) und Kernspintomographie erläutert. Die Diskussion der Methoden verdeutlicht, wie die Forschung versucht, die neuronalen Korrelate von Emotionen und anderen kognitiven Prozessen zu identifizieren und zu lokalisieren.
Schlüsselwörter
Neurobiologie der Emotionen, Gehirnforschung, Emotionspsychologie, Phineas Gage, Elliot, Angstkonditionierung, Zwei-Wege-Theorie (LeDoux), individuelle Unterschiede, geschlechtsspezifische Unterschiede, Methoden der Hirnforschung (EEG, PET, Kernspintomographie), Damasio.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Neurobiologie der Emotionen
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Die Hausarbeit befasst sich mit der Neurobiologie der Emotionen und verbindet Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und Philosophie. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen Emotionen und körperlichen Prozessen, Methoden der Gehirnforschung im Kontext von Emotionsstudien, neurobiologische Erklärungen von Angst und deren Konditionierung, sowie individuelle und geschlechtsspezifische Unterschiede in der Emotionalität. Die Arbeit analysiert auch den aktuellen Forschungsstand und die Bedeutung von Emotionen für menschliches Handeln.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit ist in sieben Kapitel gegliedert: Einleitung, Emotion und körperliche Prozesse (inkl. Fallstudien zu Phineas Gage und Elliot), Ein Blick in das Gehirn (inkl. Methoden der Gehirnforschung), Der Kurzschlussweg der Angst (inkl. der Zwei-Wege-Theorie nach LeDoux), Konditionierung der Angst (inkl. unbewusster Reize und Willensfreiheit), Unterschiede in der Emotionalität der Menschen (inkl. individueller und geschlechtsspezifischer Unterschiede) und Schluss.
Welche Methoden der Gehirnforschung werden behandelt?
Die Hausarbeit beschreibt verschiedene Methoden der Gehirnforschung, darunter die Untersuchung von Läsionen, gezielte Hirnstimulation, Elektroenzephalographie (EEG), Positronen-Emissionstomographie (PET) und Kernspintomographie (MRT). Die Vor- und Nachteile dieser Verfahren werden im Detail erläutert.
Welche Fallstudien werden verwendet?
Die Hausarbeit verwendet die Fallstudien von Phineas Gage und Elliot, um den engen Zusammenhang zwischen körperlichen Prozessen und Emotionen zu verdeutlichen. Beide Fälle illustrieren die Auswirkungen von Hirnschädigungen auf die Emotionen und das Entscheidungsverhalten.
Welche Theorien werden in der Hausarbeit diskutiert?
Ein zentraler Bestandteil der Hausarbeit ist die Zwei-Wege-Theorie der Angst nach Joseph LeDoux, die den schnellen und den langsamen Weg der Angstverarbeitung im Gehirn beschreibt. Darüber hinaus wird die These von Damasio über die Abhängigkeit des Gehirns von körperlicher und emotionaler Rückkopplung diskutiert.
Welche individuellen und geschlechtsspezifischen Unterschiede in der Emotionalität werden betrachtet?
Die Hausarbeit untersucht individuelle Unterschiede in der Emotionalität und analysiert geschlechtsspezifische Unterschiede in der emotionalen Verarbeitung und Reaktion.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Hausarbeit?
Schlüsselwörter sind: Neurobiologie der Emotionen, Gehirnforschung, Emotionspsychologie, Phineas Gage, Elliot, Angstkonditionierung, Zwei-Wege-Theorie (LeDoux), individuelle Unterschiede, geschlechtsspezifische Unterschiede, Methoden der Hirnforschung (EEG, PET, Kernspintomographie), Damasio.
Welches Ziel verfolgt die Hausarbeit?
Das Ziel der Hausarbeit ist es, die Entstehung von Emotionen und deren neuronale Grundlagen zu beleuchten und das aktuelle wissenschaftliche Interesse an diesem Thema zu kontextualisieren. Sie verfolgt einen interdisziplinären Ansatz, der Erkenntnisse aus Medizin, Psychologie und Philosophie integriert.
- Quote paper
- Sofia Doßmann (Author), 2006, Die Neurobiologie der Emotionen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/56976