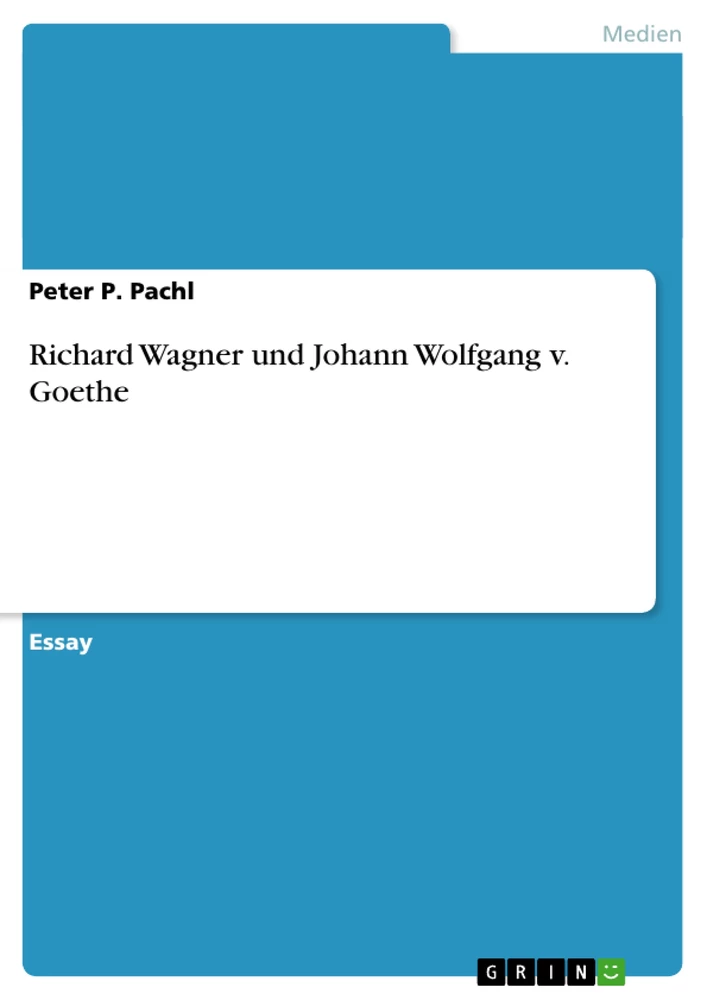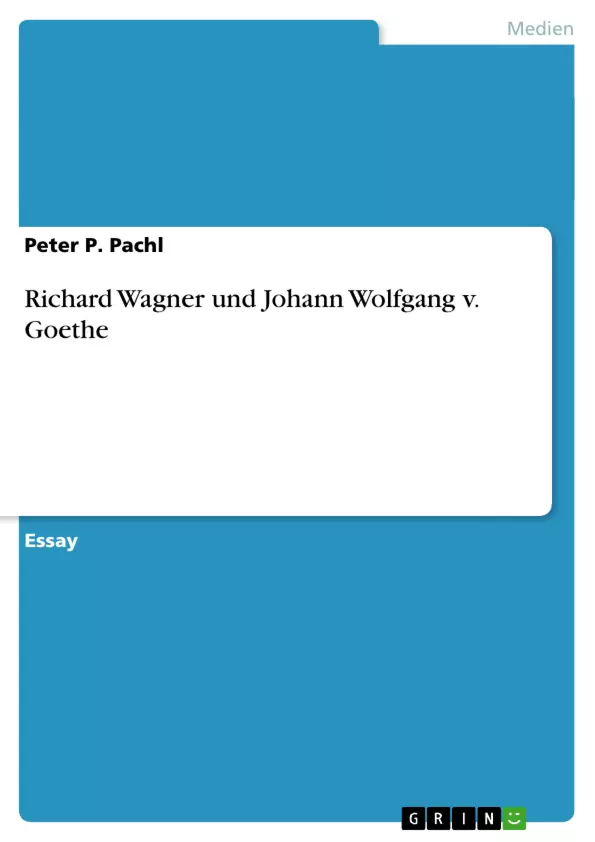Goethes Werke und Brief¬wechsel gehörten zeitlebens zu Wag¬ners Lektüre, wodurch ebenfalls Anregungen in sein eigenes Schaffen einflossen. Darüber hinaus suchte Wagner Erfahrungen und Erlebnisse Goethes nachzuemp¬finden. Wagner übernahm Goethesche Ge¬danken in seine Lebensphilosophie und erkannte in Goethe bereits Schopenhauersches Ideengut vorgeprägt. In seinen Träumen unterhielt er sich mit Goethe.
Der „Faust'-Rezeption Wagners gilt ein Schwerpunkt der Arbeit.
Für die Aufführung von Beethovens 9. Symphonie zog Wagner Zitate aus Goethes „Faust" heran, und in seinem theoretischen Hauptwerk „Oper und Drama" setzt er Goethes künstlerische Gestaltung des griechischen Lebens ebenfalls mit der Komposition von Beethovens „wichtig¬sten symphonischen Sätzen" gleich.
Goethes Oeuvre fand aber auch Niederschlag in Wagners Kompositionen, von den frühen„Sieben Kompositionen zu Goethes Faust“ über die geplante „Faust-Symphonie" zur „Faust-Ouvertüre" über das Motto zum späten Festmarsch für Nordamerika.
Immerhin dachte sich Wagner für den „Faust" eine dem Totaltheater ver¬wandte Bühne aus und diskutierte Fragen zur Kostümierung mit seiner Frau Cosima.
Weiter zieht die Arbeit Parallelen in der Arbeit beider Theaterdirektoren, wobei Eckermanns Gespräche auf der einen, Cosima Wagners Tagebücher auf der anderen Seite wichtige Quellen darstellen. Dabei kommt der Autor zu dem Ergebnis einer deutlichen Divergenz hinsichtlich der theatralischen Realisierung der Pläne beider Theaterdirektoren.
Inhaltsverzeichnis
- Präambel
- Wagner und Schumann
- Wagner und Goethe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieser Text untersucht die Beziehung zwischen Richard Wagner und seinen Zeitgenossen, insbesondere Robert Schumann und Johann Wolfgang von Goethe. Er beleuchtet Wagners Ansichten über Schumann, seine Interpretationen von Goethes Werk und die Einflüsse, die Goethes Leben und Werk auf Wagners Schaffen hatten.
- Wagners Korrespondenz mit Schumann und seine spätere Kritik an dessen musikalischem Stil
- Wagners Auseinandersetzung mit dem Einfluss des „Jüdischen Wesens“ auf die Musik
- Wagners Beziehung zu Goethes Werk, insbesondere „Faust“
- Die Rolle von Goethes Leben und Werk im Kontext von Wagners Autobiografie und Kompositionen
- Der Vergleich zwischen Wagners und Goethes Verhältnis zur Oper und Musik
Zusammenfassung der Kapitel
Präambel: Die Präambel beschreibt den Kontext eines Symposions über Wagners Beziehung zu anderen Künstlern, insbesondere seinen ambivalenten Umgang mit Robert Schumann und dessen Werk. Sie setzt den Rahmen für die nachfolgende Betrachtung von Wagners Ansichten und dessen Verhältnis zu seinen Zeitgenossen.
Wagner und Schumann: Dieser Abschnitt analysiert die wechselhafte Beziehung zwischen Wagner und Schumann. Der Text beleuchtet die anfänglich freundschaftliche Korrespondenz, die durch ein gemeinsames Werk, die Vertonung von Heines „Zwei Grenadiere“, geprägt ist. Im Kontrast dazu steht Wagners später harsche Kritik an Schumanns musikalischem Stil und seinen vermeintlichen Einfluss jüdischer Musik. Wagners Sichtweise wird als Beispiel für seine eigenwillige Musikgeschichtsdeutung präsentiert. Die Analyse vergleicht Schumanns frühes und spätes Schaffen, um Wagners Kritik zu kontextualisieren. Dieser Vergleich veranschaulicht Wagners Sichtweise auf die Entwicklung von Schumanns Kompositionsstil. Der Text verweist auf konkrete Stellen aus Wagners Schriften, um seine kritischen Äußerungen zu belegen. Das Ausbleiben von Kommentaren zu Schumanns „Faust“-Szenen in Wagners Schriften wird als bemerkenswert hervorgehoben.
Wagner und Goethe: Dieser Teil erforscht die vielschichtige Beziehung zwischen Wagner und Goethe. Er unterstreicht die Bedeutung von Wagners Onkel Adolph Wagner, der mit Goethe korrespondierte, sowie dessen Stiefvater Ludwig Geyer, für Wagners Verständnis von Goethe. Der Text zeigt auf, wie Goethes Einfluss sich in Wagners frühem Schaffen, besonders in seinen Kompositionen zu Goethes „Faust“, manifestierte. Die Analyse verweist auf die Entstehung von Wagners Kompositionen zu „Faust I“ und dessen Zusammenhang mit der Leipziger Aufführung in der seine Schwester mitspielte. Der Text beschreibt Wagners ambivalenten Bezug zu Goethes Werk, indem er dessen gespaltenes Verhältnis zur Musik und Wagners eigene Erfahrungen bei seiner ersten Begegnung mit Goethes Haus erwähnt. Wagner nutzte Auszüge aus Goethes „Faust“ um Beethovens 9. Symphonie zu interpretieren und für das Publikum zugänglich zu machen. Diese Interpretation verdeutlicht Wagners tiefe Auseinandersetzung mit Goethes Werk.
Schlüsselwörter
Richard Wagner, Robert Schumann, Johann Wolfgang von Goethe, Musikgeschichte, „Faust“, Jüdische Musik, Korrespondenz, Kompositionsstil, Musiktheorie, Goethes Einfluss auf Wagner, Wagner’s Autobiografie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Wagner, Schumann und Goethe
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Beziehungen Richard Wagners zu seinen Zeitgenossen Robert Schumann und Johann Wolfgang von Goethe. Sie analysiert Wagners Ansichten über Schumann, seine Interpretationen von Goethes Werk und den Einfluss von Goethes Leben und Werk auf Wagners Schaffen.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt unter anderem Wagners Korrespondenz mit Schumann und seine spätere Kritik an dessen musikalischem Stil; Wagners Auseinandersetzung mit dem Einfluss des „Jüdischen Wesens“ auf die Musik; Wagners Beziehung zu Goethes Werk, insbesondere „Faust“; die Rolle von Goethes Leben und Werk im Kontext von Wagners Autobiografie und Kompositionen; und den Vergleich zwischen Wagners und Goethes Verhältnis zur Oper und Musik.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Präambel, ein Kapitel zu Wagner und Schumann, und ein Kapitel zu Wagner und Goethe.
Was wird in der Präambel beschrieben?
Die Präambel beschreibt den Kontext eines Symposions über Wagners Beziehungen zu anderen Künstlern und legt den Rahmen für die Analyse von Wagners Ansichten und seinem Verhältnis zu seinen Zeitgenossen, insbesondere seinen ambivalenten Umgang mit Robert Schumann und dessen Werk.
Worüber handelt das Kapitel "Wagner und Schumann"?
Dieses Kapitel analysiert die wechselhafte Beziehung zwischen Wagner und Schumann, von der anfänglichen freundschaftlichen Korrespondenz (geprägt durch die gemeinsame Vertonung von Heines „Zwei Grenadiere“) bis hin zu Wagners späterer harter Kritik an Schumanns musikalischem Stil und dessen vermeintlichem Einfluss jüdischer Musik. Es vergleicht Schumanns frühes und spätes Schaffen, um Wagners Kritik zu kontextualisieren und verweist auf konkrete Stellen aus Wagners Schriften.
Worüber handelt das Kapitel "Wagner und Goethe"?
Dieser Teil erforscht die vielschichtige Beziehung zwischen Wagner und Goethe, unter Berücksichtigung des Einflusses von Wagners Onkel und Stiefvater. Er zeigt, wie Goethes Einfluss sich in Wagners frühem Schaffen, insbesondere in seinen Kompositionen zu Goethes „Faust“, manifestierte. Die Analyse beleuchtet Wagners ambivalenten Bezug zu Goethes Werk und dessen gespaltenes Verhältnis zur Musik.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Richard Wagner, Robert Schumann, Johann Wolfgang von Goethe, Musikgeschichte, „Faust“, Jüdische Musik, Korrespondenz, Kompositionsstil, Musiktheorie, Goethes Einfluss auf Wagner, Wagners Autobiografie.
Für wen ist diese Arbeit gedacht?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt und dient der Analyse von Themen in einer strukturierten und professionellen Weise.
- Citation du texte
- Prof. Dr. Peter P. Pachl (Auteur), 2006, Richard Wagner und Johann Wolfgang v. Goethe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57072