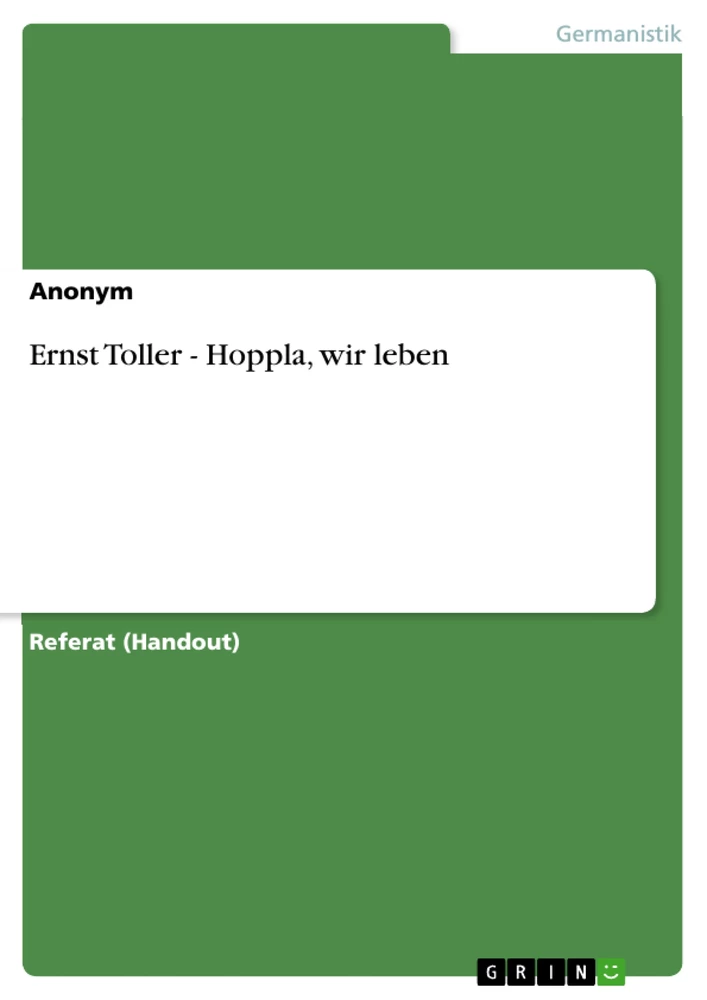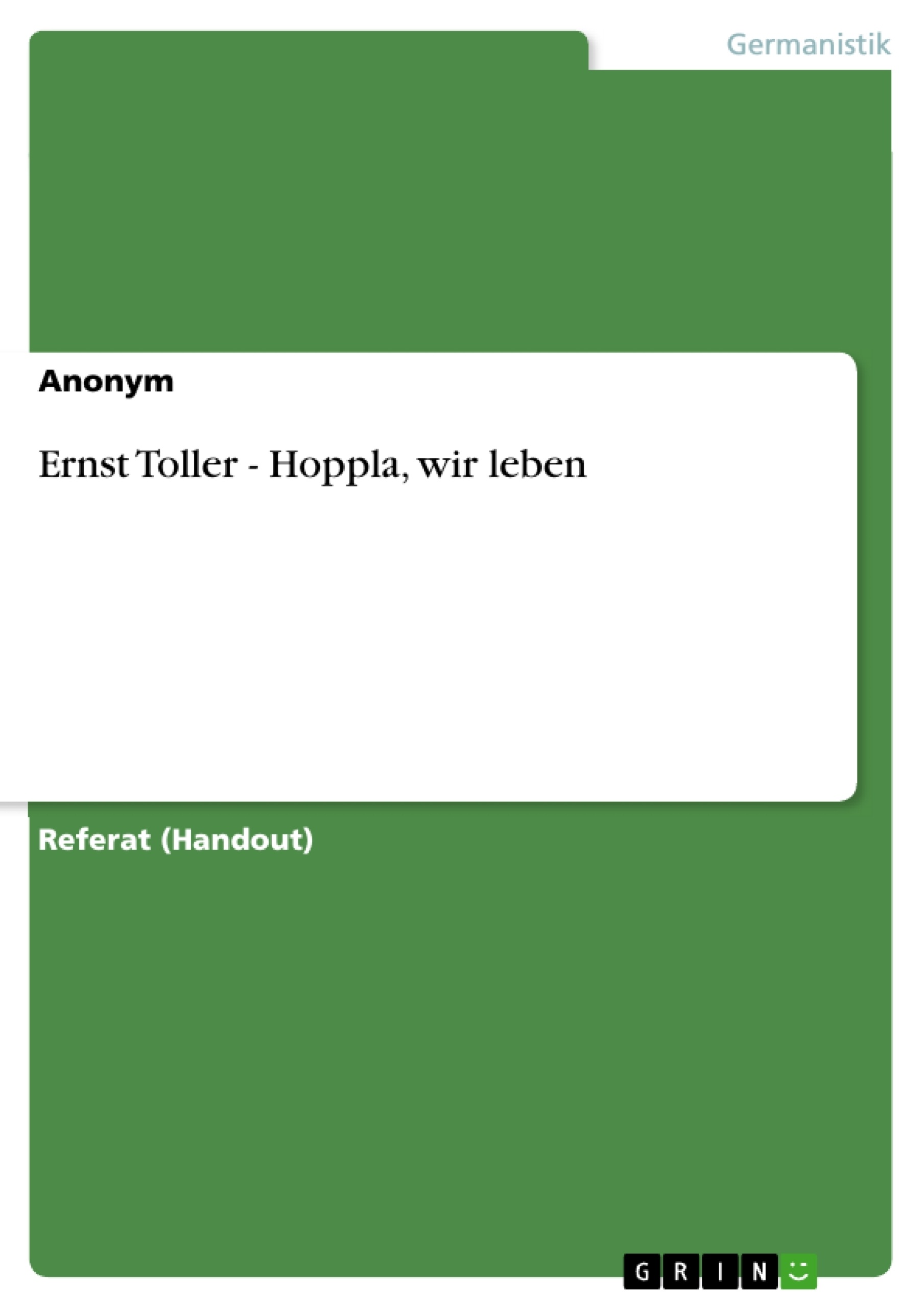Thema : Ernst Toller : „Hoppla, wir leben“
I. Biographische Angaben zum Autor
* 1.Dez. 1893 in der ostpreußischen Kleinstadt Samotschin als ältester Sohn des jüdischen Kaufmanns Max Toller und dessen Frau Ida
+ 22.Mai 1939 Selbstmord durch Erhängen im New Yorker Hotel Mayflower
Schon in seiner Kindheit befand sich T. am Rande der Gesellschaft, da die T.s einer winzigen ethnisch- religiösen Minorität angehörten, der mosaischen Gemeinde. Das Verhältnis zwischen den drei sehr unterschiedlich geprägten Bevölkerungsgruppen Deutsche, Juden und Polen war in seiner Heimat problematisch und vorurteilsbehaftet.
Seit 1900: T. ist Schüler einer „höheren Privatschule für Knaben des deutschen Bevölkerungsteils“.
Um 1905: Auf Geheiß des Vaters besucht T. das königlich-preußische Realgymnasium in der Bezirkshauptstadt Bromberg, das er 1913 mit Abitur verläßt. Aus dieser Zeit sind erste dichterische Versuche bekannt, außerdem gehörte T. einem literarischen Schülerverein an und hatte eine Vorliebe für verbotene naturalistische Autoren wie Hauptmann, Ibsen, Strindberg und Wedekind.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Biographische Angaben zum Autor
- Politisches und literarisches Selbstverständnis des Autors
- Wirkungsabsicht
- Geschichte des Werkes
- Inhalt
- Dramenanalyse
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ernst Tollers „Hoppla, wir leben!“ ist ein sozialkritisches Drama, das die gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse in der Weimarer Republik beleuchtet. Toller kritisiert die scheinbare Demokratie, den wachsenden Nationalismus und die Verzweiflung der Arbeiterklasse. Das Stück zeichnet ein düsteres Bild der Zeit, in der die Menschen aus den Fehlern der Vergangenheit nichts gelernt haben und die Gesellschaft vor den Gefahren des Faschismus steht.
- Kritik an der Weimarer Republik
- Das Scheitern der Revolution
- Die Gefahr des Faschismus
- Die Verzweiflung der Arbeiterklasse
- Der Kampf für soziale Gerechtigkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Biographische Angaben zum Autor
Dieser Abschnitt beleuchtet die Lebensgeschichte von Ernst Toller, beginnend mit seiner Kindheit in Ostpreußen bis hin zu seinem Selbstmord im Jahr 1939. Es werden wichtige Stationen seines Lebens und seine politisch-gesellschaftlichen Einflüsse dargestellt.
Politisches und literarisches Selbstverständnis des Autors
Hier wird Tollers sozialistische und pazifistische Gesinnung sowie seine Überzeugung von der gesellschaftsverändernden Kraft der Kunst erläutert. Toller sah die Aufgabe des Schriftstellers darin, die „Idee der Menschlichkeit“ zu gestalten und zu fördern.
Wirkungsabsicht
Dieser Abschnitt beschäftigt sich mit Tollers Ziel, die Scheinheiligkeit der Weimarer Republik aufzudecken und die Gefahren des Nationalismus und des Faschismus zu beleuchten. Er kritisiert die politische Apathie der Gesellschaft und die Resignation der Arbeiterklasse.
Geschichte des Werkes
Hier wird die Entstehung und die Rezeption von „Hoppla, wir leben!“ beschrieben, von den ersten Entwürfen bis zur Uraufführung im Jahr 1927. Es werden auch die Konflikte zwischen Toller und dem Regisseur Erwin Piscator bezüglich der Inszenierung des Stückes beleuchtet.
Inhalt
Dieser Abschnitt fasst die Handlung des Stückes zusammen, wobei die zentrale Figur Karl Thomas, der nach einem gescheiterten Volksaufstand im Irrenhaus sitzt, im Mittelpunkt steht. Die Geschichte zeigt, wie Thomas mit der erschütternden Realität der Weimarer Republik konfrontiert wird und seinen Kampf für soziale Gerechtigkeit fortsetzt. Die Handlung führt zu einer tragischen Konfrontation zwischen Thomas und dem System, die mit seinem Selbstmord im Gefängnis endet.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter von „Hoppla, wir leben!“ umfassen die Weimarer Republik, Sozialismus, Pazifismus, Gesellschaftskritik, Kulturkritik, Faschismus, Revolution, Verzweiflung, Selbstmord, und die „Idee der Menschlichkeit“. Tollers Werk ist ein Spiegelbild seiner Zeit und behandelt wichtige Themen, die auch heute noch relevant sind.
Häufig gestellte Fragen
Wer war Ernst Toller?
Ernst Toller (1893–1939) war ein bedeutender deutsch-jüdischer Dramatiker, Sozialist und Pazifist, der vor allem für seine gesellschaftskritischen Werke bekannt ist.
Wovon handelt das Drama „Hoppla, wir leben!“?
Das Stück thematisiert das Scheitern der Revolution und die gesellschaftlichen Verhältnisse in der Weimarer Republik, gespiegelt an der Figur Karl Thomas.
Welche politischen Themen kritisiert Toller in dem Werk?
Er kritisiert die politische Apathie, den wachsenden Nationalismus, die soziale Ungerechtigkeit und die drohende Gefahr des Faschismus.
Was war Tollers literarisches Selbstverständnis?
Toller sah die Kunst als Mittel zur gesellschaftlichen Veränderung und wollte durch seine Werke die „Idee der Menschlichkeit“ fördern.
Wie endet die Geschichte der Hauptfigur Karl Thomas?
Die Handlung gipfelt in einer tragischen Konfrontation mit dem System und endet mit dem Selbstmord der Hauptfigur im Gefängnis.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 1997, Ernst Toller - Hoppla, wir leben, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/571