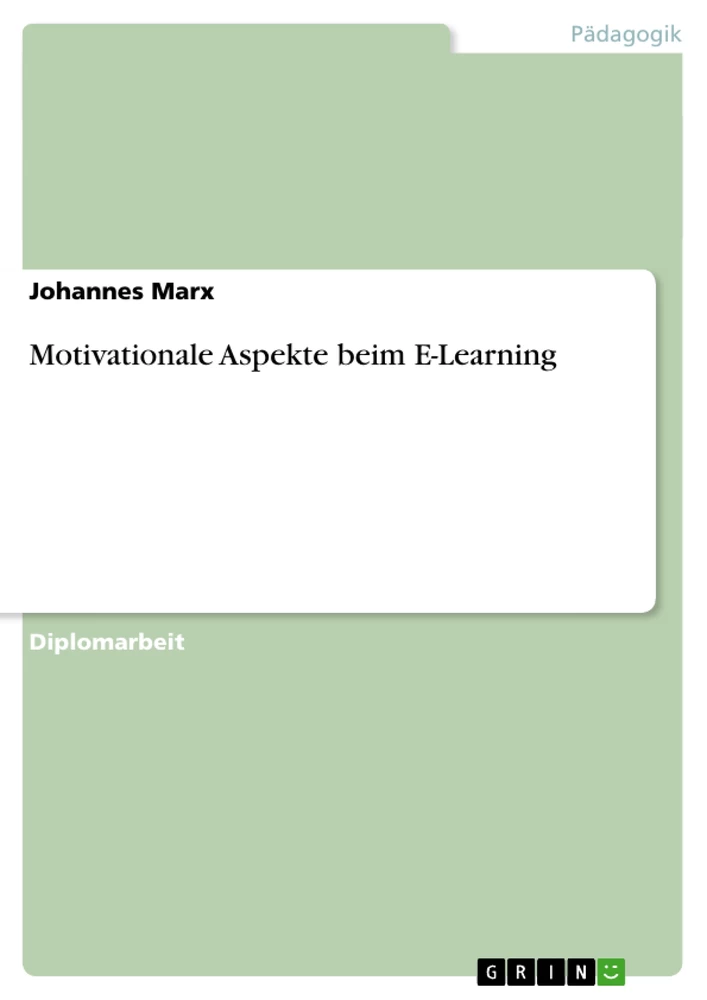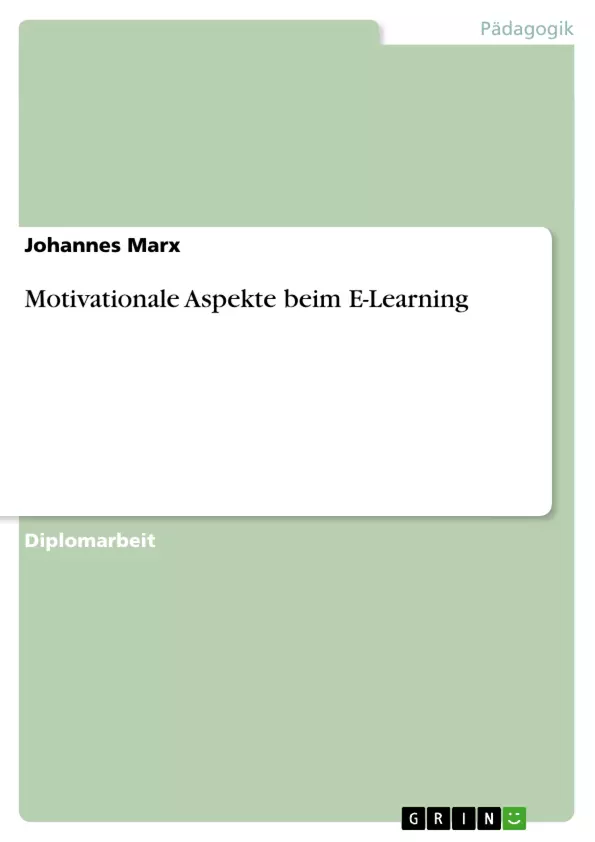«Der E-Learning-Boom stockt» titelte die NZZ am Sonntag vor rund einem Jahr, «E-Learning - Ernüchterung nach der Euphorie» lautete kürzlich eine Überschrift in der Fachzeitschrift Computerworld. Nachdem Ende der 1990er Jahre E-Learning in aller Munde war und in Zukunftsszenarien bereits das Ende der der klassischen Schule prophezeit wurde, wird das Lernen mit Computer und Internet heute kritischer, aber wohl auch realistischer beurteilt.
In den letzten rund zehn Jahren wurden viele Anstrengungen unternommen, um in der Grundschule, in Fachhochschulen und Universitäten das Lernen mit dem Computer zu fördern. Firmen haben Investitionen getätigt, um E-Learning-Massnahmen einzuführen und damit einen Teil der Weiterbildung der Mitarbeitenden an deren Arbeitsplatz zu verlegen. E-Learning wird, da ist man sich einig, weiterhin an Bedeutung gewinnen. Auch wenn einige der teilweise allzu hoch gesteckten Erwartungen enttäuscht wurden, ist der Computer als Lernmedium nicht mehr aus der Aus- und Weiterbildung wegzudenken.
Im Zentrum des Interesses stehen heute nicht mehr die technischen Möglichkeiten des Lernens mit Computer und Internet, sondern vermehrt Fragen zu Inhalt, Form und Didaktik von E-Learning. Es hat eine ‹Pädagogisierung› der E-Learning-Diskussion statt-gefunden. Die wissenschaftliche Beschäftigung mit der Nutzung von Informations- und Kommunikationstechnologien für Lehre und Lernen ist etabliert und auch in der Erwachsenenbildung nimmt die Bedeutung von E-Learning zu. Im Zusammenhang mit der oft zitierten Forderung nach lebenslangem Lernen und bedarfsgerechter Weiterbildung und der damit zusammenhängenden Diskussion um selbstbestimmtes Lernen taucht häufig auch der Begriff E-Learning auf.
E-Learning hat sich als Oberbegriff für verschiedene Formen von computerunterstütztem Lernen eingebürgert, umfasst allerdings eine Reihe teilweise recht unterschiedlicher Dinge. Unabhängig von Inhalt, Gestaltung und Organisation einer E-Learning-Veranstaltung gilt aber, dass in der Praxis die Lernenden am Computer häufig allein lernen. Dies liegt quasi in der Natur der Sache, ist doch gerade die freie Wahl von Ort und Zeit sowie die individuelle Bestimmung von Lerntempo und Lerndauer einer der wesentlichen Vorteile von E-Learning.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Persönliche Motivation für das Thema
- Fragestellung und Zielsetzung
- Aufbau der Arbeit
- Motivation und Lernen
- Motivation eine Begriffsklärung
- Motiv und Motivation
- Ein Prozessmodell der Motivation
- Leistungsmotivation
- Risikowahl-Modell
- Bezugsnorm-Orientierung
- Anschlussmotivation – soziale Bindung als Motiv
- Lernmotivation
- Lernen
- Was ist Lernmotivation?
- (Lern-)Motivation und Emotionen
- Intrinsische und extrinsische Motivation
- Unterschied zwischen intrinsisch und extrinsisch
- Selbstbestimmungstheorie von Deci & Ryan
- Flow-Erleben
- Interesse und Lernmotivation
- Zusammenfassung
- E-Learning
- Begriffsbestimmung von E-Learning
- Spezielle Merkmale von E-Learning
- E-Learning und selbstgesteuertes Lernen
- Zusammenfassung
- Förderung der Lernmotivation
- Zum Zusammenhang zwischen Theorie und Praxis
- Stellenwert der Motivation für den Lernerfolg
- Motivierung als didaktische Aufgabe
- Vorschläge zur Steigerung der Lernmotivation
- Motivationsförderung in verschiedenen Lern-Handlungsphasen
- Demotivierung verhindern
- Zusammenfassung
- Motivationsförderung im E-Learning
- Motivation durch Multimedialität und Neuigkeitseffekt
- Motivierende Elemente in Lernprogrammen
- Grundlegende Gestaltungsprinzipien
- Das ARCS-Modell
- Der FEASP-Ansatz – Lehrstrategien zur Beeinflussung von Emotionen
- Adaptive Lehr-/Lernsysteme, tutorielle Systeme
- Motivationsbeeinflussende Faktoren bei den Lernenden
- Lernprobleme beim E-Learning
- Subjektive Anforderungen an E-Learning – eine Typologie
- Motivationsfaktoren bei den Lehrenden
- Organisatorische Einbettung und Rahmenbedingungen von E-Learning
- Eine neue Rolle für die Lehrenden
- Kommunikation und Kooperation
- Motivation als Thema der Praxis-Literatur
- Zusammenfassung
- Umsetzung in die Praxis
- Zielsetzung und Rahmenbedingungen der Lehrveranstaltung
- Erfahrungen aus dem Pilotprojekt
- Motivationsfördernde Massnahmen
- Zusammenfassung und Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit der Motivation von Lernenden im E-Learning. Sie soll zum einen die theoretischen Grundlagen der Motivation im Allgemeinen und der Lernmotivation im Speziellen erläutern. Zum anderen soll die Arbeit praktische Ansätze zur Förderung der Lernmotivation im E-Learning aufzeigen. Dabei liegt der Fokus auf der Gestaltung von E-Learning-Programmen und der Rolle der Lehrenden.
- Theoretische Grundlagen der Motivation und Lernmotivation
- Einflussfaktoren auf die Lernmotivation im E-Learning
- Praxisnahe Ansätze zur Steigerung der Lernmotivation
- Gestaltung von E-Learning-Programmen
- Rolle der Lehrenden bei der Motivationsförderung
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel beschäftigt sich mit dem Begriff der Motivation und stellt verschiedene Ansätze zur Erklärung von Motivation vor. Es werden insbesondere die Leistungsmotivation, die Anschlussmotivation und die Lernmotivation betrachtet.
- Das zweite Kapitel befasst sich mit dem Begriff des E-Learning und erläutert die spezifischen Merkmale von E-Learning.
- Das dritte Kapitel beleuchtet die Bedeutung der Motivation für den Lernerfolg und stellt verschiedene Ansätze zur Förderung der Lernmotivation vor. Es werden didaktische Aufgaben und Vorschläge zur Steigerung der Lernmotivation in verschiedenen Lernphasen vorgestellt.
- Das vierte Kapitel geht näher auf die Motivationsförderung im E-Learning ein. Es werden verschiedene Gestaltungselemente von Lernprogrammen sowie wichtige Faktoren bei den Lernenden und Lehrenden betrachtet.
- Das fünfte Kapitel beschäftigt sich mit der Umsetzung der theoretischen Erkenntnisse in die Praxis.
Schlüsselwörter
Motivation, Lernmotivation, E-Learning, computerunterstütztes Lernen, selbstgesteuertes Lernen, Gestaltung von Lernprogrammen, Lehrende, Lernende, didaktische Aufgabe, Flow-Erleben, Selbstbestimmungstheorie, Motivationstheorien, Praxisanwendungen.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen intrinsischer und extrinsischer Motivation?
Intrinsische Motivation kommt aus dem Inneren und der Freude an der Sache selbst, während extrinsische Motivation durch äußere Anreize wie Belohnungen oder Noten gesteuert wird.
Was bedeutet Flow-Erleben beim Lernen?
Flow-Erleben bezeichnet einen Zustand vollkommener Vertiefung in eine Tätigkeit, bei dem das Zeitgefühl verloren geht und die Anforderungen der Aufgabe optimal zu den eigenen Fähigkeiten passen.
Welche Rolle spielt das ARCS-Modell im E-Learning?
Das ARCS-Modell ist ein Gestaltungsansatz zur Steigerung der Motivation. Es steht für Attention (Aufmerksamkeit), Relevance (Relevanz), Confidence (Erfolgserwartung) und Satisfaction (Zufriedenheit).
Warum ist die Motivation im E-Learning besonders kritisch?
Da Lernende beim E-Learning oft allein am Computer sitzen, fehlen soziale Kontrollmechanismen. Selbststeuerung und individuelle Motivationsförderung sind daher essenziell für den Lernerfolg.
Wie können Lehrende die Lernmotivation online fördern?
Lehrende können Motivation durch multimediale Gestaltung, klare Zielformulierungen, tutorielle Unterstützung und die Förderung von Kommunikation und Kooperation zwischen den Lernenden steigern.
- Citation du texte
- lic. phil I Johannes Marx (Auteur), 2005, Motivationale Aspekte beim E-Learning, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57153