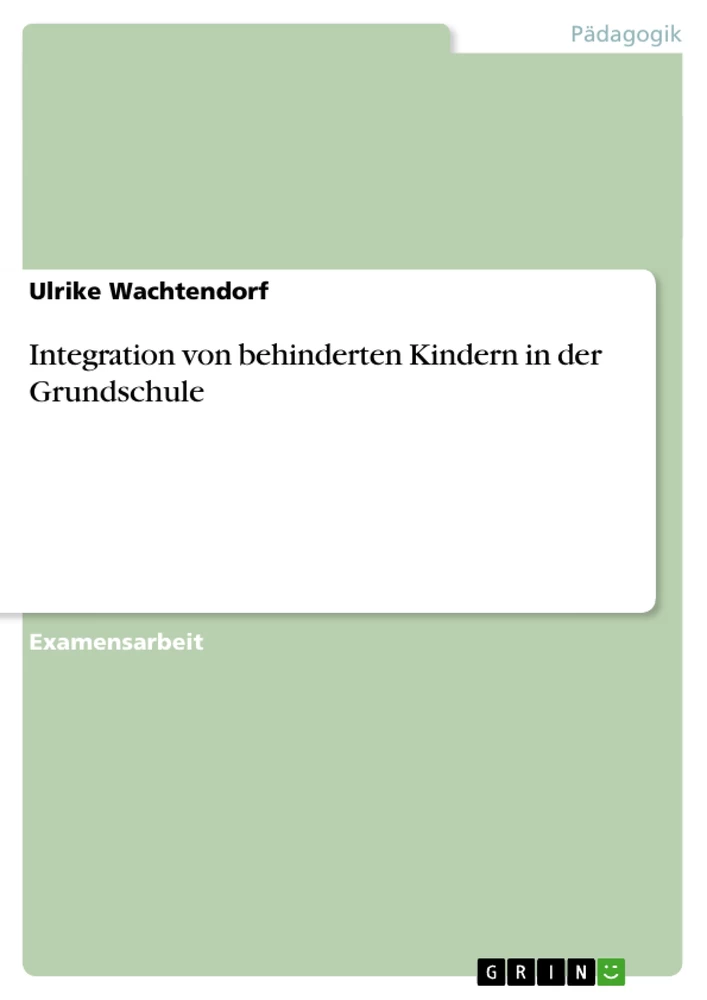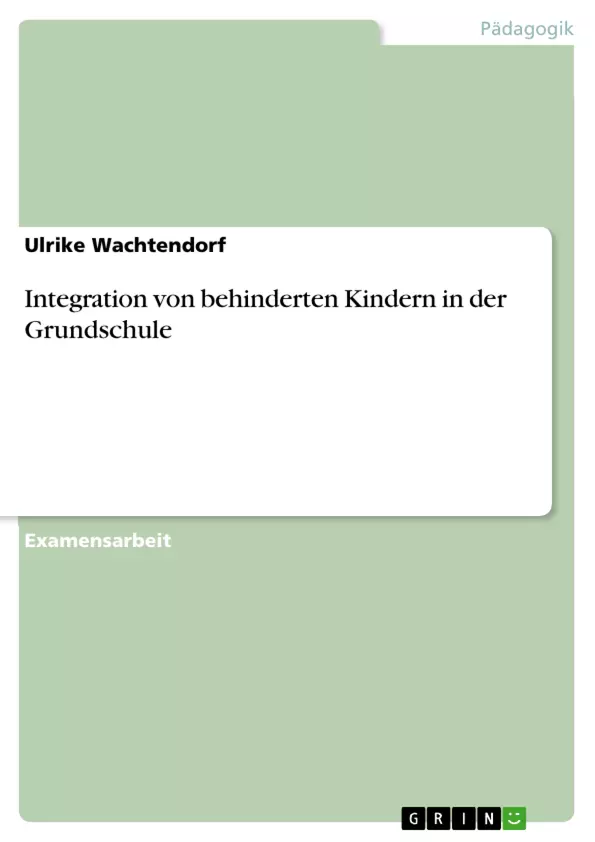Diese Arbeit dient der Dokumentation und Reflexion eines langwierigen und vielschichtigen Prozesses um die Öffnung der Grundschulen für behinderte Kinder. Es wird sowohl theoretisch diskutiert als auch auf konkrete und praktische Integrationsmerkmale verwiesen.
Der Leitgedanke besteht also darin, einen Einblick in die Historie des Förderschulwesens zu geben, um die gegenwärtige Diskussion und die aktuellen Intergrationsbestrebungen besser erfassen zu können.
Des Weiteren sollen die Möglichkeiten und Rahmenbedingungen für den gemeinsamen Unterricht sowie die Grenzen und Notwendigkeiten für Interation aufgzeigt und näher erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. BEGRIFFS ERLÄUTERUNGEN
- 2.1 Zu dem Begriff Integration
- 2.1.1 selektive und totale Integration
- 2.1.2 zielgleiche und zieldifferente Integration
- 2.2 Zu dem Begriff Behinderung
- 2.3 Zusammenfassung
- 3. HISTORISCHER RÜCKBLICK
- 3.1 Erste Erziehungsversuche behinderter Kinder bis zur Gründung der ersten Hilfsschulen
- 3.2 Sonderpädagogik und Faschismus
- 3.3 Die Entwicklungen in Sonderpädagogik nach zweiten Weltkrieg
- 3.4 Entwicklung der Integrationsdiskussion
- 3.5 Zusammenfassung
- 4. GEGENWÄRTIGE SITUATION
- 4.1 Zu den allgemeinen Zielen und Begründungen für Integration bzw. Nichtaussonderung
- 4.2 Zum aktuellen Stand der Integration am Beispiel eines Bundeslandes
- 4.2.1 Zum aktuellen Stand der Integration am Beispiel Niedersachsen
- 4.2.2 Lernen unter einem Dach - Niedersachsen macht Schule
- 4.3 Bildungspolitische und administrative Aspekte der Integration
- 4.3.1 Die Notwendigkeit einer Grundschulreform für die schulische Integration Behinderter
- 4.3.2 Die rechtliche Situation der nichtaussondernden Beschulung und die Rechtssprechung des Bundesverfassungsgerichtes
- 4.3.3 Die Sichtweise der politischen Parteien
- 4.4 Zusammenfassung
- 5. INTEGRATION KONKRET: SCHULISCHE RAHMNBEDINGUNGEN
- 5.1 Zur personellen Struktur in Integrationsklassen
- 5.1.2 Teamarbeit im integrativen Unterricht
- 5.2 Zur räumlichen Organisation
- 5.3 Zu den konzeptionellen Bedingungen eines integrativen Unterrichts
- 5.3.1 Innere Differenzierung
- 5.3.2 Projektarbeit
- 5.3.4 Wochen- und Tagesplanarbeit
- 5.3.5 Freie Arbeit
- 5.4 Zusammenfassung
- 6. KINDER IN INTEGRATIONSKLASSEN
- 6.1 Zusammensetzung von Integrationsklassen
- 6.2 Gemeinsames Leben und Lernen
- 6.3 Förderung der sozialen Integration
- 6.4 Schülerverhalten in Integrationsklassen
- 6.5 Zusammenfassung
- 7. ELTERARBEIT – ELTERNMITARBEIT
- 7.1 Elterninitiativen
- 7.2 Integration aus Sicht der Eltern
- 7.3 Zusammenfassung
- 8. KROTIK AN DER SCHULISCHEN UND GESELLSCHAFTLICHEN INTEGRATION
- 8.1 Möglichkeiten der schulischen Integration
- 8.2 Grenzen der schulischen Integration
- 8.3 Notwendigkeiten der schulischen und gesellschaftlichen Integration
- 8.4 Zusammenfassung
- 9. THESENARTIGE ZUSAMMENFASSUNG
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Hausarbeit befasst sich mit der Integration behinderter Kinder in die Grundschule und beleuchtet dabei den historischen Rückblick sowie die gegenwärtige Situation. Sie analysiert die Entwicklung der Integration und untersucht die Rahmenbedingungen für den gemeinsamen Unterricht sowie die Grenzen und Notwendigkeiten für Integration. Die Arbeit dient der Dokumentation und Reflexion eines langwierigen und vielschichtigen Prozesses um die Öffnung der Grundschulen für behinderte Kinder.
- Historische Entwicklung der Integration von behinderten Kindern in die Schule
- Gegenwärtige Situation der Integration in der Grundschule
- Schulische Rahmenbedingungen für die Integration
- Soziales Miteinander von behinderten und nichtbehinderten Kindern
- Grenzen und Herausforderungen der Integration
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Thematik ein und beleuchtet die Diskussion um die Integration von behinderten Kindern in die Grundschule. Kapitel 2 definiert die Begriffe Integration und Behinderung, um eine klare Grundlage für die weiteren Ausführungen zu schaffen. In Kapitel 3 wird ein historischer Rückblick auf die Entwicklung der Sonderpädagogik und die Entstehung der Integration gegeben. Kapitel 4 widmet sich der gegenwärtigen Situation der Integration, beleuchtet die allgemeinen Ziele und Begründungen sowie den aktuellen Stand in Niedersachsen. Kapitel 5 analysiert die schulischen Rahmenbedingungen für die Integration, unterteilt in die personelle Struktur, die räumliche Organisation und die konzeptionellen Bedingungen eines integrativen Unterrichts. Kapitel 6 fokussiert auf die Kinder in Integrationsklassen, beleuchtet ihre Zusammensetzung, das gemeinsame Leben und Lernen sowie die Förderung der sozialen Integration. Kapitel 7 beschäftigt sich mit der Elterarbeit und der Eltermitarbeit, einschließlich der Elterninitiativen und der Integration aus Sicht der Eltern. Kapitel 8 analysiert die Kritik an der schulischen und gesellschaftlichen Integration, beleuchtet die Möglichkeiten und Grenzen der schulischen Integration sowie die Notwendigkeiten für eine gelungene Integration.
Schlüsselwörter
Integration, Behinderung, Sonderpädagogik, Gemeinsames Lernen, Gemeinsames Leben, Schulische Rahmenbedingungen, Elterarbeit, Kritik, Grundschule, Niedersachsen
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen zielgleicher und zieldifferenter Integration?
Zielgleich bedeutet, dass behinderte Kinder dieselben Lernziele wie Nichtbehinderte verfolgen; zieldifferent bedeutet, dass sie nach ihren individuellen Möglichkeiten gefördert werden.
Welche Rahmenbedingungen sind für Integrationsklassen nötig?
Nötig sind personelle Ressourcen (Teamarbeit von Grundschul- und Förderschullehrern), räumliche Anpassungen und offene Unterrichtsformen.
Welche Unterrichtsformen fördern die Integration?
Die Arbeit nennt Freie Arbeit, Wochenplanarbeit, Projektarbeit und innere Differenzierung als zentrale konzeptionelle Bedingungen.
Wie reagieren Mitschüler in Integrationsklassen?
Die Arbeit untersucht das Schülerverhalten und stellt fest, dass gemeinsames Leben und Lernen das soziale Verständnis und die Toleranz fördert.
Welche Rolle spielen die Eltern bei der schulischen Integration?
Elterninitiativen waren oft die treibende Kraft für die Öffnung der Grundschulen; die Arbeit beleuchtet die Integration aus Sicht der betroffenen Eltern.
- Quote paper
- Ulrike Wachtendorf (Author), 2000, Integration von behinderten Kindern in der Grundschule, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/5727