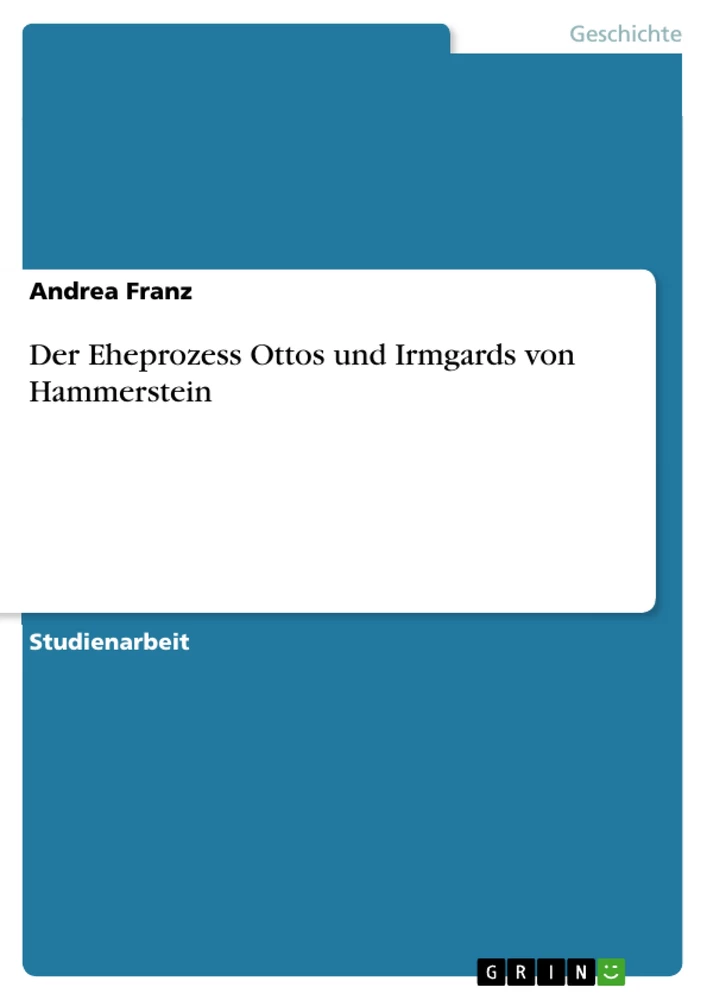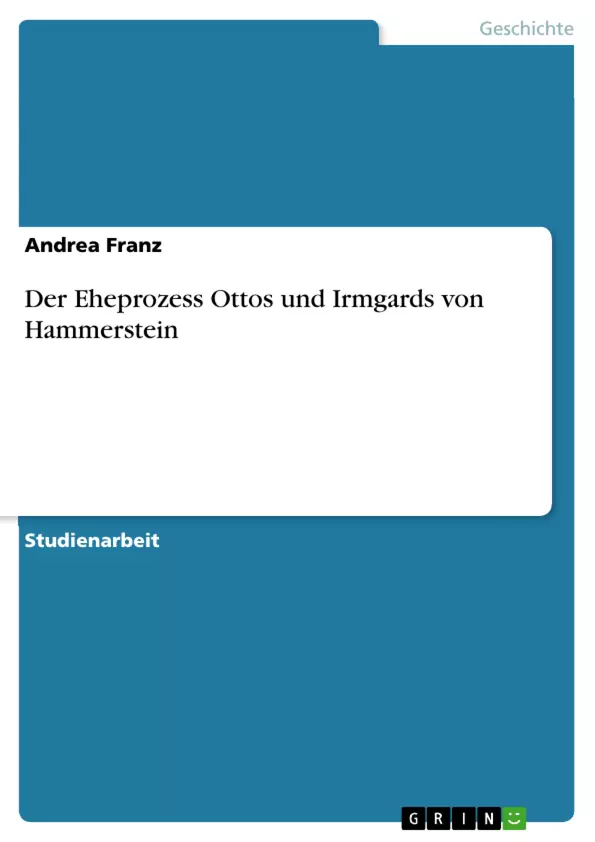Die Aufteilung der Macht um das frühmittelalterliche Reich findet zwischen der Kirche, dem Herrscher und den Adelsverbänden statt. Zu Letzteren gehören im Frühmittelalter die Konra-diner. Otto von Hammerstein ist der einzige volljährige Erbe, der die Linie der Konradiner weiterführen kann. Er vereint nach dem Tod seiner Verwandten und durch die Ehe mit Irm-gard Besitztümer in der Wetterau, in Franken, im Engersgau und die Burg Hammerstein unter sich. Diese geben ihm eine sichere Machtstellung in dem mittelalterlichen Herrschaftsgefüge. Sowohl die geistliche als auch die weltliche Autorität verlangen 1008 wiederholt die Exkom-munikation des Ehepaares auf Grund zu naher Verwandtschaft. Die Ehe im Frühmittelalter unterliegt genauen kirchlichen und politischen Vorstellungen. Getragen von einem traditio-nell, aber dürftig schriftlich überlieferten Recht ergibt sich die Vorstellung von der Ehe mit Ge- und Verboten. Nicht zuletzt sollen die Gesetze der Kirche, die Gebote Gottes, auf Erden durchgesetzt werden. Während der Herrschaft Heinrichs II. (1002-1024) kommt es zu einem auffälligen Interesse der weltlichen Autorität an kirchenpolitischen Entscheidungen. Durch verschiedene Synodalbeschlüsse seitens des Herrschers wird zu Beginn des elften Jahrhun-derts die Verwandtschaftsehe für unrechtmäßig erklärt. Eine solche gilt folglich als „matri-monium illicitum et irritum“ . Es zeichnet sich deutlich die beginnende Entwicklung des Ehe-rechts ab. Dieses bildet sich durch einzelne Präzedenzfälle heraus, wie etwa der Rechtsstreit um die Ehe von Otto und Irmgard von Hammerstein.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- oder: der Eheprozess Ottos und Irmgards von Hammerstein im Kontext Mittelalterlichen Historiographie
- Die Quellenlage
- oder: deren Ausschweigen über die Motive der Chronisten
- Der Eheprozess Ottos und Irmgards von Hammerstein
- Die Verwandtschaftsbeziehung des Ehepaares von Hammerstein
- oder: die unterschiedliche Zählung der Verwandtschaftsgrade
- Die Herrschaftspraxis Heinrichs II.
- oder: der Geistliche im weltlichen Gewandt
- Die Synode von Nimwegen
- oder: die Frage um das Fernbleiben des Ehepaares
- Die Ereignisse der Jahre 1018 - 1023
- oder: die Hammersteiner Fehde
- Die Wendung im Prozess
- oder: die Machtprobe zwischen Papst und Erzbischof
- Der Regierungswechsel
- oder: das Ende des Rechtshandels
- Die Verwandtschaftsbeziehung des Ehepaares von Hammerstein
- Zusammenfassung
- oder: der Präzedenzfall
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Eheprozess von Otto und Irmgard von Hammerstein im frühen 11. Jahrhundert. Sie analysiert die Hintergründe des Prozesses, die Rolle der verschiedenen Akteure, insbesondere die des Kaisers Heinrich II., und die Auswirkungen des Prozesses auf die Entwicklung des Eherechts im Mittelalter.
- Die Rolle des Kaisers Heinrich II. in der Durchsetzung kirchenrechtlicher Normen
- Der Einfluss des weltlichen Herrschers auf die geistliche Autorität
- Die Dynamik des Eherechts im frühen Mittelalter und seine Bedeutung für das Herrschaftsgefüge
- Der Eheprozess als Präzedenzfall für die Entwicklung des Eherechts im späteren Mittelalter
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt den Eheprozess von Otto und Irmgard von Hammerstein im Kontext des frühmittelalterlichen Herrschaftsgefüges dar. Es werden die wichtigsten Themen und Fragestellungen der Arbeit beleuchtet.
- Die Quellenlage: Dieses Kapitel beleuchtet die Quellenlage und die Problematik des Quellenmaterials. Es wird auf die unterschiedlichen Perspektiven der Chronisten und die Schwierigkeiten der Interpretation hingewiesen.
- Der Eheprozess Ottos und Irmgards von Hammerstein: Dieses Kapitel analysiert den Eheprozess im Detail. Es werden die Verwandtschaftsbeziehung des Paares, die Rolle Heinrichs II. und die Synode von Nimwegen beleuchtet.
- Die Hammersteiner Fehde: Dieses Kapitel beleuchtet die Ereignisse der Jahre 1018-1023 und stellt die Handlungsspielräume von Otto und Irmgard innerhalb der mittelalterlichen Adelsgesellschaft dar.
- Die Wendung im Prozess: Dieses Kapitel untersucht die Machtprobe zwischen Papst Benedikt VIII. und Erzbischof Aribo von Mainz, die eine entscheidende Wendung im Prozess einleitete.
- Der Regierungswechsel: Dieses Kapitel beleuchtet die Hintergründe der schnellen Beendigung des Prozesses nach dem Regierungswechsel von Heinrich II. zu Konrad II.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit dem Eheprozess von Otto und Irmgard von Hammerstein im frühen 11. Jahrhundert. Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Eheprozess, Verwandtschaftsehe, Kirchenrecht, Herrschaftsgefüge, Heinrich II., Präzedenzfall, Eherecht, Mittelalter.
Häufig gestellte Fragen
Wer waren Otto und Irmgard von Hammerstein?
Otto von Hammerstein war ein einflussreicher Adliger aus der Linie der Konradiner, der durch seine Ehe mit Irmgard bedeutende Besitztümer vereinte.
Warum wurde die Ehe der Hammersteiner angegriffen?
Die geistliche und weltliche Autorität erklärte die Ehe aufgrund zu naher Verwandtschaft (Inzestverbot nach damaligem Kirchenrecht) für unrechtmäßig.
Welche Rolle spielte Kaiser Heinrich II. in diesem Prozess?
Heinrich II. nutzte den Prozess, um kirchenrechtliche Normen politisch durchzusetzen und seine Macht gegenüber dem Adel zu stärken.
Was war die „Hammersteiner Fehde“?
Es war eine kriegerische Auseinandersetzung (1018–1023), die aus dem Widerstand Ottos gegen die Annullierung seiner Ehe und die damit verbundenen Sanktionen resultierte.
Warum gilt dieser Fall als Präzedenzfall für das Eherecht?
Der Rechtsstreit dokumentiert die beginnende Entwicklung und Systematisierung des Eherechts sowie das Spannungsfeld zwischen päpstlicher und erzbischöflicher Autorität.
- Quote paper
- Andrea Franz (Author), 2006, Der Eheprozess Ottos und Irmgards von Hammerstein, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57434