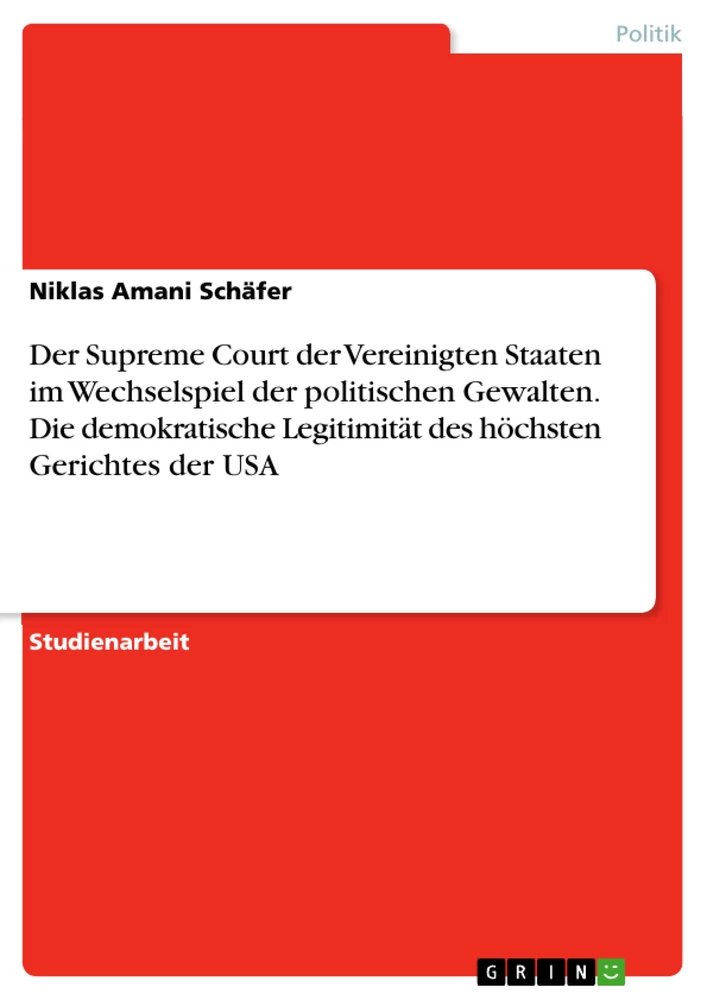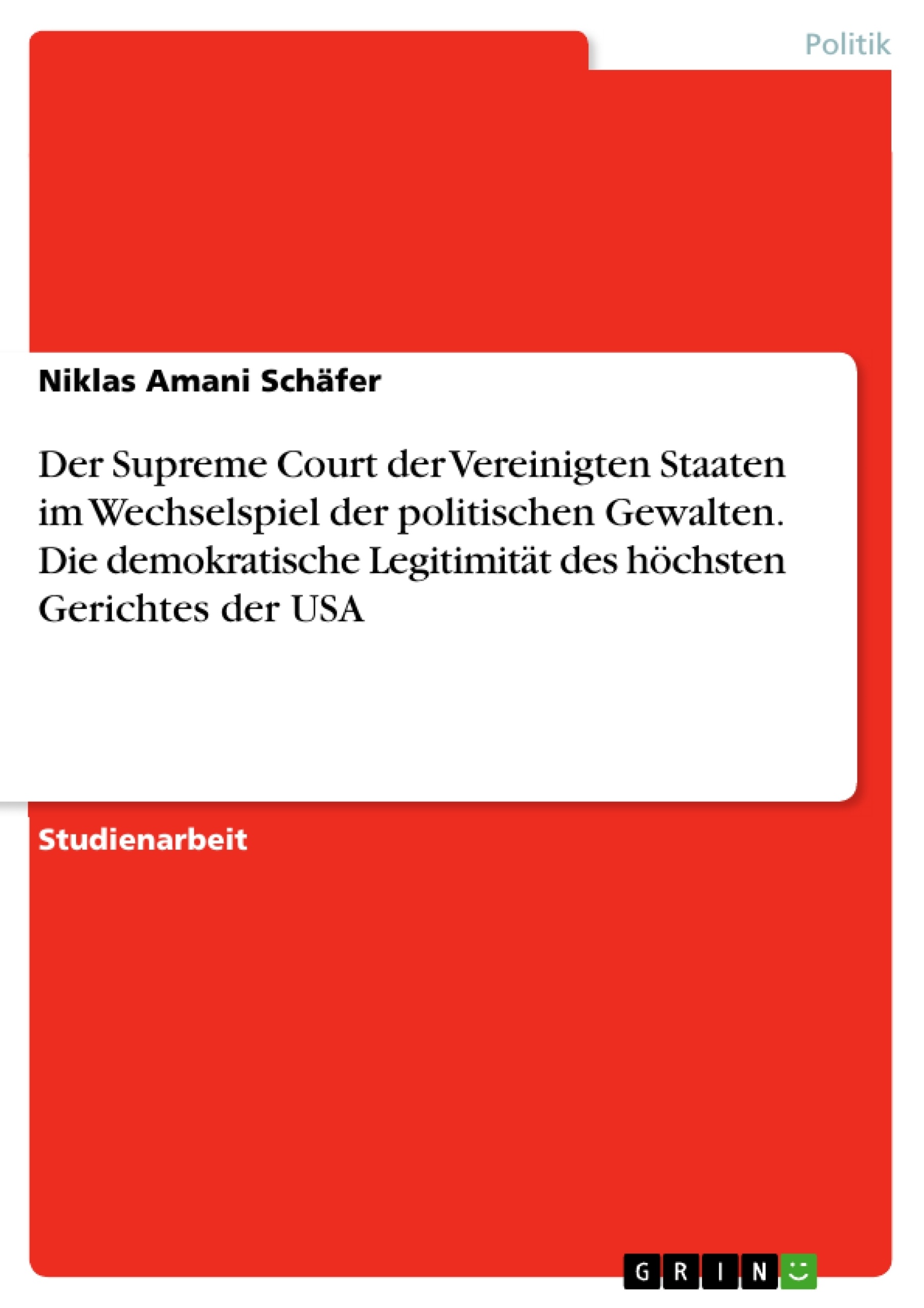1) Einleitung
“Scarcely any political question arises in the United States that is not resolved sooner or later,
into a judicial question.”(1)
Diese Aussage von Alexis de Tocqueville betont die hohe Stellung der Judikative und deren Verknüpfung mit politischen Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Den Aufbau des Gerichtssystems legt die Verfassung hierbei wie folgt fest:
“The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain and establish.”(2)
Demnach stellt der Supreme Court die höchste Instanz der US-amerikanischen Judikative dar, während die anderen nationalen Gerichte erst im Judiciary Act von 1789 durch den Kongress geschaffen wurden.(3) Aufgrund seiner bedeutenden Stellung im politischen Machtgefüge der USA stand und steht der Supreme Court im Zentrum zahlreicher Studien, die unter anderem die demokratische Legitimität des Gerichtes hinterfragen. Während Exekutive und Legislative ihre demokratische Berechtigung aus der direkten Wahl durch das Volk schöpfen können, scheint das oberste Gericht zunächst ungebunden und somit potentiell der mehrheitlichen Meinung entgegen wirkend. Angesichts seines starken Einflusses auf grundlegende politische Entwicklungen, wurde dem Supreme Court daher oft eine anti-mehrheitliche Tendenz vorgeworfen, die die Demokratie in ihren Grundwerten unterwandert.(4) Dahl brachte 1957 jedoch eine Hypothese auf, die die soeben nachgezeichnete Argumentation entkräften sollte: Seine Analyse des Supreme Court ergab, dass dieser nur in sehr wenigen Fällen die Gesetze der legislativen Mehrheit für ungültig erklärt hatte, obwohl ihm dieses Recht aufgrund des Prinzips des judicial review zusteht (siehe Kapitel 2.2). Dies führt Dahl darauf zurück, dass der Präsident durch seine Kompetenz, die Richter des obersten Gerichtes zu ernennen, die ideologische Haltung des Supreme Court der seinigen anpassen kann.
[...]
______
(1) Tocqueville, Alexis de,[...]
(2) Article III, Section 1 of the Constitution of the United States of America,[...]
(3) Die anderen nationalen Gerichte bestehen aus [...]
(4) Vgl. Segal, Jeffrey A. / Timpone, Richard J. / Howard, Robert M., Buyer Beware? Presidential Success through Supreme Court Appointments, in: Political Research Quarterly, Band 53, Nr. 3, 2000, S.568 ff.
Vgl. Hodder-Williams, Richard, The Politics of the US Supreme Court, London 1980, S. 19 ff.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Fakten zum Supreme Court
- Geschichte / Entwicklung
- Gerichtsbarkeit und Kompetenzen des Supreme Courts sowie Befugnisse des Kongresses und des Präsidenten
- Verfahren
- Strategische Einflussnahme auf den Supreme Court
- ,„The Nomination Game“ – Berücksichtigung politischer Konstellationen
- Verzögerung als Strategie
- Kurzzeit- und Langzeiterfolge des Präsidenten
- Erfolg durch einstimmige Richterblöcke
- Die Rolle des Solicitor General
- Supreme Court Urteile in regierungsbezogenen Fällen
- Die öffentliche Meinung und der Supreme Court
- Schlussbetrachtung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der demokratischen Legitimität des Supreme Court der Vereinigten Staaten im Spannungsfeld der politischen Gewalten. Sie zielt darauf ab, Dahls Hypothese, wonach der Präsident durch die Ernennung von Richtern das oberste Gericht in seinen Interessen beeinflussen kann, zu überprüfen und mögliche Modifikationen zu erörtern.
- Die Rolle des Supreme Court als höchste Instanz der US-amerikanischen Judikative im Verhältnis zu den anderen politischen Gewalten.
- Die strategischen Möglichkeiten des Präsidenten und des Kongresses, Einfluss auf die Besetzung des Supreme Court und dessen Urteilsfindung zu nehmen.
- Die Wechselwirkung zwischen der öffentlichen Meinung und der ideologischen Ausrichtung des Supreme Court.
- Die Frage, ob der Supreme Court tatsächlich eine anti-mehrheitliche Tendenz aufweist oder ob er dem Kurs der Mehrheit folgt.
- Die Analyse des Abstimmungsverhaltens der Richter in Bezug auf ihre Ernennenden und die ideologische Ausrichtung der Urteile.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik und stellt die zentrale Frage nach der demokratischen Legitimität des Supreme Court in den Vordergrund. Sie beleuchtet die Bedeutung des Gerichtes im amerikanischen politischen System und die kritische Diskussion um seine Rolle im Kontext der Gewaltenteilung.
Kapitel 2 widmet sich dem institutionellen Rahmen des Supreme Court, indem es seine Geschichte, Entwicklung, Gerichtsbarkeit und Kompetenzen sowie die Befugnisse des Kongresses und des Präsidenten im Zusammenhang mit dem Gericht beleuchtet.
Kapitel 3 analysiert die strategischen Möglichkeiten des Präsidenten und des Kongresses, Einfluss auf den Supreme Court zu nehmen, mit besonderem Fokus auf die Ernennungskompetenz des Präsidenten. Es betrachtet die Rolle des „Nomination Game“ sowie die Taktiken der Senatoren bei der Bestätigung von Richtern.
Kapitel 4 untersucht das Abstimmungsverhalten der Richter in Prozessen, die die Machtbefugnisse des Präsidenten oder seiner exekutiven Behörden betreffen. Es prüft Dahls Annahme, dass Richter ihren ernennenden Präsidenten gegenüber loyal sind.
Kapitel 5 beleuchtet die Wechselwirkung zwischen öffentlicher Meinung und ideologischer Haltung des Supreme Court und beschäftigt sich mit dem Zusammenhang zwischen beiden im Rahmen von Dahls Hypothese.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen des Supreme Court, der US-amerikanischen Judikative, der Gewaltenteilung, der demokratischen Legitimität, der strategischen Einflussnahme, der öffentlichen Meinung, der ideologischen Ausrichtung von Urteilen und den Studien von Dahl und Tocqueville.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird die demokratische Legitimität des Supreme Court hinterfragt?
Da die Richter nicht direkt gewählt werden, wird oft kritisiert, dass sie gegen den Willen der Mehrheit entscheiden könnten, was als "anti-mehrheitliche Tendenz" bezeichnet wird.
Was besagt die Hypothese von Robert Dahl (1957)?
Dahl argumentierte, dass der Supreme Court meist dem Kurs der politischen Mehrheit folgt, da Präsidenten Richter ernennen, die ihre eigene ideologische Haltung teilen.
Was ist das "Nomination Game"?
Es beschreibt den strategischen Prozess der Richterernennung, bei dem der Präsident politische Konstellationen und die Bestätigungschancen im Senat berücksichtigen muss.
Welche Rolle spielt der Solicitor General?
Der Solicitor General vertritt die US-Regierung vor dem Supreme Court und hat einen signifikanten Einfluss darauf, welche Fälle das Gericht annimmt und wie es entscheidet.
Was ist "Judicial Review"?
Es ist das Recht des Gerichts, Gesetze der Legislative oder Handlungen der Exekutive auf ihre Verfassungsmäßigkeit zu prüfen und gegebenenfalls für ungültig zu erklären.
- Quote paper
- Niklas Amani Schäfer (Author), 2005, Der Supreme Court der Vereinigten Staaten im Wechselspiel der politischen Gewalten. Die demokratische Legitimität des höchsten Gerichtes der USA , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57443