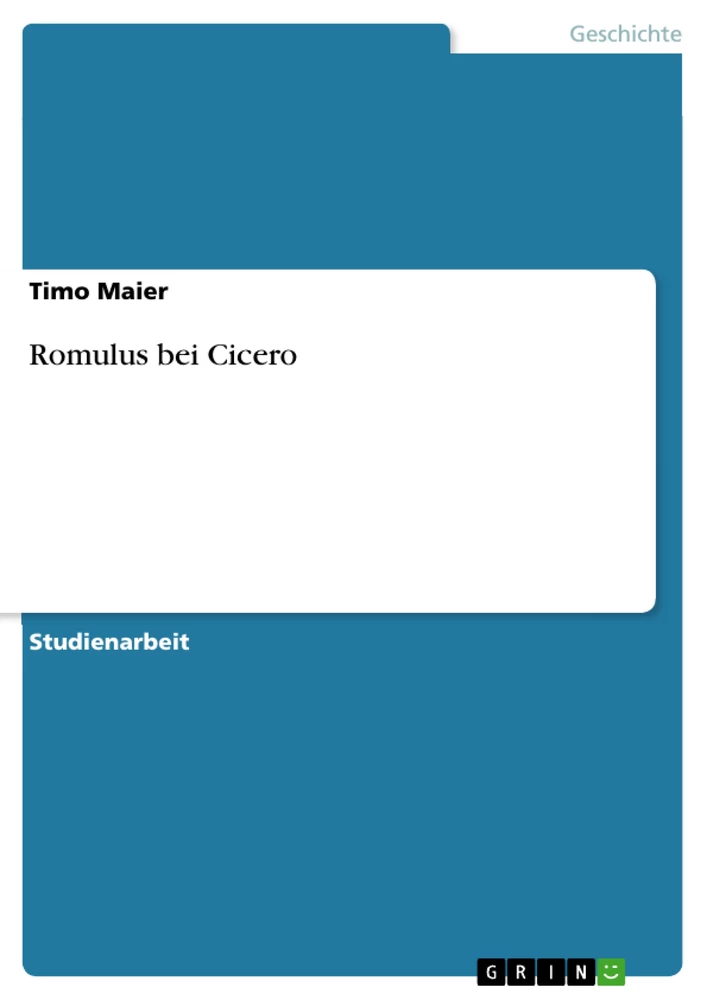Bei Marcus Tullius Cicero handelt es sich wohl um eine der kontrastreichsten Persönlichkeiten der Geschichte. Auf der einen Seite gilt dieser als der Verteidiger der römischen Republik schlechthin, als ein wahres Sturmgeschütz der Freiheit und der römischen Verfassung, als begnadeter Rhetoriker und Lehrmeister. Auf der anderen Seite hingegen unterstellt man diesem erhebliche charakterliche Mängel wie Eigenlob, Stolz, Feigheit und Zögerlichkeit. Tatsächlich scheint das Leben und Wirken Ciceros von einer Vielzahl von Gegensätzen geprägt worden zu sein. Allein seine theoretisch-philosophischen Ansätze erscheinen gemessen an seinen politisch-praktischen Entscheidungen oftmals paradox und es erweckt den Anschein, als ob der Philosoph Cicero und der Politiker Cicero nicht allzu viel gemein hatten.
Die folgende Untersuchung beschäftigt sich mit Ciceros Romulusrezeption im zweiten Buch seines Werkes de re publica. Es sollen nicht nur die inhaltlichen wie formellen Charakteristika des Textes hervorgehoben werden, sondern auch konkrete Fragen zum historischen Kontext gestellt werden. Warum fiel Ciceros Beurteilung des mythischen Gründers Roms so positiv aus? Welche realpolitischen Beweggründe beinflussten die Gestaltung dieser Rezeption? Auf welche Vorbilder und Philosophen griff Cicero beim Verfassen dieses Werkes zurück und warum? All diese Fragen sind abhängig vom historischen Kontext, der den Rahmen für diese Untersuchung bilden soll. An diesem konkreten Beispiel soll abschließend die Diskrepanz zwischen Ciceros theoretischen Konzepten und dessen politischen Handeln erläutert werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Ciceros de re publica
- Rückgriff auf Sokrates und Platon
- Die Romulusrezeption
- Die Romulusrezeption als Reaktion auf den Niedergang der Republik
- Verkennung der politischen Realität
- Abschließende Stellungnahme
- Bibliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert Ciceros Darstellung des Romulus im zweiten Buch seines Werkes "de re publica". Sie untersucht die inhaltlichen und formellen Charakteristika des Textes und stellt konkrete Fragen zum historischen Kontext. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, warum Ciceros Beurteilung des mythischen Gründers Roms so positiv ausfiel, welche realpolitischen Beweggründe die Gestaltung dieser Rezeption beeinflussten und auf welche Vorbilder und Philosophen Cicero beim Verfassen dieses Werkes zurückgriff.
- Ciceros Romulusrezeption als Idealbild des Staatsmannes
- Die philosophischen Einflüsse auf Ciceros Werk
- Die politische Situation zur Entstehungszeit des Werkes
- Die Diskrepanz zwischen Ciceros theoretischen Konzepten und seinem politischen Handeln
- Die Verkennung der politischen Realität in Ciceros Zeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in die Thematik der Arbeit ein und stellt Ciceros Lebenswerk in den historischen Kontext. Sie erläutert die Gegensätze in Ciceros Persönlichkeit und die Bedeutung seines Lebens für die Geschichte Roms. Die Arbeit konzentriert sich auf Ciceros Romulusrezeption im zweiten Buch seines Werkes "de re publica" und stellt die wichtigsten Aspekte des Werkes vor.
Das Kapitel "Ciceros de re publica" beschreibt den Aufbau und die Kernaussagen des Werkes. Es beleuchtet die verschiedenen Themenbereiche, die Cicero in seinem Werk behandelt, und die philosophischen Einflüsse, die er dabei verarbeitet. Es wird deutlich, dass Cicero in seinem Werk eine ideale Staatsform entwirft, die er in der römischen Republik verwirklicht sieht.
Das Kapitel "Rückgriff auf Sokrates und Platon" analysiert die philosophischen Einflüsse, die Cicero in seinem Werk verarbeitet. Es wird deutlich, dass Cicero sich an Platon und Aristoteles orientiert und deren Ideen in seine eigene Staatskonzeption integriert. Das Kapitel zeigt die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Ciceros Werk und den philosophischen Schriften Platons.
Das Kapitel "Die Romulusrezeption" analysiert Ciceros Darstellung des Romulus als Idealbild des Staatsmannes. Es werden die Attribute herausgearbeitet, die Cicero dem mythischen Gründer Roms zuschreibt, und die Rolle der Vernunft, der moralischen Integrität und der Weisheit in Ciceros Staatskonzeption erläutert. Das Kapitel zeigt, wie Cicero den Mythos des Romulus instrumentalisiert, um seine eigenen politischen Vorstellungen zu untermauern.
Das Kapitel "Die Romulusrezeption als Reaktion auf den Niedergang der Republik" untersucht die politische Situation zur Entstehungszeit von Ciceros Werk und die Gründe für die Gestaltung der Romulusrezeption. Es wird deutlich, dass Ciceros Idealbild des Staatsmannes eine Reaktion auf den Niedergang der römischen Republik und den Aufstieg von Einzelherrschaft ist. Das Kapitel analysiert die Bedeutung der Vernunft, der Sittlichkeit und der moralischen Integrität in Ciceros Werk und die Ursachen für den Verfall der römischen Republik.
Das Kapitel "Verkennung der politischen Realität" analysiert die Gründe für die Diskrepanz zwischen Ciceros theoretischen Konzepten und seinem politischen Handeln. Es wird deutlich, dass Cicero die sich verändernden Strukturen der römischen Republik falsch gedeutet hat und die Machtverhältnisse in seiner Zeit unterschätzt hat. Das Kapitel beleuchtet die Ursachen für Ciceros Verblendung und die Folgen seines Handelns für die Republik.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter und Schwerpunktthemen des Textes umfassen die römische Republik, Ciceros "de re publica", Romulusrezeption, Staatsmann, Vernunft, Sittlichkeit, Verfall der Republik, Einzelherrschaft, politische Realität, Verblendung, Intellektuelle.
Häufig gestellte Fragen
Warum stellte Cicero Romulus so positiv dar?
Cicero nutzte den mythischen Gründer als Idealbild eines Staatsmannes, um seinen Zeitgenossen angesichts des Niedergangs der Republik ein moralisches und politisches Vorbild zu präsentieren.
In welchem Werk Ciceros findet man die Romulusrezeption?
Die detaillierte Auseinandersetzung mit Romulus findet sich im zweiten Buch seines philosophischen Werkes „de re publica“.
Welche griechischen Philosophen beeinflussten Ciceros Staatskonzeption?
Cicero griff maßgeblich auf die Ideen von Platon, Aristoteles und Sokrates zurück und integrierte sie in den römischen Kontext.
Worin bestand die Diskrepanz zwischen Ciceros Theorie und Praxis?
Während er in seinen Schriften ein Ideal der Vernunft und Freiheit entwarf, scheiterte er politisch oft an der harten Realität der Machtkämpfe am Ende der römischen Republik.
Gegen welchen politischen Trend richtete sich „de re publica“?
Das Werk war eine Reaktion auf den drohenden Verfall der republikanischen Ordnung und den Aufstieg autokratischer Einzelherrscher.
- Quote paper
- Timo Maier (Author), 2005, Romulus bei Cicero, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57485