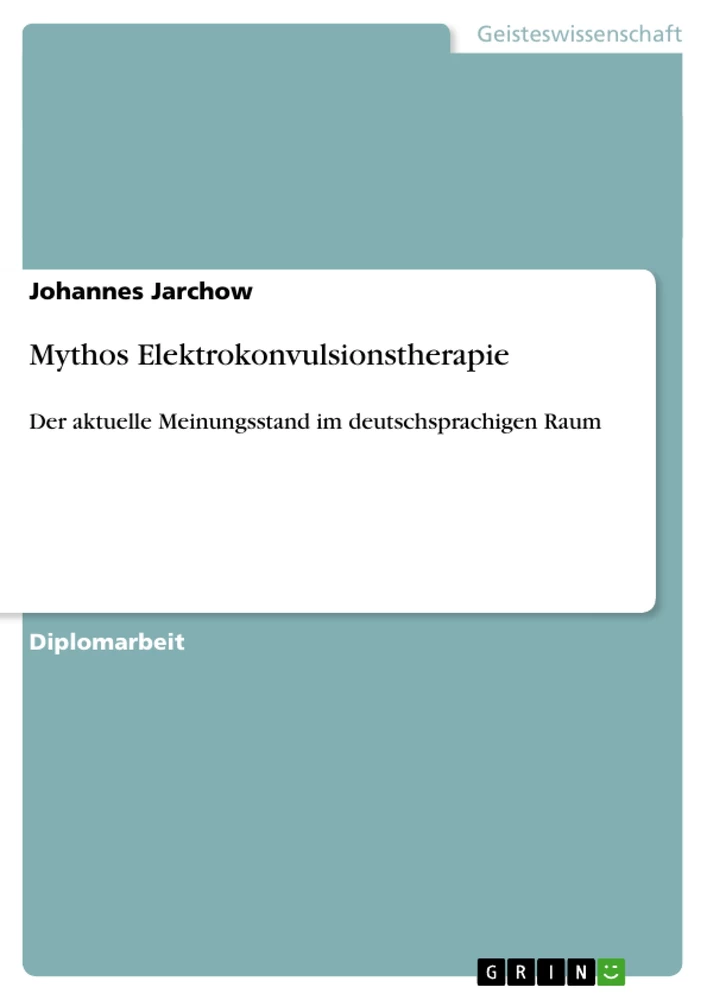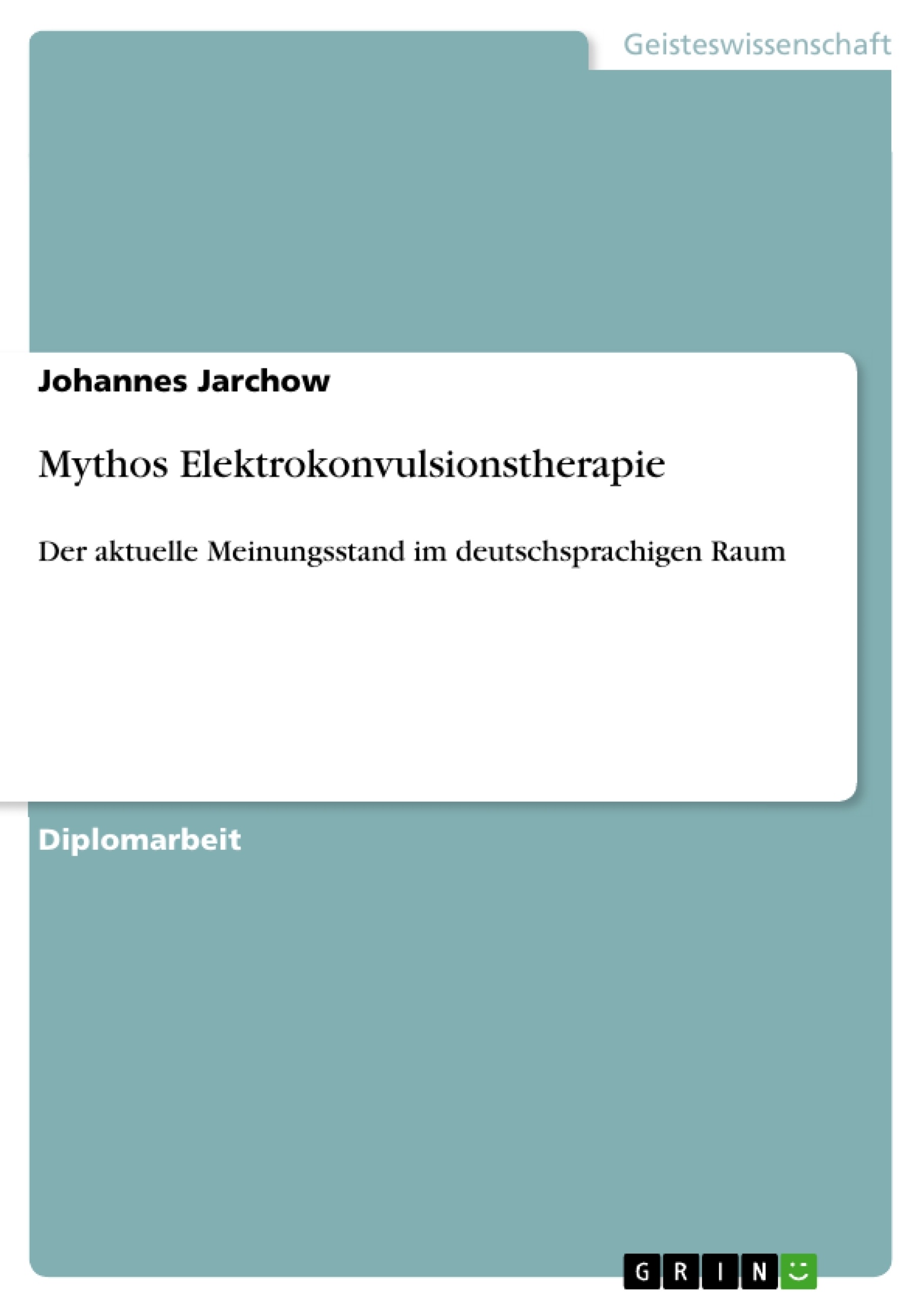Obwohl die Elektrokonvulsionstherapie (EKT) eines der wirksamsten Verfahren zur Behandlung therapieresistenter Depressionen ist, stößt sie in der Öffentlichkeit häufig auf Ablehnung und wird deshalb in den deutschen Kliniken vergleichsweise selten angewendet. Die Ziele der Studie bestanden darin, den aktuellen Meinungsstand im deutschsprachigen Raum zu beleuchten und die Ursachen für das Zustandekommen möglicher negativer Grundhaltungen zu untersuchen. Dafür wurde der Fragebogen zur Erfassung der Einstellung gegenüber der EKT (FEE-EKT) an drei Stichproben erhoben (461 nichtklinische Probanden, 26 depressive, therapieresistente EKT-Patienten und 30 niedergelassene Neurologen und Psychiater).
Erwartungsgemäß waren die nichtklinischen Probanden signifikant negativer gegenüber der EKT eingestellt als die Patienten und Experten. Mehrheitlich lässt sich die Einstellung in dieser Gruppe als neutral/ ambivalent und tendenziell vorurteilsbelastet beschreiben. Auffällig ist, dass nur die Hälfte der Probanden die EKT kannte. Diejenigen, die vor der Befragung einen kurzen Aufklärungstext gelesen haben (N = 76), waren signifikant positiver gegenüber der EKT eingestellt als nicht aufgeklärte Probanden. Die EKT-Patienten und die Experten gaben an, über die EKT gut informiert zu sein, und hatten ihr gegenüber eine sehr positive Einstellung.
Die Qualität der Informationsquellen konnte als wichtigster Einflussfaktor für das Urteil der Probanden identifiziert werden. Probanden, die Medien als Informationsquelle angaben, waren signifikant negativer und ängstlicher gegenüber der EKT eingestellt als Probanden, die andere oder gar keine Informationsquellen nannten. Zudem bestand in allen Befragungsgruppen ein positiver Zusammenhang zwischen selbsteingeschätzter Informiertheit und einer positiven EKT-Einstellung.
Die tendenziell ablehnende Haltung der Allgemeinbevölkerung ist v. a. auf mangelndes Wissen und eine negative Medienpräsenz der EKT zurückzuführen. Daher sollte eine wirksame Öffentlichkeitsarbeit zum Abbau von Vorurteilen angestrebt werden, so dass die EKT in Deutschland im Interesse der depressiven Patienten häufiger eingesetzt werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 1.1 DIE ELEKTROKONVULSIONSTHERAPIE (EKT)
- 1.2 DIE EINSTELLUNG GEGENÜBER DER EKT
- 1.3 HERLEITUNG DER FRAGESTELLUNG
- 1.3.1 DIE EINSTELLUNG DER VERSCHIEDENEN BEFRAGUNGSGRUPPEN GEGENÜBER DER EKT
- 1.3.2 DIE KOVARIABLEN DER EKT-EINSTELLUNG
- 1.3.3 DER ZEITLICHE WANDEL DER EKT-EINSTELLUNG
- 1.3.4 ABBAU VON VORURTEILEN GEGENÜBER DER EKT
- 1.4 HYPOTHESEN UND EXPLORATIVE FRAGESTELLUNGEN
- 1.4.1 STICHPROBENUNTERSCHIEDE IN DER EKT-EinstelLUNG
- 1.4.2 INFORMIERTHEIT UND Einfluss DER INFORMATIONSQUELLEN
- 1.4.3 BEHANDLUNGSERFAHRUNG
- 1.4.4 ALTER, BILDUNGSSTATUS UND GESCHLECHT
- 1.4.5 DEPRESSIVE SYMPTOMATIK
- 1.4.6 AUFKLÄRUNG
- 1.4.7 ZEITLICHER TREND
- 1.4.8 FEE-EKT ALS PRÄDIKTOR FÜR BEHANDLUNGSERFOLG
- 1.4.9 HYPOTHESEN ZUR NACHVALIDIERUNG DER FEE-EKT
- 2. METHODE
- 2.1 VERSUCHSPERSONEN
- 2.1.1 NICHTKLINISCHE STICHPROBE
- 2.1.2 KLINISCHE STICHPROBE
- 2.1.3 EXPERTEN-STICHPROBE
- 2.2 MESSINSTRUMENTE
- 2.2.1 FEE-EKT
- 2.2.2 HAMILTON DEPRESSIONSSKALA
- 2.2.3 BECK-DEPRESSIONS-INVENTAR
- 2.3 STUDIENDESIGN
- 2.4 STATISTISCHE ANALYSEN
- 3. ERGEBNISSE
- 3.1 NICHTKLINISCHE STICHPROBE
- 3.2 KLINISCHE STICHPROBE
- 3.3 EXPERTEN-STICHPROBE
- 3.4 STICHPROBENUNTERSCHIEDE
- 3.5 GESAMTSTICHPROBE
- 4. DISKUSSION
- 4.1 EINSTELLUNG GEGENÜBER DER EKT
- 4.2 DIE KOVARIABLEN DER EKT-EINSTELLUNG
- 4.3 KLINISCHE RELEVANZ DER ERGEBNISSE
- 4.4 SCHWIERIGKEITEN DER STUDIE
- 4.4.1 Stichprobenziehung und -bias
- 4.4.2 Die allgemeine diagnostische Problematik klinischer Daten
- 4.4.3 Verteilung der Daten
- 4.5 AUSBLICK
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht den aktuellen Meinungsstand zur Elektrokonvulsionstherapie (EKT) im deutschsprachigen Raum. Ziel ist es, die Einstellungen verschiedener Gruppen (Allgemeinbevölkerung, EKT-Patienten, Experten) gegenüber der EKT zu ermitteln und Einflussfaktoren auf diese Einstellungen zu analysieren.
- Einstellungen zur EKT in der Allgemeinbevölkerung, bei Patienten und Experten
- Einflussfaktoren wie Informiertheit, Behandlungserfahrung und depressive Symptomatik auf die EKT-Einstellung
- Zeitlicher Wandel der EKT-Einstellung
- Abbau von Vorurteilen gegenüber der EKT
- Klinische Relevanz der Ergebnisse
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in das Thema der Elektrokonvulsionstherapie (EKT) ein und beschreibt den aktuellen Forschungsstand zur Einstellung gegenüber dieser Therapieform. Es werden die Forschungsfragen und Hypothesen der Studie formuliert, die sich auf die Einstellungen verschiedener Gruppen (Allgemeinbevölkerung, EKT-Patienten, Experten) und die Einflussfaktoren auf diese Einstellungen konzentrieren. Die Herleitung der Fragestellungen beinhaltet die Betrachtung der Einstellungen der verschiedenen Befragungsgruppen, der Kovariablen der EKT-Einstellung (Informiertheit, Behandlungserfahrung, depressive Symptomatik, zeitliche Distanz), den zeitlichen Wandel der EKT-Einstellung und den Abbau von Vorurteilen. Die Kapitel legt den Grundstein für die Methodik und die Interpretation der Ergebnisse der Studie.
2. Methode: Dieses Kapitel beschreibt detailliert die Methodik der Studie, einschließlich der Beschreibung der Stichproben (nichtklinische, klinische und Experten-Stichprobe), der verwendeten Messinstrumente (FEE-EKT, Hamilton Depressionsskala, Beck-Depressions-Inventar), des Studiendesigns und der angewandten statistischen Analysen. Die detaillierte Beschreibung der Stichprobenziehung und -zusammensetzung sowie der Messinstrumente ist essentiell für die Nachvollziehbarkeit und Beurteilung der Validität der Studie. Die Auswahl der statistischen Verfahren wird ebenfalls begründet und ihre Eignung für die Beantwortung der Forschungsfragen erläutert.
3. Ergebnisse: Dieses Kapitel präsentiert die Ergebnisse der Studie, getrennt nach den verschiedenen Stichproben (nichtklinisch, klinisch, Experten) und der Gesamtstichprobe. Es werden die Ergebnisse der statistischen Analysen berichtet und in Tabellen und/oder Grafiken visualisiert. Die Darstellung der Ergebnisse ist strukturiert und ermöglicht einen klaren Überblick über die gefundenen Zusammenhänge zwischen den Variablen. Die Ergebnisse liefern die Grundlage für die Diskussion und Interpretation im folgenden Kapitel.
4. Diskussion: In diesem Kapitel werden die Ergebnisse der Studie diskutiert und im Kontext des bestehenden Forschungsstandes interpretiert. Es wird eine eingehende Analyse der Einstellungen der verschiedenen Gruppen gegenüber der EKT vorgenommen, sowie der Einflussfaktoren auf diese Einstellungen. Die Ergebnisse werden kritisch reflektiert, mögliche Limitationen der Studie werden aufgezeigt und der klinische Wert der Ergebnisse wird bewertet. Es werden auch Ausblicke auf zukünftige Forschungsfragen gegeben.
Schlüsselwörter
Elektrokonvulsionstherapie (EKT), Einstellung, Meinungsbild, Allgemeinbevölkerung, EKT-Patienten, Neurologen, Psychiater, Informiertheit, Behandlungserfahrung, depressive Symptomatik, Vorurteile, FEE-EKT, klinische Psychologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Einstellungen zur Elektrokonvulsionstherapie (EKT)
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Einstellungen verschiedener Gruppen (Allgemeinbevölkerung, EKT-Patienten, Experten) gegenüber der Elektrokonvulsionstherapie (EKT) im deutschsprachigen Raum. Sie analysiert Einflussfaktoren auf diese Einstellungen und deren zeitlichen Wandel.
Welche Gruppen wurden in der Studie untersucht?
Die Studie umfasst drei Stichproben: eine nichtklinische Stichprobe (Allgemeinbevölkerung), eine klinische Stichprobe (EKT-Patienten) und eine Stichprobe von Experten (Neurologen und Psychiater).
Welche Forschungsfragen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit untersucht die Einstellungen zur EKT in den verschiedenen Gruppen, den Einfluss von Faktoren wie Informiertheit, Behandlungserfahrung und depressiver Symptomatik auf die EKT-Einstellung, den zeitlichen Wandel der EKT-Einstellung und den Abbau von Vorurteilen gegenüber der EKT. Es wird auch die klinische Relevanz der Ergebnisse bewertet.
Welche Messinstrumente wurden verwendet?
Die Studie verwendet die FEE-EKT (Fragebogen zur Einstellung gegenüber der EKT), die Hamilton Depressionsskala und das Beck-Depressions-Inventar zur Erfassung der depressiven Symptomatik.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in vier Kapitel: Einleitung (mit Herleitung der Fragestellungen und Hypothesen), Methode (Beschreibung der Stichproben, Messinstrumente und statistischen Analysen), Ergebnisse (Präsentation der Ergebnisse für die verschiedenen Stichproben) und Diskussion (Interpretation der Ergebnisse, Limitationen der Studie und Ausblick).
Welche Ergebnisse wurden erzielt?
Die Ergebnisse der Studie werden im Kapitel 3 detailliert dargestellt und im Kapitel 4 diskutiert. Sie zeigen die Einstellungen der verschiedenen Gruppen gegenüber der EKT und den Einfluss der untersuchten Kovariablen auf diese Einstellungen.
Welche Limitationen weist die Studie auf?
Die Diskussion der Studie (Kapitel 4) benennt Limitationen wie Stichprobenziehung und -bias, die allgemeine diagnostische Problematik klinischer Daten und die Verteilung der Daten.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Elektrokonvulsionstherapie (EKT), Einstellung, Meinungsbild, Allgemeinbevölkerung, EKT-Patienten, Neurologen, Psychiater, Informiertheit, Behandlungserfahrung, depressive Symptomatik, Vorurteile, FEE-EKT, klinische Psychologie.
Was ist der klinische Wert der Ergebnisse?
Die klinische Relevanz der Ergebnisse wird in der Diskussion der Studie bewertet und eingeordnet.
Gibt es einen Ausblick auf zukünftige Forschung?
Das Kapitel zur Diskussion enthält einen Ausblick auf zukünftige Forschungsfragen im Bereich der Einstellungen zur EKT.
- Quote paper
- Johannes Jarchow (Author), 2006, Mythos Elektrokonvulsionstherapie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57621