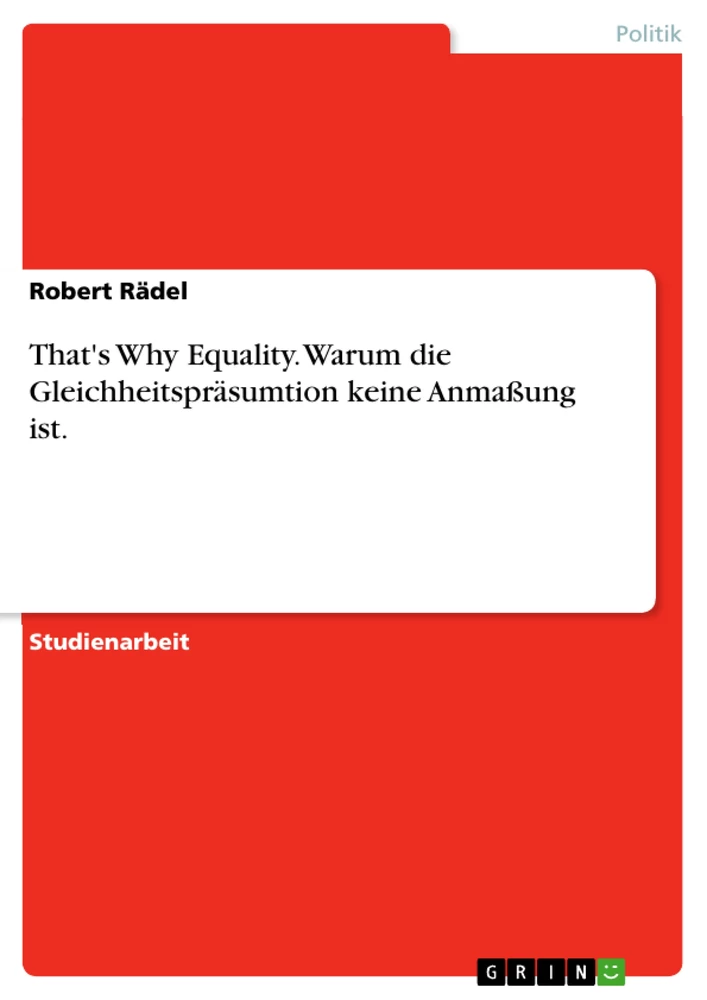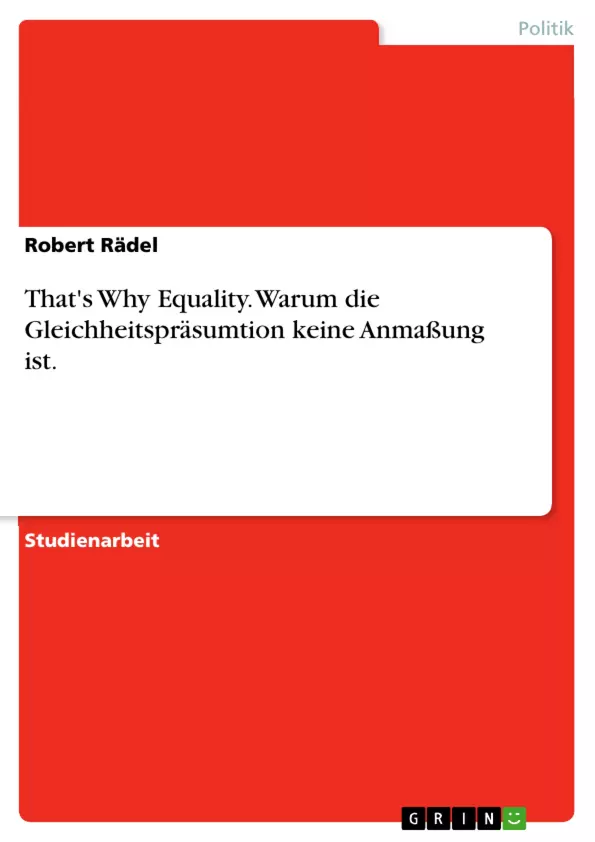In der politischen Gegenwartsphilosophie ist eine Debatte um Gleichheit und Gerechtigkeit im Gange. Zwei zentrale Fragen spielen dabei eine Rolle. Während auf der Seite der so genannten Egalitaristen vor allem die „Equality-of-What“ - Diskussion dominiert und gefragt wird, in welcher Hinsicht (welche Güter, Ressourcen, Freiheiten etc.) Gleichheit ausbuchstabiert werden soll, kritisieren die Non-Egalitaristen grundsätzlich, warum Gleichheit überhaupt ein besonderer Wert in der Gerechtigkeitsdiskussion zukommen soll. Stefan Gosepaths Versuch, egalitäre Gerechtigkeit zu verteidigen, mündete in der Theorie der „Gleichheitspräsumtion“. Diese Vorrangregel für egalitäre Prinzipien wird von u.a. Thomas Schramme kritisiert. Das Anliegen dieser Arbeit ist zu zeigen, dass diese Kritik ungerechtfertigt ist, dass die Inklusionstheorie kein geeigneter Beitrag zur philosophischen Suche nach Gerechtigkeit ist. Gerechtigkeit kann nicht an absoluten, im Zweifelsfall minimalistischen Standards eines guten Lebens gemessen werden. Diese gehören zu einem anderen Teil der Moral, der Humanität. Für eine Theorie der Gerechtigkeit ist Gleichheit ein zentraler Wert. Gerechtigkeit ist immer relational zu anderen Menschen und erst durch einen Vergleich feststellbar. Sowohl das Gebot der Gleichbehandlung, als auch das der prima facie gleichen Berücksichtigung der Ansprüche aller bei der Verteilung von Gütern folgt direkt aus der moralischen Gleichwertigkeit und gleichen Achtung aller Menschen. Die Argumente von Schramme können die Logik der Gleichheitspräsumtion als prozeduralen Ausgangspunkt von Gerechtigkeitsüberlegungen nicht angreifen. Gleichheit ist nicht oberstes Ziel von Gerechtigkeit, sondern Voraussetzung. Auch die Aufteilung in absolute und komparative Vergleichsmaßstäbe oder die Umkehrung der Beweislast bei der Verteilungsregel liefern keine Alternative für die Gleichheitspräsumtion. Objektive Kriterien eines guten Lebens, welche die Angemessenheit von Behandlungen oder Güterverteilungen festlegen könnten, sind eine eine Anmaßung, und könnten höchstens in konservativ-autoritären Regimen Durchsetzung finden. Moralische Ansprüche auf einen gleichen Anteil am gesellschaftlichen Reichtum und individuelle Gerechtigkeitsempfindungen müssen nicht zu Gunsten des gesellschaftlichen Friedens aufgegeben werden. Man muss fragen dürfen, mit welchem Recht jemand seinen übermäßigen Besitz beansprucht, ein Kritikverbot an den herrschenden Verhältnissen ist moralisch unhaltbar.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Stefan Gosepaths egalitäre Gerechtigkeitstheorie
- Die Kritik von Thomas Schramme an der Gleichheitspräsumtion
- Gerechtigkeit als Inklusion? Missverständnisse und Unklarheiten
- Resümee: Gleichheit als Voraussetzung für Gerechtigkeit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Ziel dieser Arbeit ist es, die Kritik von Thomas Schramme an der Gleichheitspräsumtion von Stefan Gosepath zu widerlegen und zu argumentieren, warum Gleichheit ein grundlegender Wert in der philosophischen Betrachtung von Gerechtigkeit ist. Die Arbeit beleuchtet dabei insbesondere die Argumentation von Gosepath und Schramme und untersucht, wie die beiden Denker die Beziehung zwischen Gleichheit und Gerechtigkeit verstehen.
- Die Bedeutung der Gleichheitspräsumtion in der Gerechtigkeitsdiskussion
- Die Kritik an der Gleichheitspräsumtion von Thomas Schramme
- Das Verhältnis von Gleichheit und Inklusion
- Die Rolle der Gleichheit für ein gerechtes Zusammenleben
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung
Der Text führt in die Thematik von Gerechtigkeit und Gleichheit ein und beleuchtet die aktuelle Debatte um den Wert der Gleichheit in der politischen Philosophie. Die Einleitung stellt den Zusammenhang zwischen Gerechtigkeit und Gleichheit sowie die historische Entwicklung dieser Konzepte dar.
Stefan Gosepaths egalitäre Gerechtigkeitstheorie
Dieses Kapitel präsentiert die egalitäre Gerechtigkeitstheorie von Stefan Gosepath und erläutert seine Konzeption der Gleichheitspräsumtion. Der Text zeigt auf, wie Gosepath Gleichheit als eine argumentativ-formale Vorrangregel definiert und ihre Bedeutung für die gerechte Verteilung von Ressourcen und Pflichten beschreibt.
Die Kritik von Thomas Schramme an der Gleichheitspräsumtion
In diesem Abschnitt werden die Kritikpunkte von Thomas Schramme an der Gleichheitspräsumtion von Gosepath vorgestellt. Der Text analysiert Schrammes Argumentation und zeigt auf, wie er die Gleichheitspräsumtion als eine „Anmaßung“ betrachtet.
Gerechtigkeit als Inklusion? Missverständnisse und Unklarheiten
Dieses Kapitel untersucht die Inklusionstheorie von Schramme und beleuchtet mögliche Missverständnisse und Unklarheiten in seiner Argumentation. Der Text analysiert Schrammes Kritik an der Gleichheitspräsumtion im Kontext der Inklusionstheorie und versucht, die zugrundeliegenden Argumentationslinien aufzudecken.
Schlüsselwörter
Die Arbeit widmet sich dem Spannungsfeld von Gerechtigkeit und Gleichheit. Zentrale Schlüsselbegriffe sind: Gleichheitspräsumtion, egalitäre Gerechtigkeit, Inklusion, Gerechtigkeitsgrundsätze, moralische Begründung, Gerechtigkeitsdiskussion, Gerechtigkeitsphilosophie.
- Quote paper
- Robert Rädel (Author), 2006, That's Why Equality. Warum die Gleichheitspräsumtion keine Anmaßung ist., Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57843