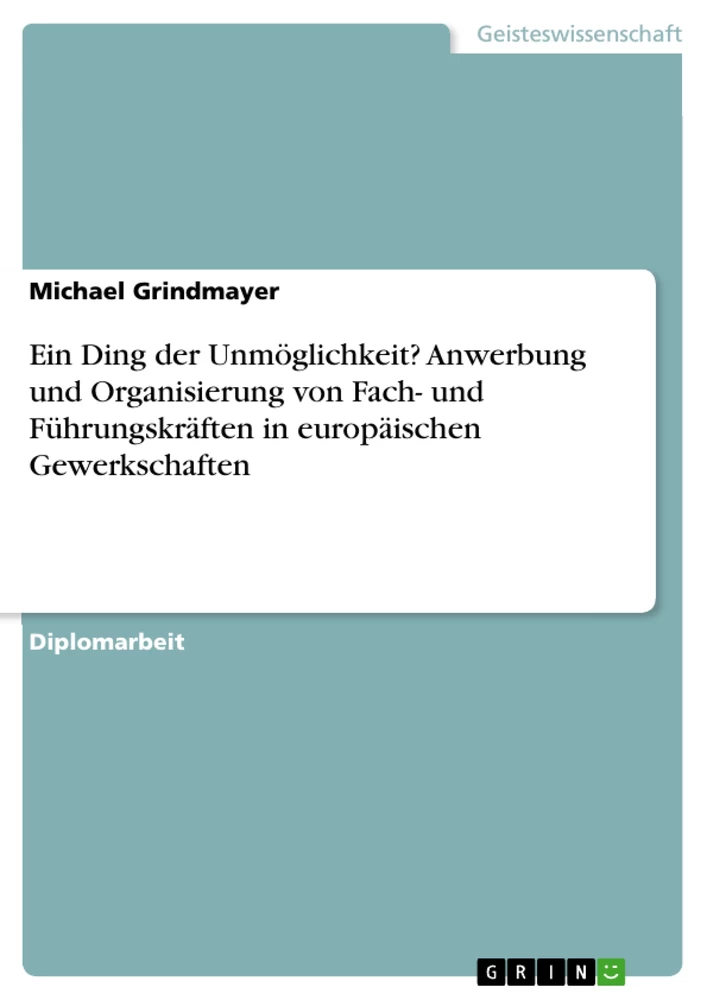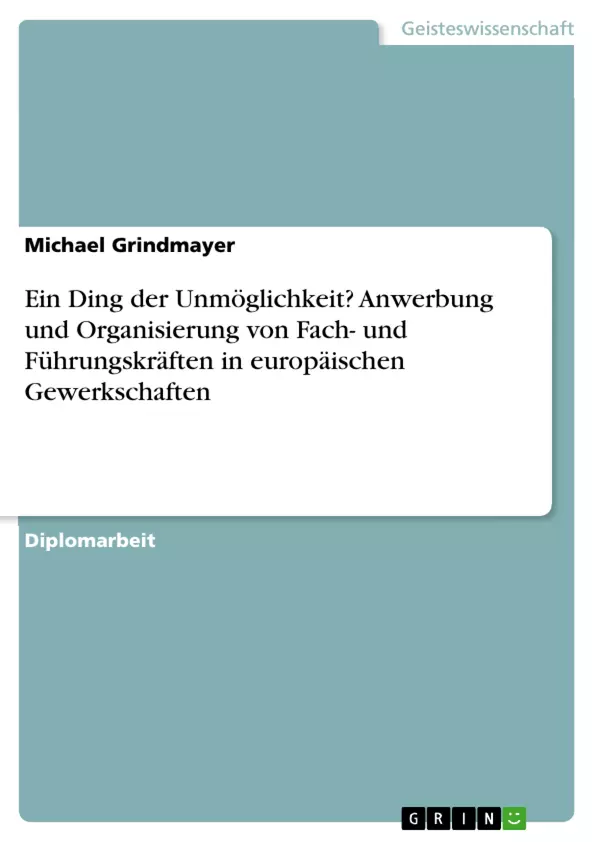Auf der Basis einer qualitativen Studie (Leitfadeninterviews)in 9 europäischen Gewerkschaften in 7 Ländern (GB,A,D,S,FL,B,DK) wurde der Umgang lokaler Gewerkschaften mit der Gruppe der hochqualifizierten Fach- und Führungskräfte untersucht.
(Wie) Gelingt es, sie als Mitglieder zu werben, obwohl gerade sie als traditionell gewerkschaftsfern gelten?
Inhaltsverzeichnis
- I. EINLEITUNG
- II. HANDLUNGSBEDINGUNGEN
- 1. Umweltfaktoren
- 1.1 Historisch-institutioneller Handlungsrahmen
- 1.2 Handlungstheoretischer Rahmen
- 1.3 Sozialstrukturelle Rahmenbedingungen
- 1.4 Externes Handlungsumfeld
- 2. Binnenfaktoren
- 2.1 Theorie der Gewerkschaften
- 2.2 Organisationsbereich
- 2.3 Internes Handlungsumfeld
- 2.4 Anwerbekultur
- 2.5 Gruppencharakteristika der Fach- und Führungskräfte
- 2.6 Direkte und indirekte Anwerbungsaktivitäten für Fach- und Führungskräfte
- 1. Umweltfaktoren
- III. METHODISCHES VORGEHEN
- IV. HANDLUNGSPERSPEKTIVEN
- 1. Experteninterviews
- 2. Qualitative Inhaltsanalyse
- 1. Beispiele aus Skandinavien
- 1.1 Die finnische Gewerkschaft TU
- 1.2 Die finnische Gewerkschaft ERTO
- 1.3 Die dänische Gewerkschaft IDA
- 1.4 Die schwedische Gewerkschaft Sif
- 2. Beispiele aus Deutschland und Österreich
- 2.1 Die deutsche Gewerkschaft IG Metall
- 2.2 Die deutsche ver.di und ihr Projekt für Medienschaffende „connexx.av“
- 2.3 Die österreichische GPA und ihre „Interessengemeinschaften“
- 3. Ein Beispiel aus Belgien
- 3.1 Die belgische LBC-NVK
- 4. Ein Beispiel aus Großbritannien
- 4.1 Die britische Gewerkschaft Amicus
- V. GEWERKSCHAFTEN IM KONTEXT IHRER STRUKTURBEDINGUNGEN
- 1. Die Strukturbedingungen skandinavischer Gewerkschaften
- 2. Die Strukturbedingungen deutscher und österreichischer Gewerkschaften
- 3. Die Strukturbedingungen belgischer Gewerkschaften
- 4. Die Strukturbedingungen britischer Gewerkschaften
- 5. Typologie der untersuchten Fälle nach Strukturbedingungen
- 6. Typologie der untersuchten Fälle nach Organisationsbereich
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Herausforderungen, denen europäische Gewerkschaften im Kontext der Wissensgesellschaft gegenüberstehen, insbesondere die Rekrutierung und Integration von Fach- und Führungskräften. Die Studie analysiert die Handlungsbedingungen von Gewerkschaften, betrachtet unterschiedliche Ansätze zur Anwerbung und Integration dieser Arbeitnehmergruppe in neun europäischen Gewerkschaften und vergleicht die Ergebnisse im Kontext nationaler und struktureller Gegebenheiten.
- Entwicklungen in der Wissensgesellschaft und deren Auswirkungen auf Gewerkschaften
- Herausforderungen der Rekrutierung und Integration von Fach- und Führungskräften in Gewerkschaften
- Analyse der Handlungsbedingungen von Gewerkschaften im Kontext von Umwelt- und Binnenfaktoren
- Vergleichende Betrachtung von Anwerbungs- und Integrationsstrategien in verschiedenen europäischen Gewerkschaften
- Die Rolle von Strukturbedingungen in der Organisation und Handlungsfähigkeit von Gewerkschaften
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Dieses Kapitel bietet eine kurze Einführung in die Thematik der Arbeit und beleuchtet die Bedeutung von Fach- und Führungskräften für die moderne Wissensgesellschaft.
- II. Handlungsbedingungen: Dieser Teil analysiert die externen und internen Handlungsbedingungen von Gewerkschaften. Er betrachtet die Auswirkungen der Wissensgesellschaft und die Herausforderungen, die sich aus der Rekrutierung und Integration von Fach- und Führungskräften ergeben.
- III. Methodisches Vorgehen: Das Kapitel beschreibt die Methodik der Studie, die auf Experteninterviews und einer qualitativen Inhaltsanalyse basiert.
- IV. Handlungsperspektiven: Dieser Abschnitt präsentiert exemplarische Fallstudien von neun europäischen Gewerkschaften, die unterschiedliche Ansätze zur Anwerbung und Integration von Fach- und Führungskräften verfolgen.
- V. Gewerkschaften im Kontext ihrer Strukturbedingungen: Das Kapitel analysiert die untersuchten Gewerkschaften im Hinblick auf ihre spezifischen Strukturbedingungen und vergleicht ihre Handlungsstrategien.
Schlüsselwörter
Die Diplomarbeit konzentriert sich auf die Themen Gewerkschaftsorganisation, Wissensgesellschaft, Fach- und Führungskräfte, Rekrutierung, Integration, Anwerbungsstrategien, Strukturbedingungen und vergleichende Analyse von Gewerkschaften in Europa.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist die Anwerbung von Fach- und Führungskräften für Gewerkschaften schwierig?
Fach- und Führungskräfte gelten traditionell als gewerkschaftsfern, da sie oft eine stärkere Identifikation mit dem Management oder individuelle Karrierestrategien verfolgen.
Welche europäischen Gewerkschaften wurden in der Studie untersucht?
Die Studie untersuchte neun Gewerkschaften aus sieben Ländern, darunter Großbritannien, Österreich, Deutschland (IG Metall, ver.di), Schweden, Finnland, Belgien und Dänemark.
Welche Rolle spielt die Wissensgesellschaft für die Gewerkschaften?
Die Entwicklung zur Wissensgesellschaft verändert die Arbeitnehmerstruktur. Gewerkschaften müssen sich anpassen, um auch für hochqualifizierte Wissensarbeiter relevant zu bleiben.
Gibt es Unterschiede in den Anwerbestrategien zwischen Skandinavien und Deutschland?
Ja, skandinavische Gewerkschaften haben oft andere Strukturbedingungen und Anwerbekulturen, die zu höheren Organisationsgraden auch bei Fachkräften führen können.
Was sind interne Binnenfaktoren für den Erfolg der Mitgliederwerbung?
Dazu gehören die Organisationsbereiche, die interne Anwerbekultur sowie die spezifischen direkten und indirekten Aktivitäten für die Zielgruppe der Führungskräfte.
Welche methodische Basis nutzt die Diplomarbeit?
Die Arbeit basiert auf einer qualitativen Studie unter Verwendung von Leitfadeninterviews mit Experten aus den jeweiligen Gewerkschaften.
- Quote paper
- Michael Grindmayer (Author), 2006, Ein Ding der Unmöglichkeit? Anwerbung und Organisierung von Fach- und Führungskräften in europäischen Gewerkschaften, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57896