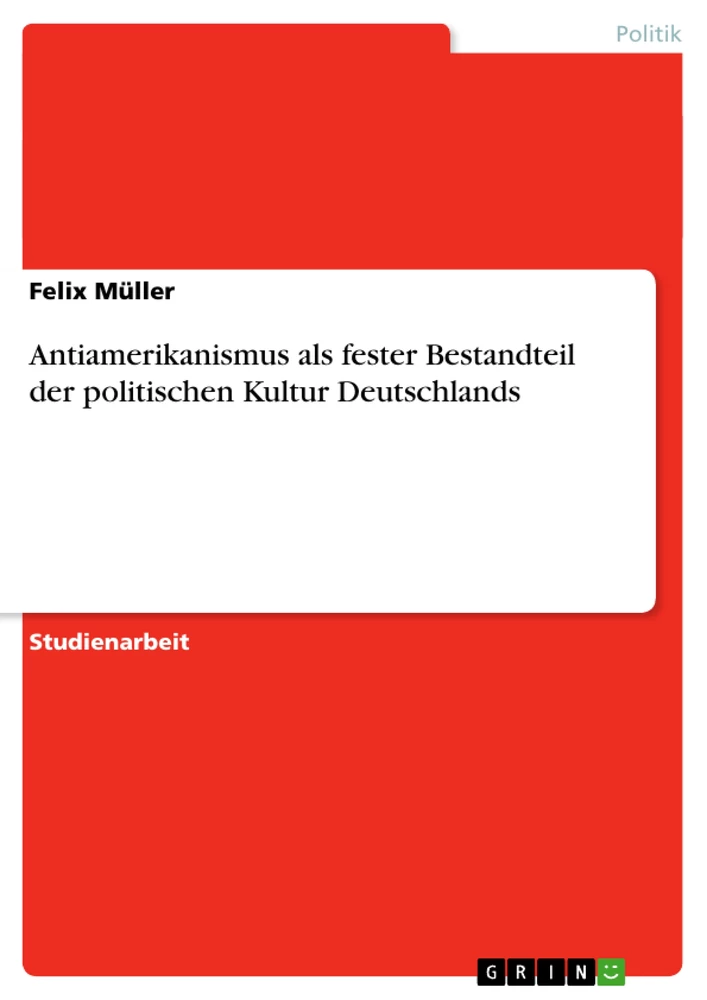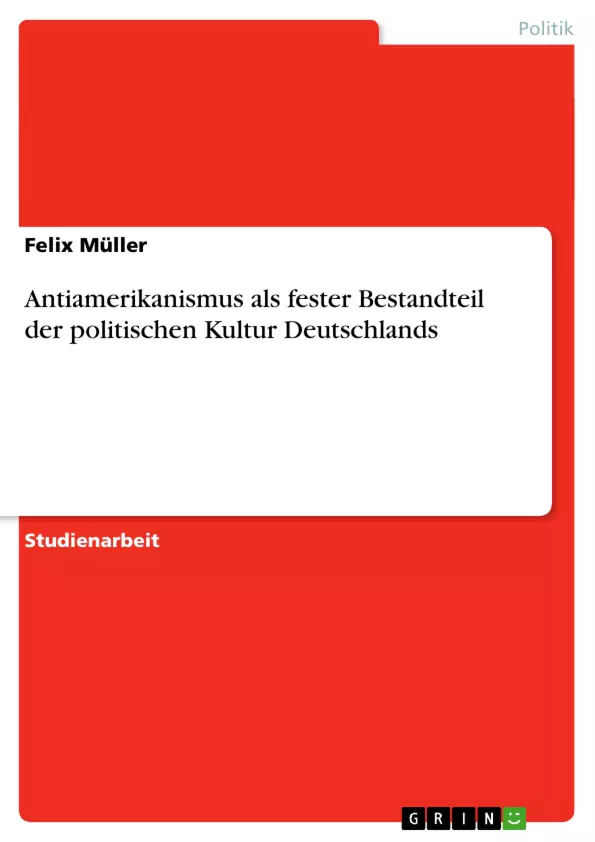Antisemitismus und Antiamerikanismus sind feste Bestandteile des politischen Diskurses in den europäischen Gesellschaften. Insbesondere seit den Anschlägen des 11.Septembers 2001 haben sich alte Stereotype und Feindbilder wieder verstärkt offenbart. Aufbauend auf begriffliche Eingrenzungen werden in der vorliegenden Arbeit die Diskurse der letzten Jahre untersucht.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Begriffliche Definitionen
- 2.1 Antiamerikanismus
- 2.2 Amerikahass und Antisemitismus - Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- 3 Geschichtsrevisionismus
- 4 Europäische Identität als Nicht-Amerika
- 5 Deutsche Öffentlichkeit nach 9/11
- 5.1 Intellektuelle Reaktionen und die „Friedensbewegung“
- 5.2 Schröders Wahlkampf
- 5.3 Verschwörungstheorien als Bestseller
- 6 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Verbreitung und die Funktionen von Antiamerikanismus in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit, insbesondere im Kontext der Ereignisse nach dem 11. September 2001. Der Fokus liegt dabei auf nicht-rechtsextremen Akteuren und deren Rolle bei der Reproduktion antiamerikanischer Stereotype und Feindbilder. Die Arbeit analysiert die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Antiamerikanismus und Antisemitismus.
- Begriffliche Abgrenzung von Antiamerikanismus und Antisemitismus
- Analyse der Rolle von Antiamerikanismus im deutschen Geschichtsdiskurs
- Untersuchung der öffentlichen Reaktionen in Deutschland auf die Ereignisse von 9/11 und die darauf folgenden Kriege
- Bewertung des Einflusses von Antiamerikanismus auf die politische Kultur in Deutschland
- Die Funktion von Antiamerikanismus als Identitätselement in einer sich konstituierenden europäischen Gesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung stellt die These auf, dass antiamerikanische Ressentiments nicht nur Reaktionen auf aktuelle politische Entwicklungen sind, sondern historisch gewachsene Feindbilder, die aktuell wieder verstärkt reproduziert werden. Sie betont, dass Antiamerikanismus sowohl rechte als auch linke Komponenten aufweist und in Deutschland aufgrund historischer Bedingungen eine besondere Rolle spielt. Der Fokus der Arbeit liegt auf der bürgerlichen und sich selbst als „links“ verstehenden Öffentlichkeit, nicht auf offen rechtsextremen Akteuren. Der Autor kündigt die begriffliche Klärung von Antiamerikanismus und Antisemitismus sowie die Analyse der deutschen öffentlichen Reaktion auf 9/11 an.
2 Begriffliche Definitionen: Dieses Kapitel definiert die Begriffe Antiamerikanismus und Antisemitismus. Es wird argumentiert, dass Antiamerikanismus oft nicht als solcher erkannt wird, da er gesellschaftlich akzeptierter ist als Antisemitismus. Verschiedene Definitionen von Antiamerikanismus werden präsentiert, darunter Diners Beschreibung als „Ergebnis einer verschrobenen Welterklärung“ und Hollanders umfassende Definition, die Feindseligkeit gegenüber den Vereinigten Staaten und ihren Institutionen, Traditionen und Werten umfasst. Der Unterschied zwischen legitimer Kritik an den USA und Antiamerikanismus wird ebenfalls diskutiert.
3 Geschichtsrevisionismus: [Da der bereitgestellte Text an dieser Stelle unvollständig ist, kann keine Zusammenfassung dieses Kapitels erstellt werden.]
4 Europäische Identität als Nicht-Amerika: [Da der bereitgestellte Text an dieser Stelle unvollständig ist, kann keine Zusammenfassung dieses Kapitels erstellt werden.]
5 Deutsche Öffentlichkeit nach 9/11: Dieses Kapitel analysiert die deutschen Reaktionen auf die Anschläge vom 11. September 2001 und die darauf folgenden Kriege in Afghanistan und im Irak. Es wird die Rolle intellektueller Reaktionen und der „Friedensbewegung“, der Einfluss von Schröders Wahlkampf und die Verbreitung von Verschwörungstheorien untersucht. Der Fokus liegt darauf, wie antiamerikanische Stereotype und Feindbilder im öffentlichen Diskurs verwendet und instrumentalisiert wurden.
Schlüsselwörter
Antiamerikanismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus, Deutsche Identität, Europäische Identität, 9/11, öffentlicher Diskurs, politische Kultur, Stereotype, Feindbilder, USA, Deutschland.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Antiamerikanismus in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit nach 9/11
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die Verbreitung und Funktionen von Antiamerikanismus in der deutschen und europäischen Öffentlichkeit, insbesondere nach den Ereignissen vom 11. September 2001. Der Fokus liegt auf nicht-rechtsextremen Akteuren und ihrer Rolle bei der Reproduktion antiamerikanischer Stereotype und Feindbilder. Ein weiterer Schwerpunkt ist der Vergleich von Antiamerikanismus und Antisemitismus.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt begriffliche Abgrenzungen von Antiamerikanismus und Antisemitismus, die Rolle des Antiamerikanismus im deutschen Geschichtsdiskurs, die öffentlichen Reaktionen in Deutschland auf 9/11 und die darauf folgenden Kriege, den Einfluss von Antiamerikanismus auf die politische Kultur Deutschlands und die Funktion von Antiamerikanismus als Identitätselement in einer sich konstituierenden europäischen Gesellschaft.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit umfasst Kapitel zu Einleitung, begrifflichen Definitionen von Antiamerikanismus und Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus, europäischer Identität als Nicht-Amerika und der deutschen Öffentlichkeit nach 9/11 (inkl. intellektueller Reaktionen, Schröders Wahlkampf und Verschwörungstheorien). Abschließend gibt es einen Ausblick.
Welche These wird in der Einleitung aufgestellt?
Die Einleitung stellt die These auf, dass antiamerikanische Ressentiments nicht nur Reaktionen auf aktuelle politische Entwicklungen sind, sondern historisch gewachsene Feindbilder, die aktuell wieder verstärkt reproduziert werden. Es wird betont, dass Antiamerikanismus sowohl rechte als auch linke Komponenten aufweist und in Deutschland aufgrund historischer Bedingungen eine besondere Rolle spielt. Der Fokus liegt auf der bürgerlichen und sich selbst als „links“ verstehenden Öffentlichkeit.
Wie werden Antiamerikanismus und Antisemitismus abgegrenzt?
Das Kapitel „Begriffliche Definitionen“ klärt die Begriffe Antiamerikanismus und Antisemitismus und argumentiert, dass Antiamerikanismus oft nicht als solcher erkannt wird, da er gesellschaftlicher akzeptiert ist als Antisemitismus. Es werden verschiedene Definitionen von Antiamerikanismus präsentiert und der Unterschied zwischen legitimer Kritik an den USA und Antiamerikanismus diskutiert.
Was wird im Kapitel über die Deutsche Öffentlichkeit nach 9/11 analysiert?
Dieses Kapitel analysiert die deutschen Reaktionen auf die Anschläge vom 11. September 2001 und die darauf folgenden Kriege. Es untersucht die Rolle intellektueller Reaktionen und der „Friedensbewegung“, den Einfluss von Schröders Wahlkampf und die Verbreitung von Verschwörungstheorien und wie antiamerikanische Stereotype und Feindbilder im öffentlichen Diskurs verwendet wurden.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Antiamerikanismus, Antisemitismus, Geschichtsrevisionismus, Deutsche Identität, Europäische Identität, 9/11, öffentlicher Diskurs, politische Kultur, Stereotype, Feindbilder, USA, Deutschland.
Welche Kapitel sind im vorliegenden Text unvollständig?
Die Kapitel zu "Geschichtsrevisionismus" und "Europäische Identität als Nicht-Amerika" sind im bereitgestellten Text unvollständig, daher können keine Zusammenfassungen dieser Kapitel erstellt werden.
- Quote paper
- Felix Müller (Author), 2006, Antiamerikanismus als fester Bestandteil der politischen Kultur Deutschlands, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57900