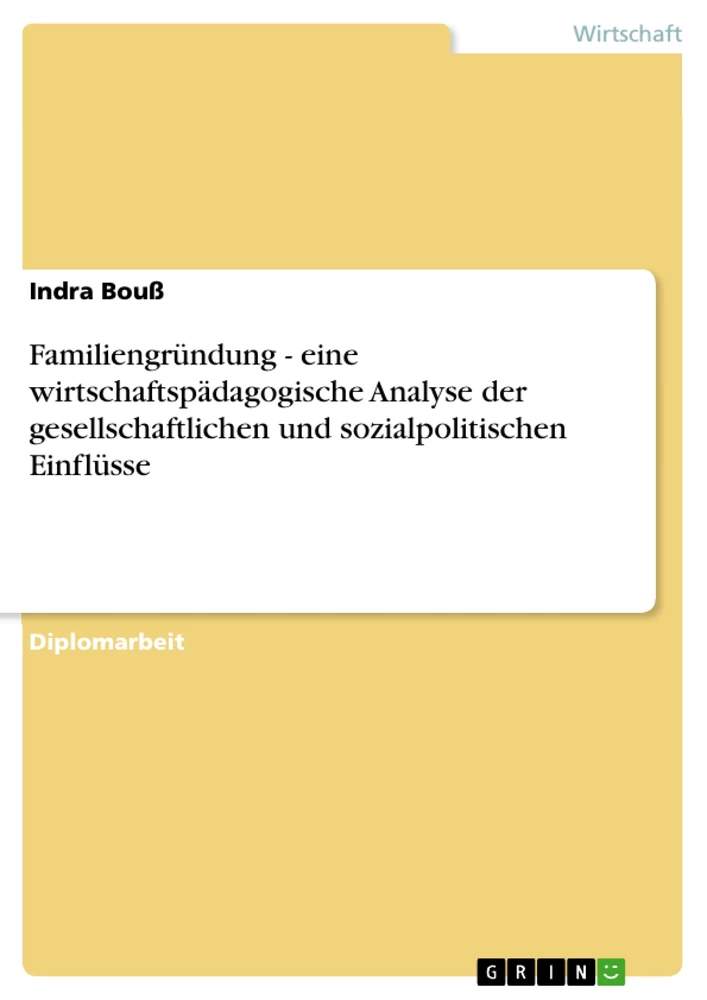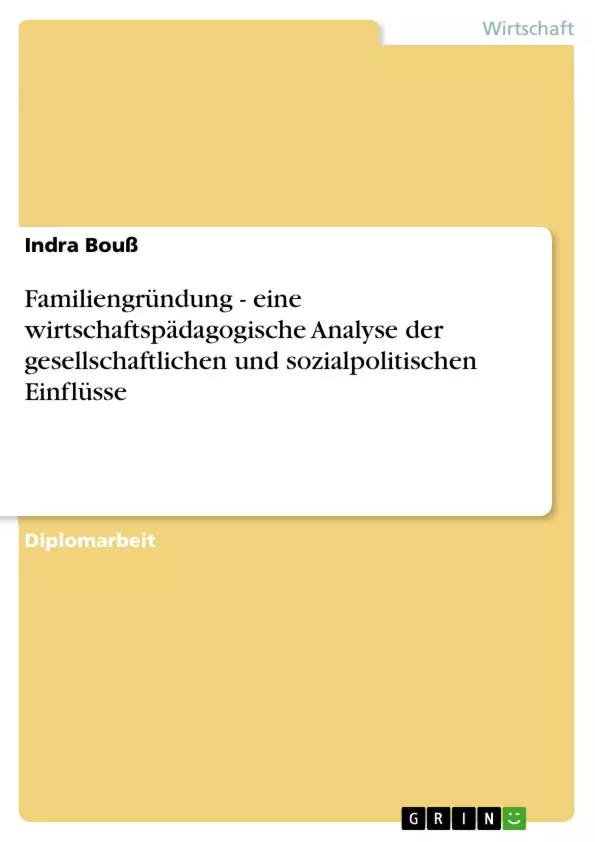„Kinder bekommen die Leute sowieso!“. So sah KONRAD ADENAUER im Jahr 1956 die Zukunft des damals im ´Aufstehen` begriffenen Deutschlands. Er sollte nicht Recht behalten. Gut 50 Jahre später stagniert die Geburtenrate in der Bundesrepublik auf einem sehr niedrigen Niveau, der Wunsch nach Familie und nach mehr Kindern wird von immer weniger Bürgern geäußert und in die Tat umgesetzt und auch die äußeren und inneren Bedingungen, in denen sich Familiengründung vollziehen muss, werden schwieriger. Ich möchte mich in meiner Diplomarbeit diesen Phänomenen in ihrer Verwobenheit und in ihren Interdependenzen widmen, indem ich die aktuelle Situation im Vergleich zu anderen europäischen Ländern darstelle, potenzielle Einflussfaktoren herausarbeite und schließlich auf normativer Grundlage ein Konzept entwickele, mit dem es gelingen könnte, herrschende Missstände zu mildern. Eine besondere Aktualität erfährt dieses Thema zurzeit aufgrund des Regierungswechsels im Herbst des vergangenen Jahres und den seither diskutierten und anstehenden Gesetzesänderungen. „In der Diplomarbeit soll ein Prüfling zeigen, dass er in der Lage ist, innerhalb der vorgegebenen Frist das ihm gestellte Problem selbständig mit wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten.“ So verlangt es die Diplomprüfungsordnung Wirtschaftspädagogik in §19. Das mir in diesem Rahmen gestellte Problem interpretiere ich vordergründig als Analyse der aktuellen Situation in Deutschland in bezug auf die demographische Entwicklung und deren Einflussfaktoren, wobei mein Fokus auf die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Rahmenbedingungen gerichtet ist. Es ist meine Aufgabe, Sachlagen darzustellen und zu analysieren, inwieweit Einstellungen und Verhalten in bezug auf Familiengründung durch o.g. Rahmenbedingungen bestimmt sind. Wie im Vorwort bereits erwähnt, möchte ich dann Maßnahmen und Entwicklungen aufzeigen, mit denen im Kontext einer von mir bestimmten Normativität, eine Verbesserung der Lage eintreten könnte.
Wir befinden uns damit im Bereich der Sozialwissenschaften, der diejenigen Wissenschaften umfasst, die Phänomene des gesellschaftlichen Zusammenlebens der Menschen theoretisch untersuchen und empirisch ermitteln. Es werden sowohl Strukturen und Funktionen sozialer Verflechtungszusammenhänge von Institutionen und Systemen als auch deren Wechselwirkung mit Handlungs- und Verhaltensprozessen der einzelnen Individuen, also der Akteure, untersucht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. 'EIN WORT ZUVOR`.
- 1.1. Wissenschaftsdisziplinäre Einordnung
- 1.2. Wissenschaftstheoretische Vorgehensweise
- 1.3. Ziele_
- 1.3.1. Warum?
- 1.3.2. Der Weg ist das Ziel.
- 1.4. Ein 'Begriffs-Nenner_
- 1.4.1. Familie
- 1.4.2. Ehe.
- 1.4.3. Nichteheliche Lebensgemeinschaft.
- 1.4.4. Demographie.
- 2. EIN BLICK IN DIE STATISTIK – EINE SITUATIONSANALYSE
- 2.1. Deutschland
- 2.1.1. Demographische Entwicklung.
- 2.1.2. Gesetzgebung und Familienpolitik
- 2.1.2.1. Grundlagen der Familienpolitik
- 2.1.2.2. Daten und Fakten
- 2.1.3. Verhalten
- 2.2. Frankreich
- 2.3. Italien
- 2.4. Schweden
- 3. WAS BEEINFLUSST DIE FAMILIENGRÜNDUNG?
- 3.1. Gesellschaftliche Einflussfaktoren
- 3.1.1. Traditionelle und kulturelle Bedingungen
- 3.1.2. Das partnerschaftliche Verhalten
- 3.1.3. Erwerbs- und Berufstätigkeit
- 3.1.4. Herkunftsfamilie und Bildungsniveau.
- 3.1.5. Entstehende Kosten.
- 3.2. Sozialpolitische Einflussfaktoren.
- 3.2.1. Barleistungen
- 3.2.2. Sachleistungen.
- 3.2.3. Steuervorteile
- 4. NORMATIVER AUSWEIS
- 5. WAS KANN DEUTSCHLAND BESSER MACHEN?
- 5.1. VORSCHLÄGE AUS GESELLSCHAFTLICHER SICHT_
- 5.2. VORSCHLÄGE AUS SOZIALPOLITISCHER SICHT-
- 6. 'EIN WORT ZULETZT'
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Diplomarbeit untersucht die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Einflussfaktoren auf die Familiengründung. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse des Einflusses dieser Faktoren auf die Entscheidung von Paaren, Kinder zu bekommen oder nicht. Die Arbeit beschäftigt sich mit der Frage, welche Faktoren die Entscheidung für oder gegen eine Familiengründung beeinflussen und wie sich die jeweilige Situation in Deutschland im Vergleich zu anderen europäischen Ländern darstellt.
- Demographische Entwicklung und Familienpolitik in Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden
- Gesellschaftliche Einflussfaktoren auf die Familiengründung wie traditionelle und kulturelle Bedingungen, partnerschaftliches Verhalten, Erwerbs- und Berufstätigkeit sowie Bildungsniveau
- Sozialpolitische Einflussfaktoren auf die Familiengründung wie Barleistungen, Sachleistungen und Steuervorteile
- Normen und Werte in Bezug auf die Familiengründung
- Verbesserungsmöglichkeiten für die Familienpolitik in Deutschland
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit dient der Einleitung und erläutert die wissenschaftstheoretische Vorgehensweise sowie die Ziele der Arbeit. Es definiert auch wichtige Begriffe wie Familie, Ehe und Demographie. Das zweite Kapitel bietet einen Blick in die Statistik und analysiert die demographische Entwicklung und die Familienpolitik in Deutschland, Frankreich, Italien und Schweden. Im dritten Kapitel werden die gesellschaftlichen und sozialpolitischen Einflussfaktoren auf die Familiengründung untersucht. Das vierte Kapitel befasst sich mit den normativen Aspekten der Familiengründung. Schließlich stellt das fünfte Kapitel Vorschläge zur Verbesserung der Familienpolitik in Deutschland vor.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind Familiengründung, Demographie, Familienpolitik, gesellschaftliche Einflussfaktoren, sozialpolitische Einflussfaktoren, Deutschland, Frankreich, Italien, Schweden, Normen, Werte und Verbesserungsmöglichkeiten.
Häufig gestellte Fragen
Warum stagniert die Geburtenrate in Deutschland?
Die Arbeit nennt schwierige äußere Bedingungen, veränderte gesellschaftliche Werte sowie ökonomische Faktoren wie hohe Kosten und Vereinbarkeitsprobleme als Gründe.
Welche gesellschaftlichen Faktoren beeinflussen die Familiengründung?
Dazu gehören traditionelle Rollenbilder, das Bildungsniveau, die Erwerbstätigkeit beider Partner sowie das allgemeine partnerschaftliche Verhalten.
Wie unterscheidet sich die Familienpolitik in Europa?
Die Studie vergleicht Deutschland mit Frankreich, Italien und Schweden, wobei Länder wie Schweden oft durch bessere Sachleistungen (Kinderbetreuung) höhere Geburtenraten erzielen.
Was sind sozialpolitische Einflussfaktoren?
Hierunter fallen staatliche Leistungen wie Kindergeld (Barleistungen), Kitaplätze (Sachleistungen) und steuerliche Vorteile für Familien.
Welche Rolle spielt das Bildungsniveau?
Statistiken zeigen oft eine Korrelation zwischen höherem Bildungsniveau und einer späteren oder selteneren Familiengründung, was die Arbeit wirtschaftspädagogisch analysiert.
Was kann Deutschland von anderen Ländern lernen?
Die Arbeit schlägt vor, den Fokus stärker auf Sachleistungen und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie zu legen, ähnlich wie im schwedischen oder französischen Modell.
- Quote paper
- Indra Bouß (Author), 2006, Familiengründung - eine wirtschaftspädagogische Analyse der gesellschaftlichen und sozialpolitischen Einflüsse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57922