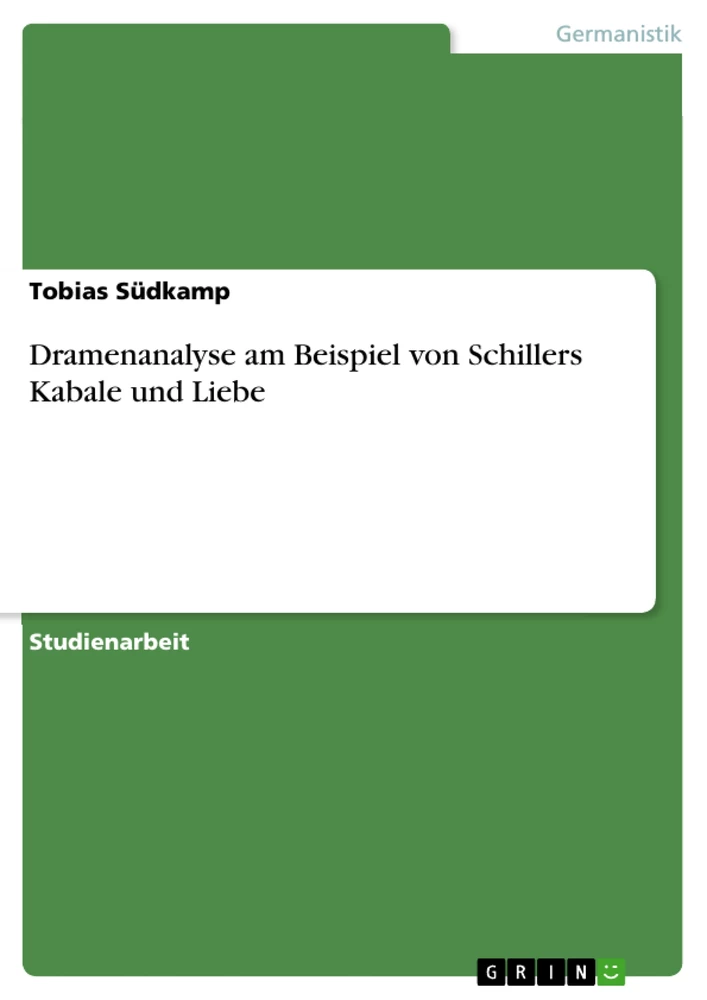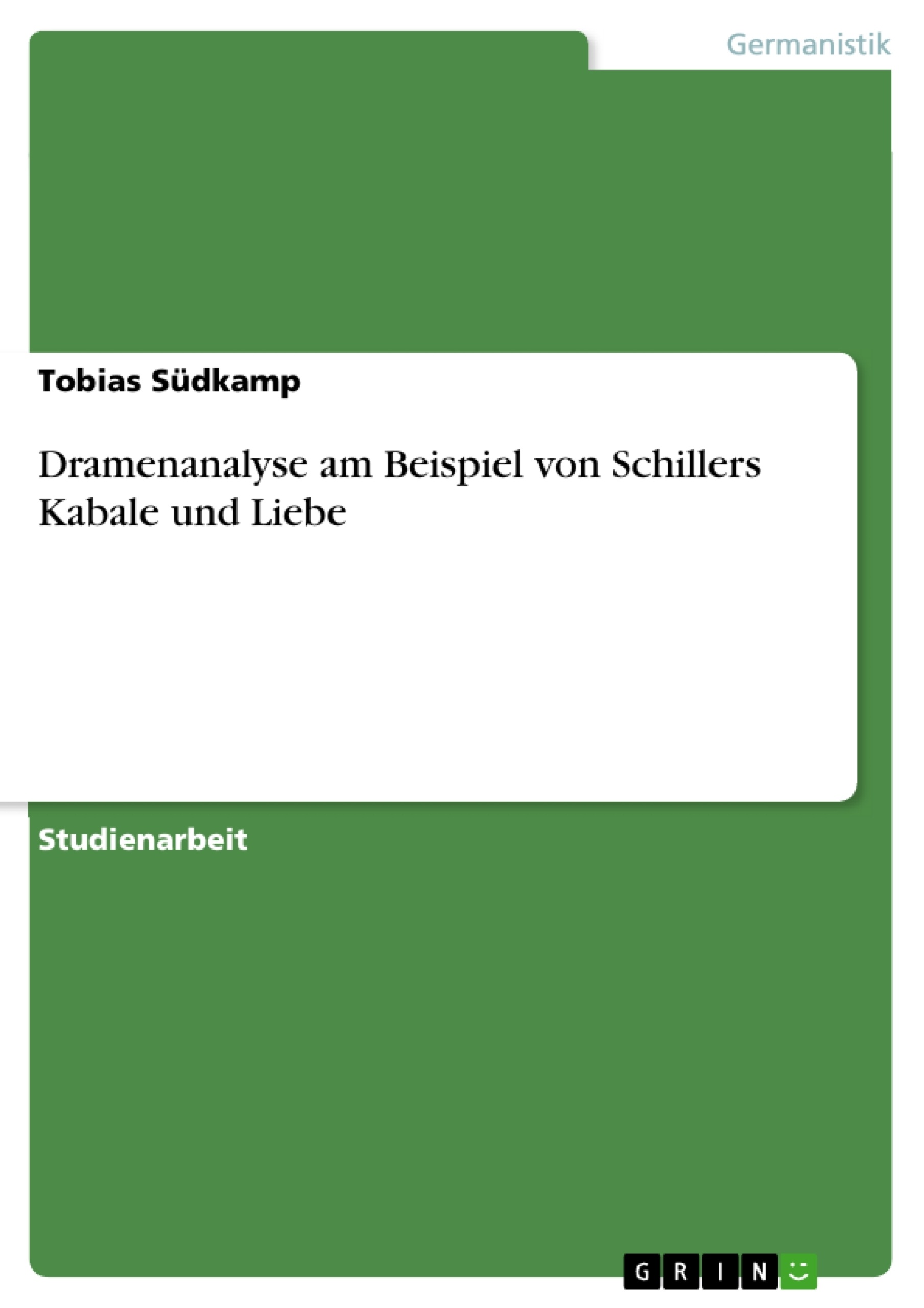Die Exposition eines Dramas ist der „Einleitungsteil einer dramatischen Handlung, in dem in die Verhältnisse und Zustände, aus denen der dramatische Konflikt entspringt, eingeführt und die Vorgeschichte erklärt wird.“ Um jedoch eine Vorgeschichte zu erklären, damit der Zuschauer in das Drama eingeführt wird, muß etwas Vergangenes auf der Bühne vermittelt werden. Hier ergibt sich nun folgendes Problem : Etwas Vergangenes dramatisch darzustellen, ist nicht vereinbar mit dem Absolutheitsgrundsatz des klassischen neuzeitlichen Dramentyps. Nach Szondi ist das Drama absolut, d.h. es muß von allem Äußerlichen losgelöst sein. „Es kennt nichts außer sich.“ Demnach, ist das Drama aufgrund seiner Losgelöstheit nicht mit dem Autor in Bezug zu bringen, da der Autor das Drama nicht geschrieben hat, sondern „Aussprache gestiftet“ hat. Eine Absolutheit besteht auch zwischen dem Drama und dem Zuschauer, so kann das Drama keinesfalls an den Zuschauer direkt adressiert sein. Alle Vorgänge im Drama müssen im <Hier und Jetzt> ablaufen; sie müssen gegenwärtig sein, dies bezeichnet Szondi als primär. „Das Drama ist primär.“ Die Primärität des Dramas ist nach Szondi ein anderer Aspekt für dessen Absolutheit. Da alle szenischen Darstellungen in der Gegenwart stattfinden, ist dies für Szondi ein Grund, „warum historisches Spiel allemal undramatisch ausfällt.“ Eine Exposition im Sinne der obigen Erläuterung, die eine Vorgeschichte, also etwas Vergangenes darstellt, wäre eigentlich undramatisch. In narrativen Texten wird die Exposition vom Erzähler geleistet, der jedoch im Kommunikationsmodell dramatischer Texte keinen Platz findet. Die Funktion des Erzählers in narrativen Texten wird in dramatischen Texten auf das „innere Kommunikationssystem verlagert“. Der Dialog der Figuren im Drama übernimmt die vermittelnde Aufgabe des Erzählers in der Erzählprosa. Das Drama besteht nach Szondi lediglich aus der Wiedergabe der zwischenmenschlichen Beziehungen, die nur durch den Dialog zum Ausdruck gebracht werden können. Die Dialoge der Dramenfiguren präsentieren alle Geschehnisse im Drama, entstehen aus den Umständen der Situation heraus und sind somit gegenwärtige Entschlüsse, die niemals mit der Ausbildung von Gefühlen und Ideen allein beschäftigt sind, sondern immer Absichten erreichen wollen, immer mit ihren Gedanken und Handlungen vorwärts in die Zukunft streben. Dies hat ständige Umwälzungen und Veränderungen des inneren und äußeren Zustandes von selbst und von außen zur Folge. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Zu Aufgabe 1) Die Exposition in Schillers „Kabale und Liebe“
- Zu Aufgabe 2) Der äußere Konflikt in „Kabale und Liebe“
- Zu Aufgabe 3) Perspektivenstruktur und Szondis Forderung nach „Absolutheit“
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit analysiert Schillers „Kabale und Liebe“ anhand dreier spezifischer Aufgaben. Die Arbeit untersucht die Funktion der Exposition, beschreibt den äußeren Konflikt des Dramas und dessen Verlauf im Kontext des klassischen Dramas, und analysiert die Perspektivenstruktur des Textes im Lichte von Szondis Theorie der „Absolutheit“ des Dramas.
- Die Funktion der Exposition in einem klassischen Drama
- Der äußere und innere Konflikt zwischen bürgerlicher und adeliger Gesellschaft
- Die Darstellung des Ständekonflikts und die daraus resultierenden Konsequenzen
- Analyse der Perspektivenstruktur des Dramas
- Szondis Theorie der „Absolutheit“ des Dramas und ihre Relevanz für die Analyse
Zusammenfassung der Kapitel
Zu Aufgabe 1) Die Exposition in Schillers „Kabale und Liebe“: Die Arbeit beleuchtet die besondere Herausforderung der Exposition im klassischen Drama, da die Darstellung von Vorgeschichte im „Hier und Jetzt“ der Bühne stattfinden muss, was im Widerspruch zum Absolutheitsgrundsatz steht. Sie analysiert, wie Schiller dieses Problem in „Kabale und Liebe“ löst, indem er die Exposition durch Dialoge der Figuren in der Gegenwart realisiert, wodurch die Vorgeschichte vermittelt wird, ohne den Absolutheitsgrundsatz zu verletzen. Die Analyse konzentriert sich auf ausgewählte Dialoge aus Akt I, die die familiären Verhältnisse und den Konflikt zwischen Luise und Ferdinand einführen.
Zu Aufgabe 2) Der äußere Konflikt in „Kabale und Liebe“: Dieser Abschnitt beschreibt den zentralen Konflikt des Dramas als einen zwischen bürgerlicher und adeliger Gesellschaft, repräsentiert durch Luise Miller und Ferdinand von Walter. Die Arbeit untersucht die Eskalation dieses Ständekonflikts durch die Liebe zwischen Luise und Ferdinand, und wie dieser äußere Konflikt zu inneren Konflikten bei beiden Figuren führt – den Widerstreit zwischen Pflicht und Neigung. Die Analyse verfolgt den Verlauf des Konflikts, insbesondere die Reaktionen der Figuren auf die Standesschranken und die letztliche katastrophale Auflösung des Konflikts durch den Tod der Liebenden.
Zu Aufgabe 3) Nehmen Sie Stellung zur Perspektivenstruktur des Textes und beziehen Sie ihre Argumentation auf die Forderung Szondis nach „Absolutheit\" des Drames: Der letzte Abschnitt analysiert die Perspektivenstruktur des Dramas, differenziert zwischen Figurenperspektive und der vom Autor intendierten Rezeptionsperspektive. Die Arbeit untersucht, wie die individuellen Perspektiven der Figuren die Handlung und den Konflikt gestalten und wie diese Vielschichtigkeit der Perspektiven mit Szondis Forderung nach der „Absolutheit“ des Dramas in Einklang steht. Die Analyse erörtert, wie die unabhängige Darstellung der Figurenperspektiven die Autonomie des Dramas und seine Loslösung vom Autor unterstreicht.
Schlüsselwörter
Kabale und Liebe, Schiller, Dramenanalyse, Exposition, Konflikt, Ständekonflikt, Absolutheit, Figurenperspektive, Rezeptionsperspektive, klassisches Drama, Dialog, Handlung, Primärität.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu Schillers „Kabale und Liebe“-Analyse
Was ist der Inhalt dieser Hausarbeit?
Diese Hausarbeit analysiert Friedrich Schillers Drama „Kabale und Liebe“ anhand dreier spezifischer Aufgaben. Sie untersucht die Funktion der Exposition, den äußeren Konflikt und dessen Verlauf im Kontext des klassischen Dramas, sowie die Perspektivenstruktur des Textes im Lichte von Szondis Theorie der „Absolutheit“ des Dramas.
Welche Aspekte der Exposition werden behandelt?
Die Analyse beleuchtet die besondere Herausforderung der Exposition im klassischen Drama, die Vorgeschichte im „Hier und Jetzt“ der Bühne darzustellen, ohne den Absolutheitsgrundsatz zu verletzen. Sie untersucht, wie Schiller dies in „Kabale und Liebe“ durch Dialoge der Figuren löst, die die Vorgeschichte vermitteln, ohne den Grundsatz zu verletzen. Der Fokus liegt auf ausgewählten Dialogen aus Akt I.
Wie wird der äußere Konflikt in „Kabale und Liebe“ beschrieben?
Der zentrale Konflikt wird als ein zwischen bürgerlicher und adeliger Gesellschaft, repräsentiert durch Luise Miller und Ferdinand von Walter, beschrieben. Die Arbeit untersucht die Eskalation dieses Ständekonflikts durch die Liebe der beiden und wie dieser äußere Konflikt zu inneren Konflikten (Pflicht vs. Neigung) führt. Die Analyse verfolgt den Konfliktverlauf und dessen katastrophale Auflösung.
Wie wird Szondis Theorie der „Absolutheit“ im Kontext der Perspektivenstruktur angewendet?
Der letzte Abschnitt analysiert die Perspektivenstruktur, differenziert zwischen Figurenperspektive und Rezeptionsperspektive. Es wird untersucht, wie die individuellen Perspektiven die Handlung und den Konflikt gestalten und wie diese Vielschichtigkeit mit Szondis „Absolutheit“ in Einklang steht. Die Analyse erörtert, wie die unabhängige Darstellung der Figurenperspektiven die Autonomie des Dramas und seine Loslösung vom Autor unterstreicht.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kabale und Liebe, Schiller, Dramenanalyse, Exposition, Konflikt, Ständekonflikt, Absolutheit, Figurenperspektive, Rezeptionsperspektive, klassisches Drama, Dialog, Handlung, Primärität.
Welche Aufgaben werden in der Hausarbeit bearbeitet?
Die Hausarbeit bearbeitet drei Aufgaben: 1) Analyse der Exposition in „Kabale und Liebe“, 2) Beschreibung des äußeren Konflikts in „Kabale und Liebe“, und 3) Stellungnahme zur Perspektivenstruktur des Textes im Bezug auf Szondis Forderung nach „Absolutheit“.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Funktion der Exposition im klassischen Drama, den äußeren und inneren Konflikt zwischen bürgerlicher und adeliger Gesellschaft, die Darstellung des Ständekonflikts und dessen Konsequenzen, die Analyse der Perspektivenstruktur und Szondis Theorie der „Absolutheit“.
Gibt es eine Zusammenfassung der Kapitel?
Ja, die Arbeit enthält Kapitelzusammenfassungen, die die zentralen Ergebnisse jedes Abschnitts kurz und prägnant wiedergeben.
- Citation du texte
- Tobias Südkamp (Auteur), 1998, Dramenanalyse am Beispiel von Schillers Kabale und Liebe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57961