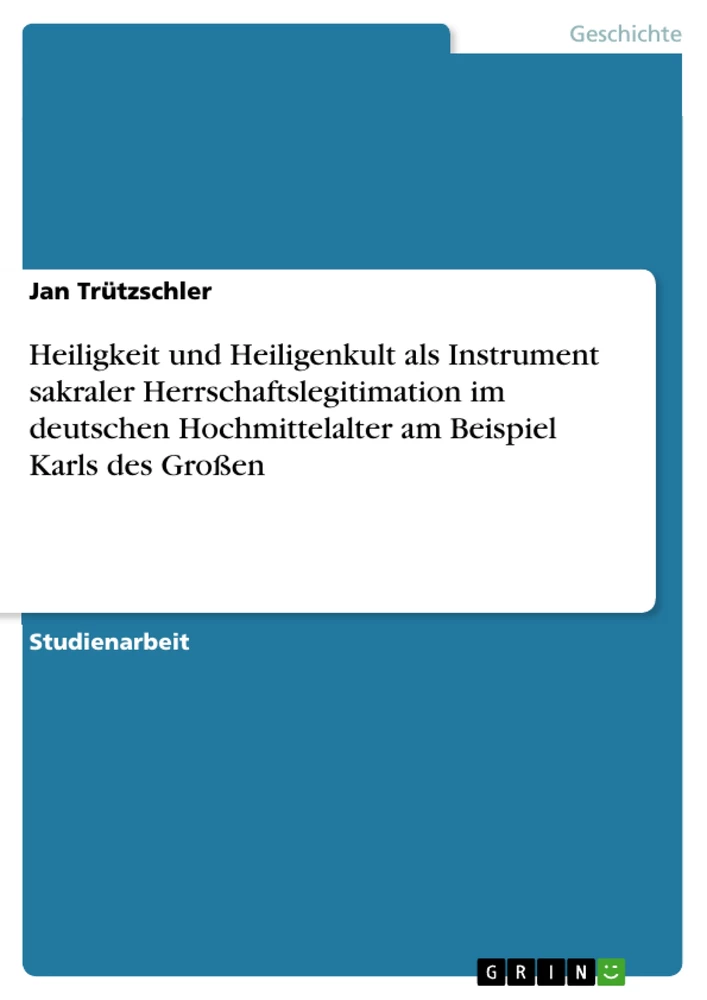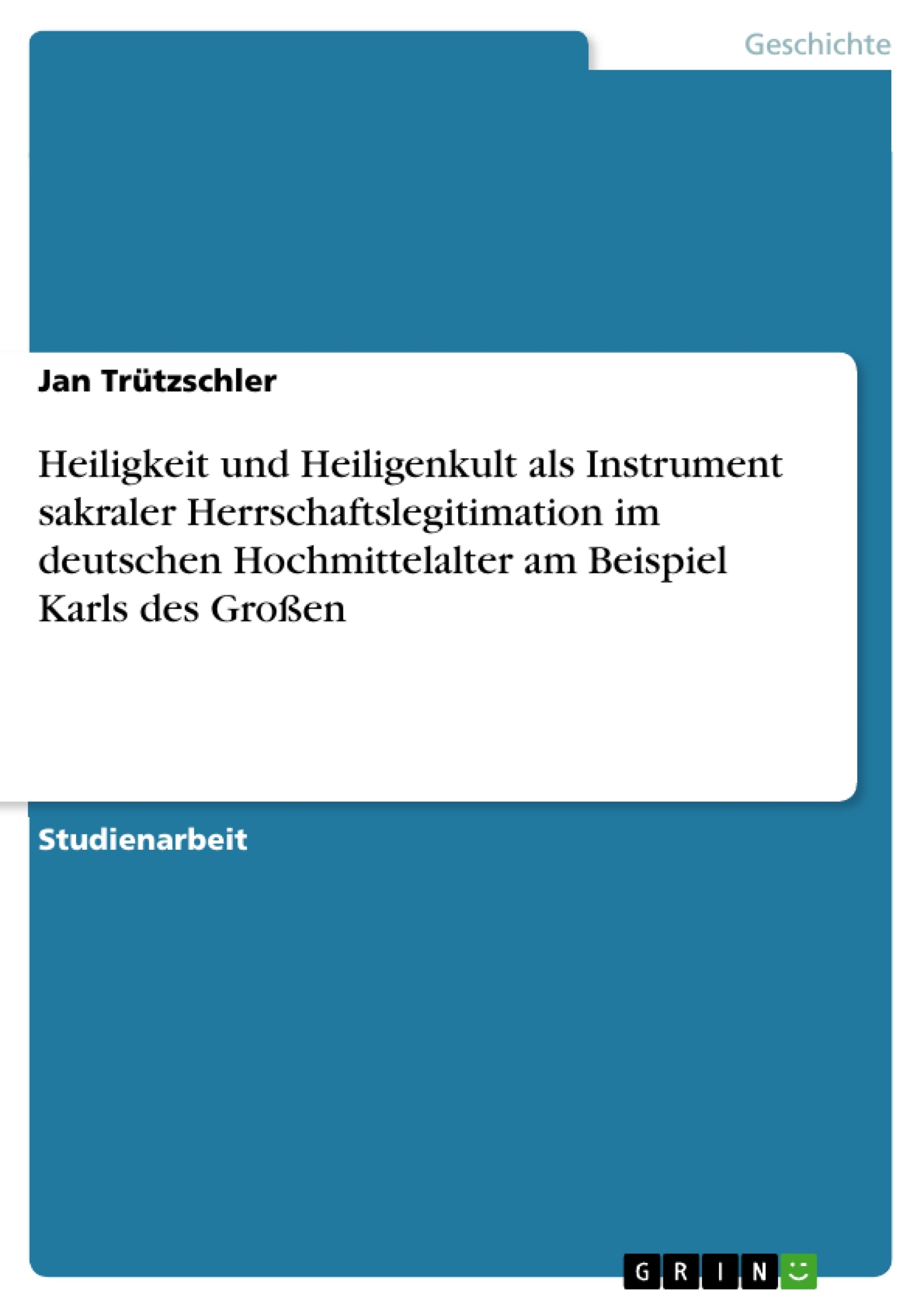Obwohl das mittelalterliche deutsche Kaisertum reich an Heiligen war, brachte es nie einen Nationalheiligen, nach dem Vorbild nahezu aller anderen europäischen Reiche, hervor. Karl der Große kommt als einziger zumindest in die Nähe einer derartigen Institution. Dennoch stellt sich die Frage, inwieweit der Karlskult nicht doch zumindest teilweise diejenige Funktionalität an Integration und Legitimation erbringen konnte, die andere Kulte anderswo in Europa zu leisten imstande waren. Um diese Frage zu beantworten, scheint es zunächst notwendig, zu klären, was mittelalterliche Heiligkeit denn überhaupt ausmachte, um so eine solide Grundlage für die weitere Erarbeitung zu schaffen. Anschließend gilt es, aus der Betrachtung mittelalterlichen Kulthandelns in seiner Wirksamkeit und dem zeitgenössischen Karlsbild darauf zu schließen, über welches politische, kulturelle und religiöse Potential die Karlsfigur in ihrer Heiligkeit verfügte. In einem letzten Schritt muss es dann darum gehen, zu untersuchen, wie Friedrich I. und Friedrich II., also die beiden Kaiser die sich in besonderer Weise auf Karl den Großen bezogen, dieses Potential in ihrem kultischen Handeln ausschöpften. Dabei werden zum einen Wirkungen auf den unmittelbaren politischen Kontext zu betrachten sein, zum anderen aber auch das wesentlich abstraktere Moment der sakralen Legitimation einer gottunmittelbaren deutschen Kaiserwürde vor dem Hintergrund des schwellenden Konflikts um die Stellung des Kaisertums zum Papsttum. Als wertvolle Grundlage dieser Arbeit hat sich Jürgen Petersohns Aufsatz „Kaisertum und Kultakt in der Stauferzeit“ erwiesen. Für die Erarbeitung des mittelalterlichen Kultbegriffs wurden einschlägige Veröffentlichungen Gerd Althoffs herangezogen. Die Ausführungen zum Karlsbild basieren im Wesentlichen auf dem Aufsatz „Heros und Heiliger, Literarische Karlsbilder im mittelalterlichen Frankreich und Deutschland“ von Bernd Bastert.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Hauptteil
- 1. Der christliche Heiligkeitsbegriff
- 1.1 Heiligkeit als Verhaltensideal
- 1.2 Die Manifestation von Heiligkeit in äußeren Zeichen
- 2. Kultakte und Rituale als mittelalterliches Herrschaftsinstrument
- 3. Die Beteiligung deutscher Kaiser an Heiligenkulten
- 4. Das deutsche Karlsbild im Hochmittelalter
- 5. Deutsche Kaiser bei Kultakten um Karl den Großen
- 5.1 Friedrich I. und die Kanonisation Karls des Großen 1165 in Aachen
- 5.2 Friedrich II. und die Schreinlegung 1215 im Aachener Münster
- 6. Das Kulthandeln Friedrichs I. und Friedrichs II
- 1. Der christliche Heiligkeitsbegriff
- III. Fazit
- IV. Literaturverzeichnis
- V. Quellenverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die Funktion des Heiligenkultes, insbesondere um Karl den Großen, als Instrument der sakralen Herrschaftslegitimation im deutschen Hochmittelalter. Sie befasst sich mit der Frage, inwieweit der Karlskult die Integrations- und Legitimationsfunktion anderer europäischer Heiligenkulte erfüllte. Die Arbeit analysiert den mittelalterlichen Heiligkeitsbegriff, das Kulthandeln und das zeitgenössische Karlsbild, um das politische, kulturelle und religiöse Potential der Karlsfigur zu beleuchten und dessen Nutzung durch Kaiser Friedrich I. und Friedrich II. zu untersuchen.
- Der mittelalterliche christliche Heiligkeitsbegriff und seine Manifestation
- Kultakte und Rituale als Herrschaftsinstrumente im Hochmittelalter
- Das deutsche Karlsbild und seine Bedeutung für die Kaiser
- Die Rolle der Kaiser Friedrich I. und Friedrich II. im Karlskult
- Sakrale Legitimation der deutschen Kaiserwürde im Kontext des Verhältnisses zum Papsttum
Zusammenfassung der Kapitel
I. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Funktion des Karlskultes für die Legitimation der deutschen Kaiser im Hochmittelalter. Sie skizziert den methodischen Ansatz, der die Untersuchung des mittelalterlichen Heiligkeitsbegriffes, des Kulthandelns und des zeitgenössischen Karlsbildes umfasst, um die Handlungen Friedrichs I. und Friedrichs II. im Kontext des Verhältnisses zum Papsttum zu analysieren. Die Arbeit betont die Bedeutung von Petersohns Aufsatz über Kaisertum und Kultakt sowie Althoffs und Basterts Veröffentlichungen für die Forschungsarbeit.
II. Hauptteil: Der Hauptteil gliedert sich in mehrere Kapitel, die den Heiligkeitsbegriff, das Kulthandeln im Mittelalter, die Beteiligung deutscher Kaiser an Heiligenkulten, das Karlsbild und die Handlungen Friedrichs I. und II. im Kontext des Karlskultes untersuchen. Er analysiert den christlichen Heiligkeitsbegriff im Mittelalter, seine Manifestation in äußeren Zeichen wie Wundertätigkeit und die Bedeutung der Reliquien. Der Hauptteil untersucht weiter die Nutzung von Kultakten und Ritualen als Herrschaftsinstrument im Mittelalter und beleuchtet die Rolle deutscher Kaiser im Heiligenkult. Abschließend analysiert der Hauptteil das deutsche Karlsbild und wie die Kaiser Friedrich I. und II. das Potential der Karlsfigur in ihrem kultischen Handeln ausgeschöpft haben, sowohl im unmittelbaren politischen Kontext als auch im Hinblick auf die sakrale Legitimation der Kaiserwürde im Konflikt mit dem Papsttum.
Schlüsselwörter
Heiligkeit, Heiligenkult, Karl der Große, sakrale Herrschaftslegitimation, deutsches Hochmittelalter, Kaiser Friedrich I., Kaiser Friedrich II., Papsttum, Kultakte, Rituale, mittelalterlicher Heiligkeitsbegriff, Karlsbild, politische Legitimation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Analyse des Karlskultes im Hochmittelalter
Was ist das zentrale Thema dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht die Funktion des Heiligenkultes um Karl den Großen als Instrument der sakralen Herrschaftslegitimation im deutschen Hochmittelalter, insbesondere im Hinblick auf die Handlungen der Kaiser Friedrich I. und Friedrich II. Sie analysiert, inwieweit der Karlskult die Integrations- und Legitimationsfunktion anderer europäischer Heiligenkulte erfüllte.
Welche Aspekte werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt den mittelalterlichen christlichen Heiligkeitsbegriff und seine Manifestation, Kultakte und Rituale als Herrschaftsinstrumente, das deutsche Karlsbild und dessen Bedeutung für die Kaiser, die Rolle Friedrichs I. und Friedrichs II. im Karlskult, und die sakrale Legitimation der deutschen Kaiserwürde im Kontext des Verhältnisses zum Papsttum.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, einen Hauptteil mit mehreren Unterkapiteln zum Heiligkeitsbegriff, Kulthandeln, Beteiligung deutscher Kaiser an Heiligenkulten, dem Karlsbild und den Handlungen Friedrichs I. und II., sowie ein Fazit, Literatur- und Quellenverzeichnis.
Was ist der methodische Ansatz der Arbeit?
Die Arbeit untersucht den mittelalterlichen Heiligkeitsbegriff, das Kulthandeln und das zeitgenössische Karlsbild, um die Handlungen Friedrichs I. und Friedrichs II. im Kontext des Verhältnisses zum Papsttum zu analysieren. Die Arbeit bezieht sich auf wichtige Aufsätze von Petersohn, Althoff und Basterts zu Kaisertum und Kultakten.
Welche konkreten Handlungen von Friedrich I. und Friedrich II. werden untersucht?
Die Arbeit analysiert die Handlungen Friedrichs I. bei der Kanonisation Karls des Großen 1165 in Aachen und die Handlungen Friedrichs II. bei der Schreinlegung 1215 im Aachener Münster. Generell wird ihr kultisches Handeln im Kontext des Karlskultes und der sakralen Legitimation ihrer Kaiserwürde untersucht.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Heiligkeit, Heiligenkult, Karl der Große, sakrale Herrschaftslegitimation, deutsches Hochmittelalter, Kaiser Friedrich I., Kaiser Friedrich II., Papsttum, Kultakte, Rituale, mittelalterlicher Heiligkeitsbegriff, Karlsbild, politische Legitimation.
Welche Quellen werden in der Arbeit verwendet?
Die Arbeit nennt ein Literatur- und ein Quellenverzeichnis (genaue Angaben sind im Dokument enthalten). Die Arbeit bezieht sich explizit auf die Forschungsarbeiten von Petersohn, Althoff und Basterts.
Für wen ist diese Arbeit bestimmt?
Diese Arbeit ist für akademische Zwecke bestimmt, insbesondere zur Analyse von Themen im Bereich der mittelalterlichen Geschichte und des Heiligenkultes.
- Citar trabajo
- Jan Trützschler (Autor), 2006, Heiligkeit und Heiligenkult als Instrument sakraler Herrschaftslegitimation im deutschen Hochmittelalter am Beispiel Karls des Großen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57970