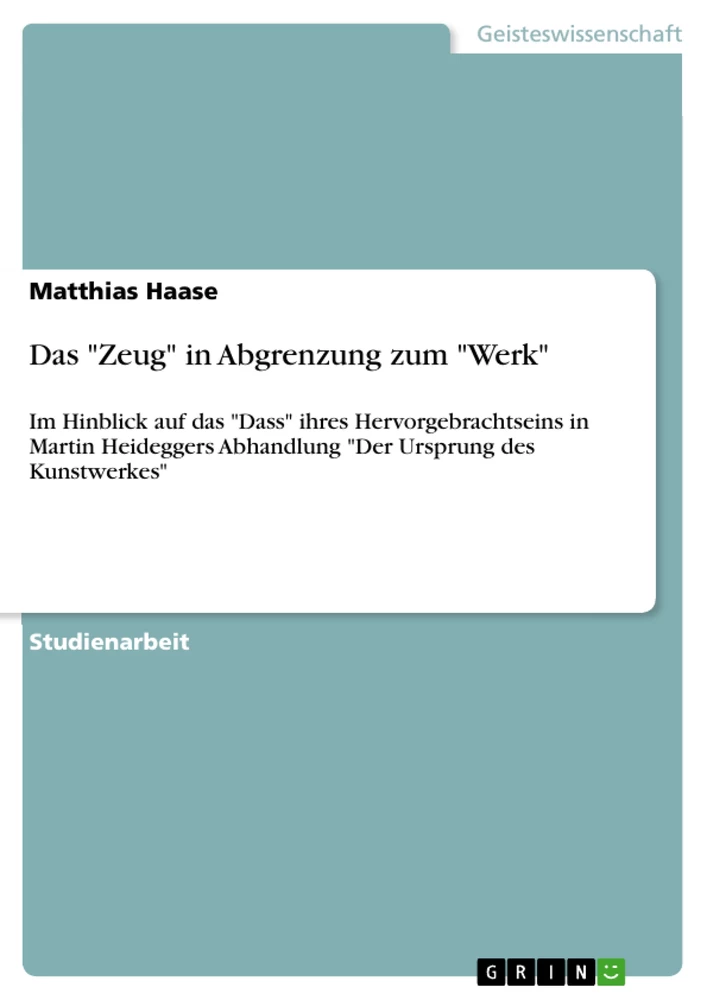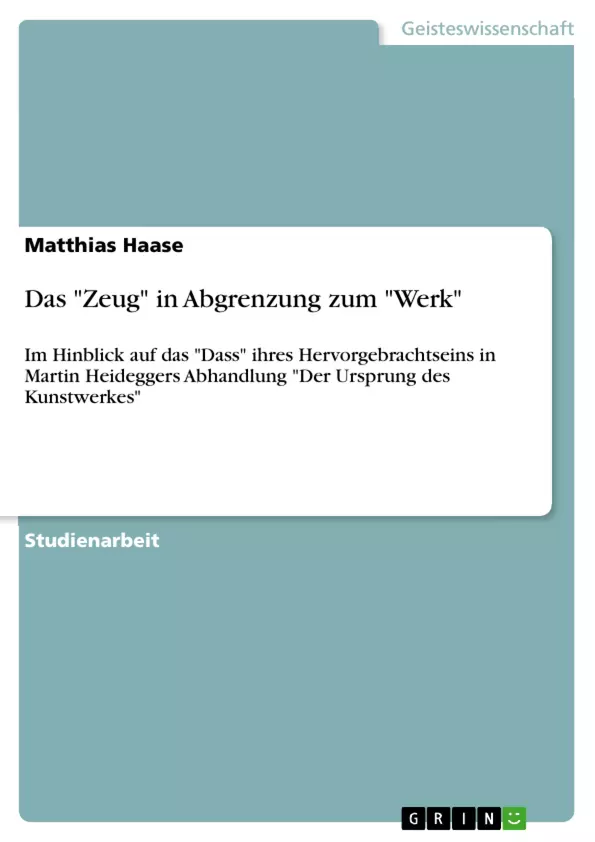Die vorliegende Arbeit veranschaulicht zunächst, wie tief der Begriff "Zeug" in Martin Heideggers Kunstwerk-Abhandlung "Der Ursprung des Kunstwerkes" eingebettet im Verborgenen liegt. Auf dem Weg der Hinführung zum Begriff "Zeug" wird deutlich, welche anderen Begriffe zunächst beiseite gestellt werden müssen, um das "Zeug" zu lokalisieren und es für eine Bearbeitung zugänglich zu machen. Der Argumentationsweg führt über landläufige und abendländisch überlieferte Begriffe wie "Werk", "Ding", "Form und Stoff", "Dienlichkeit" bis hin zum "Erzeugnis Um-zu". An dieser Stelle setzt der Begriff "Zeug" an, der sich im Hinblick auf das "Dass seines Hervorgebrachtseins" wesentlich vom Begriff "Werk" unterscheidet: Heidegger trennt "Künstlerisches Geschaffensein" (betrifft den Begriff "Werk") von "handwerklichem Angefertigtsein" (betrifft den Begriff "Zeug").
Martin Heideggers Abhandlung fragt eingangs nach der "Wesensherkunft" des Kunstwerkes, oder anders ausgedrückt, nach der "Herkunft des Wesens des Kunstwerkes". In der Auslegung von Friedrich Wilhelm von Herrmann beinhaltet der Begriff "Ursprung" nach Martin Heidegger zum einen die Frage 1.) nach dem "Vonwoher und Wodurch" eine Sache ist, welche als die Frage nach der Herkunft der Sache bestimmt wird, und zum anderen 2.) beinhaltet der Begriff "Ursprung" die Frage nach dem "Was- und Wiesein" der Sache, welche als die Frage nach dem Wesen der Sache bestimmt wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Hinführung zum Begriff „Zeug“
- Hinführung zur Frage nach dem Wesen des wirklichen Werkes
- Hinführung zur Frage nach dem Wesen der Kunst
- Wandlung der Frage nach dem Wesen der Kunst in die Frage nach dem Wesen des Kunstwerkes
- Kreisgang im Fragen „vom Werk zur Kunst“ und gleichzeitig „von der Kunst zum Werk“
- Begegnung mit dem „Ding“ auf dem Weg der „Suche nach dem Wesen des wirklichen Werkes“
- Begegnung mit dem „Zeug“ auf dem Weg der „Suche nach dem ursprünglichen Dingsein des Dings“
- Suche nach dem Dinglichen im „Ding als Träger seiner Eigenschaften“
- Suche nach dem Dinglichen im „Ding als das in den Sinnen der Sinnlichkeit durch Empfindungen Vernehmbare“
- Suche nach dem Dinglichen im „Ding als Einheit von Stoff und Form“
- Ursprung des „Stoff-Form-Gefüges“ des Gebrauchsdings im „Wozu seiner Dienlichkeit“
- „Erzeugnis zu Etwas“ – das „Zeug“
- Hinführung zur Frage nach dem Wesen des wirklichen Werkes
- Der Begriff „Zeug“
- Persönliche Beschreibung aus dem Alltag in Anlehnung an Martin Heideggers Interpretation des van Gogh Gemäldes „Ein Paar Schuhe“
- „Zuhandenheit“ und „Dienlichkeit“
- „Verlässlichkeit“
- „Auffälligkeit, Aufdringlichkeit, Aufsässigkeit“
- „Fertigsein“
- Das „Zeug“ in Abgrenzung zum „Werk“ im Hinblick auf das „Dass“ ihres Hervorgebrachtseins
- Künstlerisches Geschaffensein und handwerkliches Angefertigtsein
- Das „Dass“ des Geschaffenseins
- Ergebnis
- Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Abhandlung „Der Ursprung des Kunstwerkes“ von Martin Heidegger befasst sich mit der Frage nach dem Wesen des Kunstwerkes und seiner Entstehung. Sie untersucht die Tradition des Denkens über Kunst, insbesondere die subjektivistische Deutung des künstlerischen Schaffens, und bietet eine neue Herangehensweise an die Frage nach dem Ursprung der Kunst.
- Der Begriff des „Zeug“ als zentrales Element der Heideggerschen Kunstphilosophie
- Die Unterscheidung zwischen „Werk“ und „Zeug“ im Kontext des künstlerischen Schaffens
- Die Bedeutung des „Dass“ des Hervorgebrachtseins für die Entstehung von Kunstwerken
- Die Rolle von „Zuhandenheit“ und „Dienlichkeit“ in der Konzeption des „Zeug“
- Die Kritik an der traditionalistischen Sichtweise auf die Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt den Leser in die Thematik ein und beleuchtet die Bedeutung des Begriffs „Zeug“ in Heideggers Abhandlung. Sie erklärt, wie Heidegger zu seinem Begriff gelangt und welche anderen Begriffe er zunächst hinterfragt, um das „Zeug“ zu lokalisieren.
Das zweite Kapitel erörtert den Begriff „Zeug“ im Kontext der Suche nach dem Wesen des wirklichen Werkes. Es untersucht, wie die Frage nach dem Wesen der Kunst in die Frage nach dem Wesen des Kunstwerkes überführt wird und wie der Weg zur „Suche nach dem ursprünglichen Dingsein des Dings“ führt.
Das dritte Kapitel widmet sich dem Begriff „Zeug“ selbst. Es präsentiert eine persönliche Beschreibung aus dem Alltag in Anlehnung an Heideggers Interpretation des van Gogh Gemäldes „Ein Paar Schuhe“ und beleuchtet die „Zuhandenheit“ und „Dienlichkeit“ des „Zeug“ im Vergleich zum „Werk“.
Das vierte Kapitel untersucht die Abgrenzung des „Zeug“ vom „Werk“ im Hinblick auf das „Dass“ ihres Hervorgebrachtseins. Es analysiert das künstlerische Geschaffensein und das handwerkliche Angefertigtsein und zeigt, wie das „Dass“ des Geschaffenseins eine wichtige Rolle spielt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen der Abhandlung sind die „Wesensherkunft des Kunstwerkes“, das „Zeug“ als zentrales Element der Heideggerschen Kunstphilosophie, die Unterscheidung zwischen „Werk“ und „Zeug“, das „Dass“ des Hervorgebrachtseins, „Zuhandenheit“ und „Dienlichkeit“, sowie die Kritik an der traditionellen Sichtweise auf die Kunst.
- Quote paper
- Matthias Haase (Author), 2006, Das "Zeug" in Abgrenzung zum "Werk", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57978