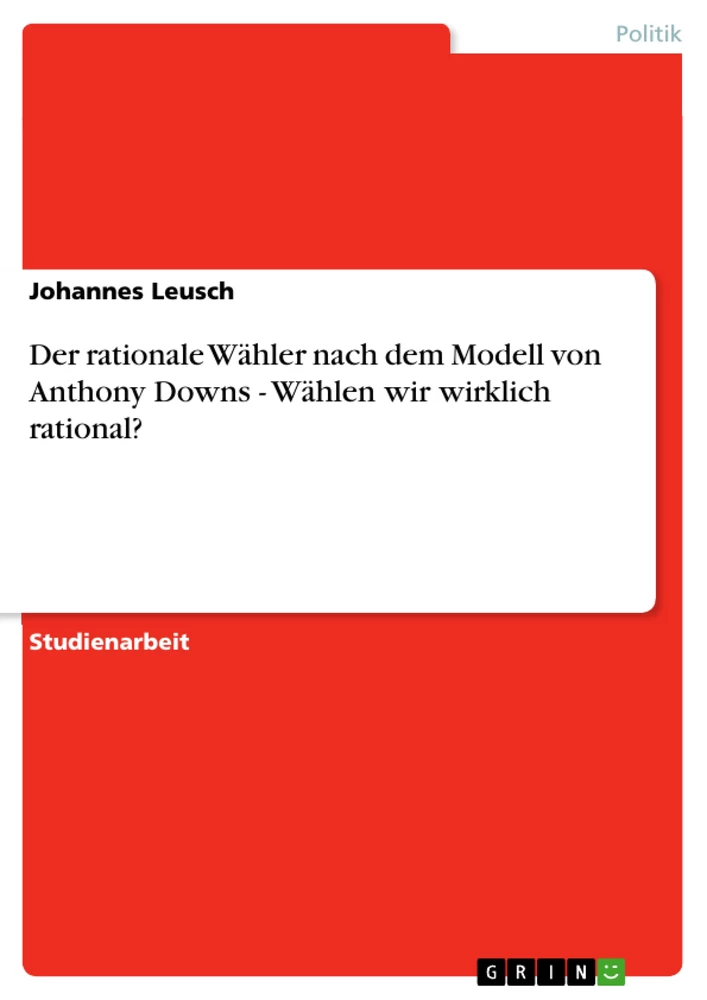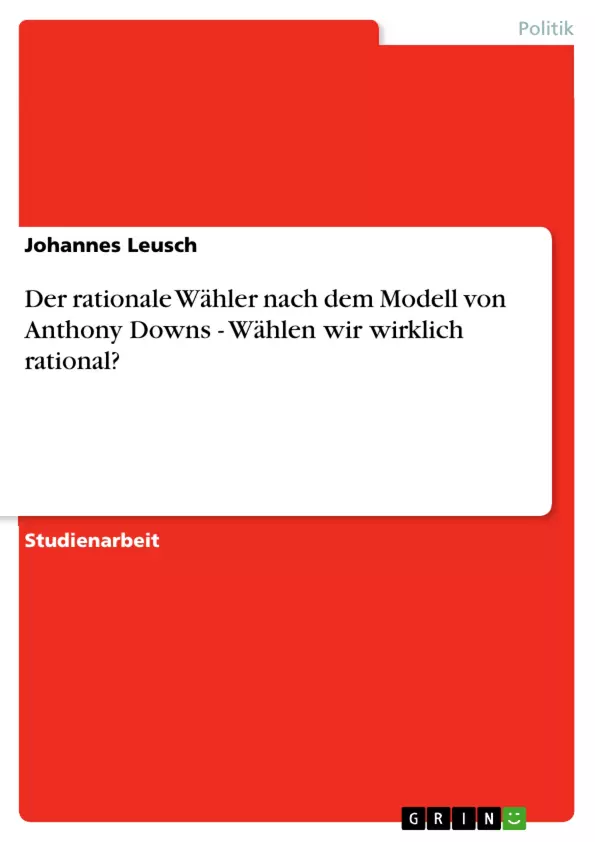In der Wahlforschung gibt es mehrere Theorien, mit den versucht wird zu erforschen, warum sich Wähler und Parteien in einer gewissen Art und Weise verhalten. Der Rational Choice Ansatz bietet in der Wahlforschung die Möglichkeit, dass Handeln der Akteure auf einfache Weise zu analysieren und zu prognostizieren. So wird mit dem Menschenbild, des homo oeconomicus nur die Kosten- und Nutzenseite des Akteurs betrachtet. Durch die Grundannahmen der Rational Choice Theorie, die besagt, dass die Akteure immer nach dem Prinzip der Nutzenmaximierung handeln und deren Präferenzen stabil bleiben, sind die einzigen Variablen die Restriktionen der Akteure. Die Akteure berechnen aufgrund der Restriktionen ihr Nutzenniveau und treffen daraufhin ihre Entscheidungen.
Somit lässt sich zum Beispiel der Ausgang einer Wahl einfach vorhersagen oder ein Wahlergebnis erklären. Doch es stellt sich die Frage, ob sich das Verhalten der Akteure auf der Makroebene einzig durch rationales Handeln erklären lässt, oder ob der Wähler nicht rational handelt. In der folgenden Arbeit wird detailliert auf das Modell des rationalen Wählers von Anthony Downs eingegangen, das auf den Grundlagen der Rational Choice Theorie beruht. Das Menschenbild des rationalen Wählers wird durchleuchtet und dessen Präferenzbildung begründet. Des Weiteren wird aufgezeigt, welche Widersprüchlichkeiten in Down´s Modell auftreten, und welche Lösungsversuche es gibt, diese zu lösen.
Im letzten Abschnitt der Arbeit wird das Modell des rationalen Wählers auf ein Praxisbeispiel angewendet. Es wird überprüft, ob sich der Wahlerfolg der Linkspartei bei der Bundestagswahl 2005 anhand von diesem Modell erklären lässt. Die Angebotsseite des Modells ist nicht Teil dieser Arbeit, da dies den Themenrahmen überschreiten würde.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das Modell des rationalen Wählers nach Anthony Downs
- Grundannahmen
- Die Wähler
- Das Parteiendifferential
- Verhaltensunterschiede zwischen Zwei- Oder Mehrparteiensystemen
- Kritik
- Informationskosten
- Das Nichtwählerparadoxon
- Lösungsansätze
- Kostenminimierung
- Nutzenüberschätzung
- Opportunitätskosten
- Fallbeispiel Das Abschneiden der Linkspartei bei der Bundestagswahl 2005
- Das Wählerprofil
- Der Parteienwettbewerb
- Informations- und Opportunitätskosten
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert das Modell des rationalen Wählers nach Anthony Downs und untersucht, ob sich das Wahlverhalten anhand dieses Modells erklären lässt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Untersuchung der Grundannahmen des Modells, der Kritikpunkte und möglichen Lösungsansätzen sowie der Anwendung des Modells auf ein Praxisbeispiel.
- Das Modell des rationalen Wählers nach Downs
- Kritikpunkte des Modells
- Lösungsansätze für die Kritikpunkte
- Anwendung des Modells auf die Bundestagswahl 2005
- Die Rolle von Informationskosten und Opportunitätskosten bei der Wahlentscheidung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und erläutert den Kontext der Wahlforschung. Kapitel 2 präsentiert das Modell des rationalen Wählers nach Downs, inklusive der Grundannahmen, der Charakterisierung des rationalen Wählers und der Berechnung des Parteiendifferentials. Kapitel 3 widmet sich der Kritik am Modell, einschließlich der Problematik von Informationskosten, dem Nichtwählerparadoxon und möglichen Lösungsansätzen. Das Kapitel 4 illustriert das Modell anhand des Beispiels der Linkspartei bei der Bundestagswahl 2005 und untersucht die Rolle von Informations- und Opportunitätskosten bei der Wahlentscheidung.
Schlüsselwörter
Rationaler Wähler, Anthony Downs, Wahlforschung, Rational Choice Theorie, Nutzenmaximierung, Informationskosten, Nichtwählerparadoxon, Parteiendifferential, Bundestagswahl 2005, Linkspartei.
- Quote paper
- Johannes Leusch (Author), 2006, Der rationale Wähler nach dem Modell von Anthony Downs - Wählen wir wirklich rational?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/57984