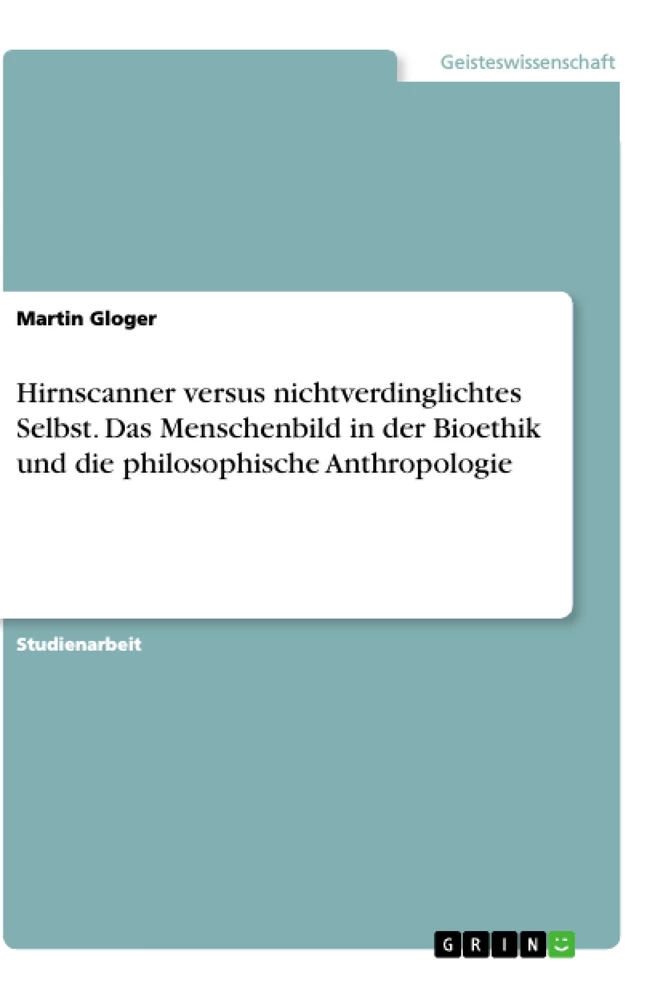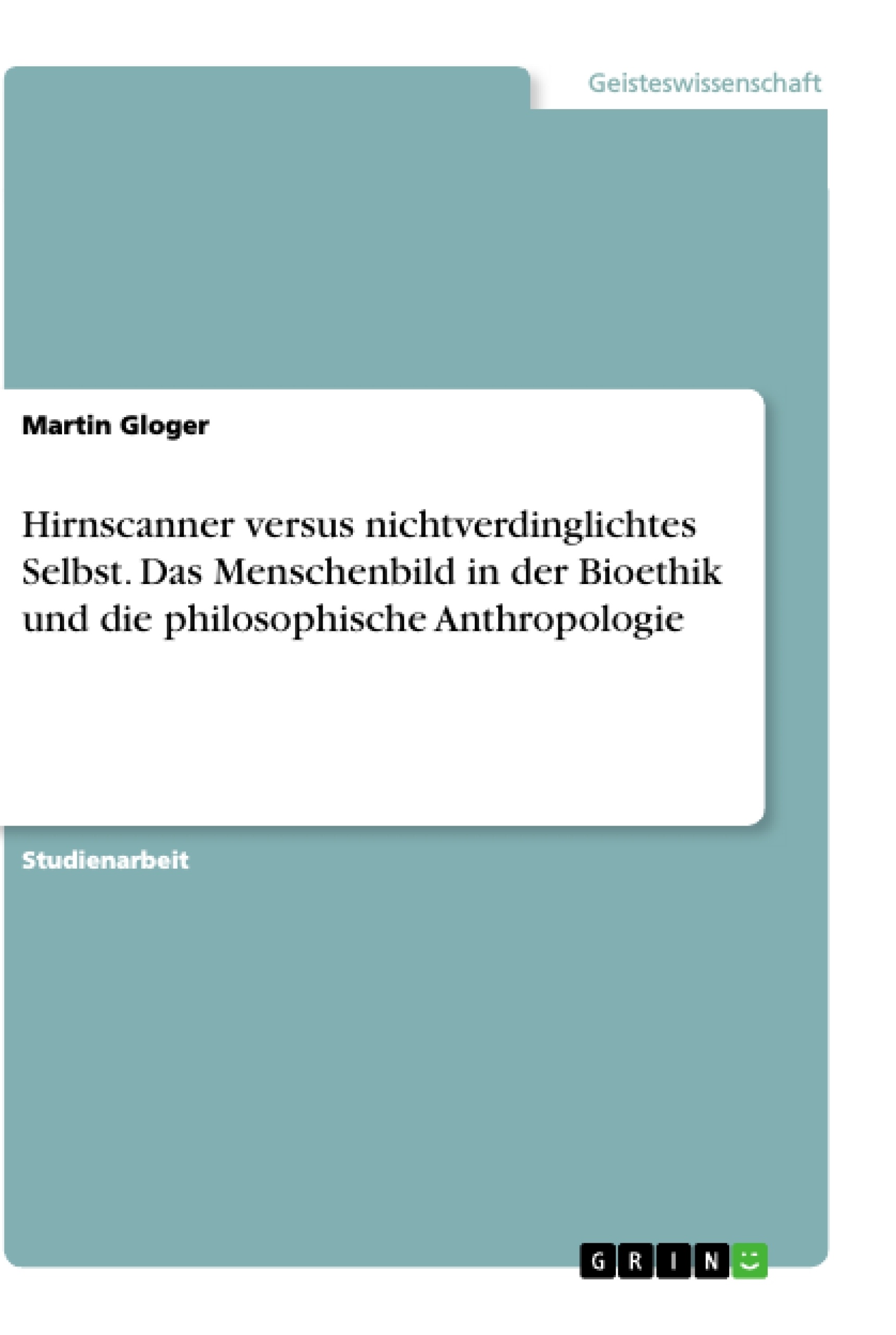Am Anfang beschäftigt sich die Arbeit mit der Frage nach dem Menschenbild in der Bioethik. Recherchen ergaben Bestrebungen, neurowissenschaftliche Methoden zur Verbesserung der Denkfähigkeit des Menschen einzusetzen. Aus der Idee, nach dem Menschenbild hinter einem solchen Apparat zu fragen, wuchs die These für die vorliegende Arbeit, dass durch diese Praktiken der Mensch verdinglicht bzw. objektiviert wird, was dem Menschen nicht gerecht wird.
Vorstellungen, dass Lernprozesse und Erfahrungen sich lediglich auf neurophysiologische Prozesse beziehen, überzeugen nicht. Aus soziologischer Perspektive stellen sich Zweifel an der Nützlichkeit neurophysiologischer Methoden zur Verbesserung der Lernfähigkeit: Bildungserfolg kann nicht allein auf biologische Faktoren reduziert werden. Die Frage, welche Intelligenz man denn benötige, um ein gutes Abitur zu schreiben, kann praktisch nicht beantwortet werden.
Aus soziologischer Sicht wird auf diese und ähnliche Fragen sehr häufig geantwortet, dass vor allem die Anzahl von Büchern im Elternhaus, der Fernsehkonsum und weitere Faktoren, wie die Höhe des Taschengeldes für den Bildungserfolg ausschlaggebend seien. Eine normale bis überdurchschnittliche Intelligenz ist für einen erfolgreichen Bildungsabschluss hilfreich, die reicht aber oft nicht allein, wenn das Kind z. B. viel Ablenkung, kein Vorbild zum Nacheifern oder keinen eigenen Arbeitsplatz im Elternhaus hat.
Ein erfolgreicher Bildungsabschluss kann aus systemtheoretischer Perspektive möglicherweise als gelungene Kommunikation betrachtet werden, in der Sprechsituation einer Prüfung wird der gewünschte Inhalt in syntaktisch wohlgeformten Sätzen kommuniziert, was zu einem erfolgreichen Bestehen der Prüfung führt. Aber auch hinsichtlich der Erklärungskraft der soziologischen Perspektive stellen sich Zweifel ein:
Es wird in der Soziologie wenig über die Wechselwirkungen von Leib und Seele gesagt, die im Bildungsprozess eine eigene Dynamik entfalten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Nicht-medizinischen Nutzungen neurologischer Diagnostik
- Fortschritte der bildgebenden Verfahren
- Private Anwendungen eines Gehirnscanners
- Helmut Plessners Philosophische Anthropologie
- Die Doppelnatur des Menschen
- Der Mensch als Maschine
- Ethische Implikationen eines privaten Gehirnscanners
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die ethischen Implikationen der nicht-medizinischen Nutzung von Gehirnscannern, insbesondere im privaten Kontext. Sie hinterfragt die Reduktion des Menschen auf rein neurophysiologische Prozesse und setzt diese Perspektive in Relation zur philosophischen Anthropologie Helmut Plessners. Die Arbeit beleuchtet die Grenzen neurowissenschaftlicher Erklärungen für komplexe menschliche Phänomene wie Lernen und Erfahrung.
- Verdinglichung des Menschen durch neurowissenschaftliche Methoden
- Grenzen der Neurowissenschaften in der Erklärung menschlichen Erlebens
- Philosophische Anthropologie als Gegenposition zur rein naturwissenschaftlichen Betrachtung
- Ethische Bewertung der privaten Nutzung von Gehirnscannern
- Die Rolle von Leidenschaft und sinnlicher Erfahrung im Lernprozess
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung der Arbeit ein: die kritische Auseinandersetzung mit der Verdinglichung des Menschen durch die Anwendung neurowissenschaftlicher Methoden zur Optimierung von Lernprozessen. Sie verortet die Arbeit im Kontext der Bioethik und zeigt die Grenzen soziologischer und neurowissenschaftlicher Perspektiven auf, indem sie die Bedeutung von Leidenschaft, sinnlicher Erfahrung und der Komplexität menschlicher Prozesse betont. Der Fokus liegt auf der Frage, ob eine rein neurophysiologische Betrachtungsweise dem Wesen des Menschen gerecht wird. Der Autor verweist auf die Notwendigkeit einer umfassenderen Perspektive, die die philosophische Anthropologie bieten könnte.
Nicht-medizinischen Nutzungen neurologischer Diagnostik: Dieses Kapitel befasst sich mit den Fortschritten in der bildgebenden Verfahren der Neurologie und deren nicht-medizinischer Anwendung. Es kritisiert die Vereinfachung komplexer Hirnprozesse durch die Darstellung in Bildern, die den Eindruck erwecken, man könne dem Menschen beim Denken zusehen. Der Autor betont die komplexe Interpretation der Ergebnisse und die Gefahr einer Reduktion des Menschen auf seine Hirnaktivität. Der Fokus liegt auf der kritischen Betrachtung der Popularisierung neurowissenschaftlicher Erkenntnisse und der damit verbundenen Versimplifizierung.
Helmut Plessners Philosophische Anthropologie: Dieses Kapitel führt in die philosophische Anthropologie Helmut Plessners ein, um eine alternative Perspektive zur rein naturwissenschaftlichen Betrachtung des Menschen zu entwickeln. Es werden zentrale Konzepte Plessners, wie die „Doppelnatur des Menschen“ und die Kritik an einer rein mechanistischen Sichtweise des Menschen diskutiert. Die Ausführungen dienen dazu, die Grenzen der neurowissenschaftlichen Perspektive aufzuzeigen und die Komplexität des Menschseins zu betonen. Der Autor argumentiert, dass Plessners Philosophie ein besseres Verständnis des Menschen ermöglicht als die rein neurophysiologische Betrachtung.
Schlüsselwörter
Philosophische Anthropologie, Hirnscanner, Neurowissenschaften, Verdinglichung, Objektivierung, Ethik, Lernen, Erfahrung, Helmut Plessner, Max Weber, Bioethik, menschliches Selbst.
Häufig gestellte Fragen (FAQs) zu: Ethische Implikationen der nicht-medizinischen Nutzung von Gehirnscannern
Was ist der Gegenstand der vorliegenden Arbeit?
Die Arbeit untersucht kritisch die ethischen Implikationen der nicht-medizinischen Nutzung von Gehirnscannern, insbesondere im privaten Kontext. Sie hinterfragt die Reduktion des Menschen auf rein neurophysiologische Prozesse und setzt diese Perspektive in Relation zur philosophischen Anthropologie Helmut Plessners. Ein zentraler Punkt ist die Frage, ob eine rein neurophysiologische Betrachtungsweise dem Wesen des Menschen gerecht wird.
Welche Themenschwerpunkte werden behandelt?
Die Arbeit beleuchtet die Verdinglichung des Menschen durch neurowissenschaftliche Methoden, die Grenzen der Neurowissenschaften in der Erklärung menschlichen Erlebens, die philosophische Anthropologie als Gegenposition zur rein naturwissenschaftlichen Betrachtung, die ethische Bewertung der privaten Nutzung von Gehirnscannern und die Rolle von Leidenschaft und sinnlicher Erfahrung im Lernprozess.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in jedem Kapitel?
Die Arbeit besteht aus einer Einleitung, einem Kapitel über nicht-medizinische Nutzungen neurologischer Diagnostik, einem Kapitel über Helmut Plessners philosophische Anthropologie und einem Fazit. Die Einleitung führt in die zentrale Fragestellung ein. Das Kapitel über die nicht-medizinischen Nutzungen neurologischer Diagnostik befasst sich mit den Fortschritten in der bildgebenden Verfahren und deren nicht-medizinischer Anwendung, inklusive Kritik an Vereinfachungen. Das Kapitel über Plessners Anthropologie bietet eine alternative Perspektive zur rein naturwissenschaftlichen Betrachtung des Menschen. Das Fazit fasst die Ergebnisse zusammen.
Welche Rolle spielt Helmut Plessners Philosophie in der Arbeit?
Plessners philosophische Anthropologie dient als Gegenposition zur rein naturwissenschaftlichen Betrachtung des Menschen. Zentrale Konzepte wie die „Doppelnatur des Menschen“ und die Kritik an einer rein mechanistischen Sichtweise werden diskutiert, um die Grenzen der neurowissenschaftlichen Perspektive aufzuzeigen und die Komplexität des Menschseins zu betonen.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Schlüsselwörter sind: Philosophische Anthropologie, Hirnscanner, Neurowissenschaften, Verdinglichung, Objektivierung, Ethik, Lernen, Erfahrung, Helmut Plessner, Bioethik, menschliches Selbst.
Welche methodischen Ansätze werden verwendet?
Die Arbeit verwendet eine kritische Auseinandersetzung mit neurowissenschaftlichen Erkenntnissen und setzt diese in Beziehung zur philosophischen Anthropologie. Es werden die Grenzen und Möglichkeiten beider Perspektiven beleuchtet und ethische Implikationen diskutiert.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für alle, die sich mit den ethischen Implikationen der Anwendung neurowissenschaftlicher Methoden, der philosophischen Anthropologie und der Beziehung zwischen Naturwissenschaft und Geisteswissenschaft auseinandersetzen. Sie ist besonders interessant für Studierende und Wissenschaftler der Philosophie, Ethik, Neurowissenschaften und Bioethik.
- Quote paper
- Martin Gloger (Author), 2020, Hirnscanner versus nichtverdinglichtes Selbst. Das Menschenbild in der Bioethik und die philosophische Anthropologie, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/580632