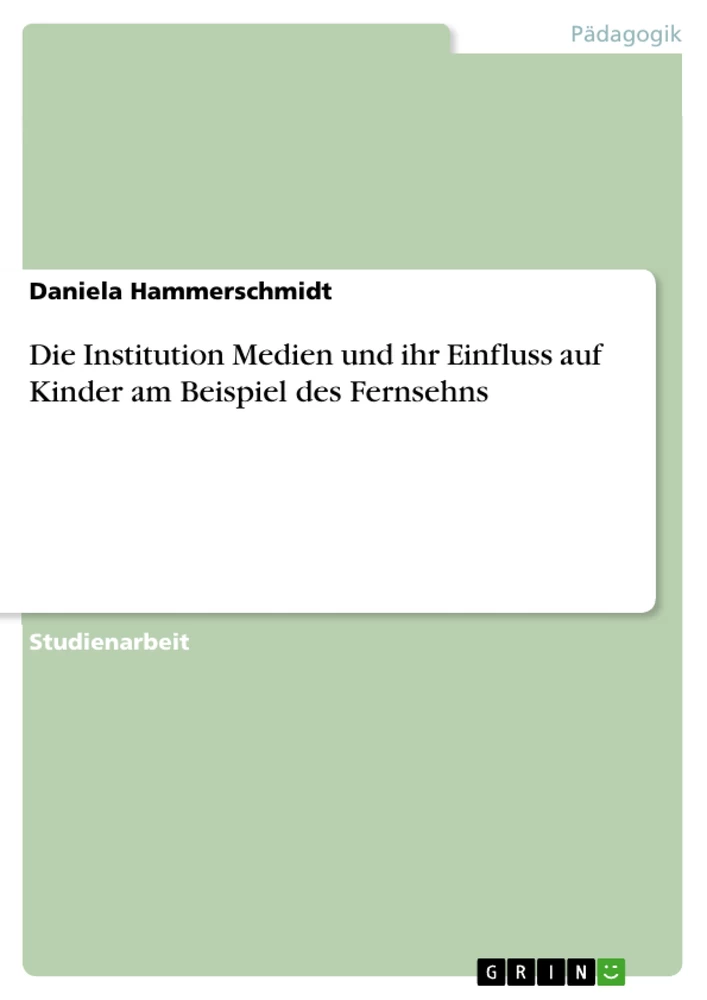Es ist Montag Morgen 06:30 Uhr: Der Radiowecker klingelt. Während dem Duschen wird Radio gehört, danach werden beim Frühstück noch schnell die neusten Nachrichten im Fernsehen angeschaut. Auf dem Weg zur Arbeit ertönt bereits beim Anschalten der Zündung das Radio, welches diesen Weg jeden Tag etwas erträglicher zu machen scheint. Auf der Arbeit angekommen wird zunächst einmal in das Email-Postfach gesehen und die erhaltenen Emails schnell beantwortet. Informationen, die zum Arbeiten benötigt werden, wie z.B. Telefonnummern oder Adressen sowie Informationen über andere Firmen, können schnell über das Internet abgerufen werden. Spätestens in der Frühstückspause wird die Tageszeitung gelesen und zur Erholung nach einem anstrengenden und harten Arbeitstag wird entweder ein Buch gelesen oder auch etwas ferngesehen und nicht selten dabei eingeschlafen- So oder ähnlich sieht der Alltag vieler Menschen zumindest in den westlichen Ländern aus. Er ist bestimmt durch Medien. Gerade durch diese Bestimmung des Alltags in der modernen Gesellschaft durch Medien werden die Ursachen für gesellschaftliche Probleme in der öffentlichen Diskussion oft bei den Medien gesucht. Der Ulmer Hirnforscher Professor Manfred Spitzer ist zum Beispiel der Meinung, dass das Fernsehen durchaus negative Folgen sowohl auf die Gesundheit als auch auf die schulische Leistungsfähigkeit hat. Diabetes, Bluthochdruck und Arteriosklerose resultierten unter Anderem aus einem hohen Fernsehkonsum. Dass Fernsehen auch gewalttätig mache, führt Spitzer auf die angebliche Botschaft vieler Fernsehsendungen zurück: „Gewalt gibt es häufig in der Welt, sie löst Probleme und hierzu gibt es keine Alternative, sie tut nicht weh, und der Gewalttäter kommt ungeschoren davon.“ Auch in der Politik wird immer wieder über die Folgen von Fernsehen, Computerspiele und vor allem auch über Gewaltdarstellungen in Medien diskutiert. Sowohl nach dem Massaker an der Columbine High School in den USA, bei welchem die Schüler Eric Harris und Dylan Klebold am 20. April 1999 insgesamt 13 Menschen und sich selbst töteten, als auch nach dem Amoklauf von Robert Steinhäuser an dem Erfurter Gutenberg- Gymnasium wurde in der Politik nach Ursachen gesucht. Bayerns Ministerpräsident Edmund Stoiber forderte damals zum Beispiel erneut ein Verbot von Gewaltdarstellungenin Videosund Computerspielen, da diese als Grundlage oder auch als Vorbild für solche Taten dienten bzw. diese förderten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Hinführung zum Thema
- Gründe für die Wahl des Themas
- Die Geschichte der Institution Medien
- Sozialisation durch Medien
- Mediensozialisation
- Herleitung des Begriffs der Mediensozialisation
- Ansätze zur Mediensozialisation
- Das durch die Medien vermittelte Menschenbild und dessen Folgen
- Mediensozialisation
- Erziehung
- Erziehung durch Medien
- Schulisches Lernen
- Lernsendungen im Fernsehen am Beispiel der „Sesamstraße\" und der ,,Teletubbies\"
- Erziehung in Medien am Beispiel “Supernanny“
- Erziehung durch Medien
- Gewaltdarstellung in Medien
- Gewalttheorien
- Kombination von Humor und Gewalt im Fernsehen und deren Folgen auf das Gewaltverständnis von Kindern
- Differenzierung von Realität und Fiktion
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert den Einfluss der Institution Medien auf Kinder, speziell am Beispiel des Fernsehens. Der Fokus liegt auf der Rolle der Medien in der Sozialisation von Kindern, der Vermittlung von Menschenbildern und der Frage, inwiefern Fernsehen erzieherische Funktionen erfüllen kann.
- Mediensozialisation und die Wirkungsweise von Medien auf Kinder
- Die Rolle des Fernsehens in der Bildung und Erziehung von Kindern
- Der Einfluss von Gewaltdarstellungen im Fernsehen auf das Gewaltverständnis von Kindern
- Die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion im Kontext von Fernsehprogrammen
- Die Frage, ob Medien primär negative oder positive Auswirkungen auf Kinder haben
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 1: Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas vor und begründet die Wahl des Fernsehens als Fokusmedium. Darüber hinaus wird ein kurzer historischer Überblick über die Entwicklung der Medien gegeben.
- Kapitel 2: Dieses Kapitel behandelt den Begriff der Mediensozialisation und untersucht die komplexe Beziehung zwischen Kindern und Medien. Es analysiert, wie Medienbilder das Menschenbild von Kindern beeinflussen können.
- Kapitel 3: Der Fokus dieses Kapitels liegt auf der erzieherischen Rolle von Medien. Dabei werden sowohl positive Beispiele wie Lernsendungen als auch negative Beispiele wie „Supernanny“ untersucht.
- Kapitel 4: Dieses Kapitel befasst sich mit der Gewaltdarstellung im Fernsehen und deren potenziellen Auswirkungen auf Kinder. Es werden verschiedene Gewalttheorien vorgestellt und die Bedeutung der Unterscheidung zwischen Realität und Fiktion hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Medien, Sozialisation, Kinder, Fernsehen, Gewaltdarstellung, Erziehung, Menschenbild, Lernsendungen, Realität, Fiktion, Mediensozialisation, Bildung.
Häufig gestellte Fragen
Wie beeinflusst das Fernsehen die Sozialisation von Kindern?
Medien vermitteln Rollenbilder, Werte und Verhaltensmuster, die tief in den Alltag eingreifen und die Wahrnehmung der Realität prägen.
Welche negativen Folgen von hohem Fernsehkonsum werden genannt?
Laut Hirnforschern wie Manfred Spitzer kann hoher Konsum zu Gesundheitsproblemen (Diabetes, Bluthochdruck) und geringerer schulischer Leistungsfähigkeit führen.
Können Fernsehsendungen auch einen erzieherischen Wert haben?
Ja, Lernsendungen wie die „Sesamstraße“ sind Beispiele für positive pädagogische Ansätze im Fernsehen.
Macht Fernsehen gewalttätig?
Die Arbeit diskutiert Gewalttheorien und die Frage, ob Gewaltdarstellungen als Vorbild dienen oder die Hemmschwelle herabsetzen, besonders wenn Gewalt humorvoll dargestellt wird.
Was ist das Problem bei der Unterscheidung von Realität und Fiktion?
Gerade jüngere Kinder haben Schwierigkeiten, mediale Inszenierungen von der Wirklichkeit zu trennen, was die Wirkung von Medieninhalten verstärkt.
- Quote paper
- Daniela Hammerschmidt (Author), 2006, Die Institution Medien und ihr Einfluss auf Kinder am Beispiel des Fernsehns, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58085