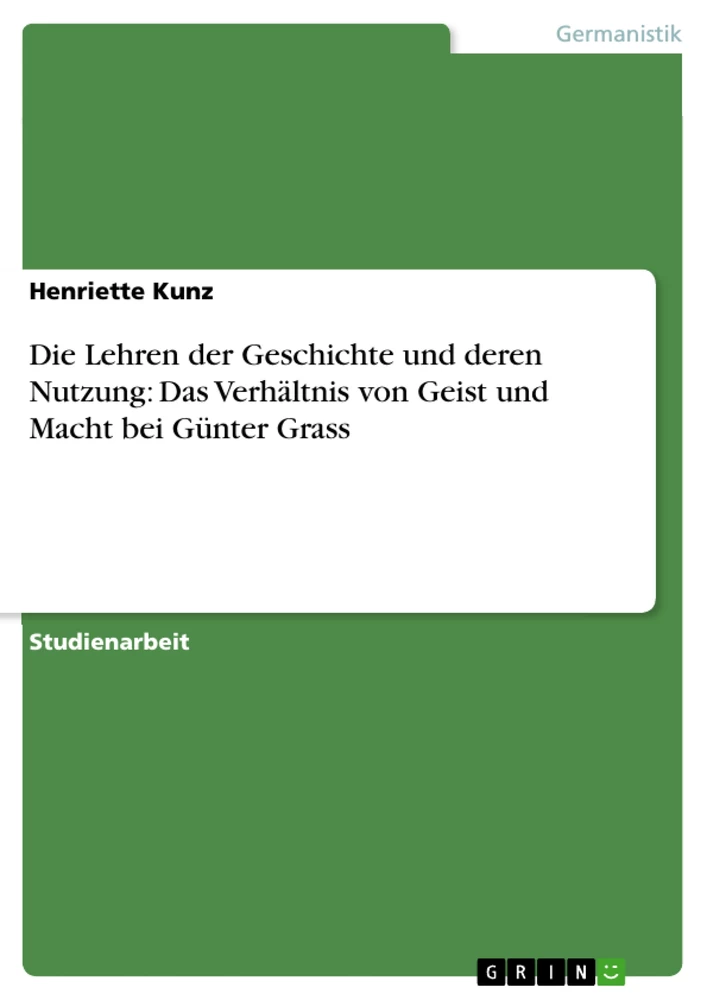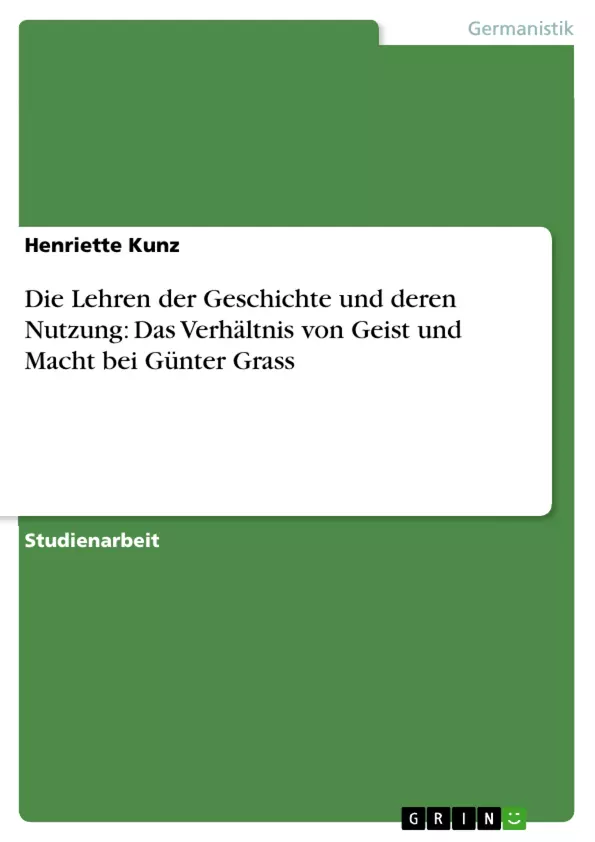Die in Deutschland schon traditionell anmutende Auffassung einer Divergenzideologie von Geist und Macht hatte vor allem in den fünfziger Jahren der Bundesrepublik Deutschland erneuten Aufschwung gefunden. So löste die in ihrem Umfang bis heute unikale Teilnahme des Autors und Grafikers Günter Grass am politischen Alltag in den sechziger Jahren ein sehr starkes Echo aus, da dies dem gewohnten Bild des deutschen Schriftstellers völlig zu widersprechen schien.
Die Überwindung solcher Bedenken führten bei Grass zu einem dezidiert sozialdemokratischen Politikverständnis, dessen Ursachen und besondere Konturen in der vorliegenden Arbeit nachgezeichnet werden.
Grass provozierte mit seiner bewussten politischen Stellungnahme eine Unterstützung seines Engagements und forderte damit zugleich die Aufhebung des alten Geist-Macht-Gegensatzes. Diese neuartige und kontroverse Auffassung wird anhand ausgewählter Schriften des Autors fokussiert. Da jedoch eine grundlegende Abhandlung seiner theoretisch-politischen Konzeption fehlt, war hierbei der Rückgriff auf die einzelnen Reden, die im Rahmen aktueller Bezüge entstanden, erforderlich.
Dem vorangestellt sind jedoch auch die Ursachen der auch von Grass selbst formulierten Schwierigkeiten eines Schriftstellers bei der politischen Positionsfestlegung, ein elitäres Zögern, dass aus einer Haltung hervorgeht, die die Poesie als „rein“ und die Politik als „schmutzig“ begreift und so den Literaten losgelöst von jeglicher Bindung dieser Art sieht.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Versuchungen des Absoluten: Schwierigkeiten bei der politischen Positionsfestlegung
- III. Die Lehren der deutschen Geschichte: Politisches Selbstverständnis
- IV. Der Typus des „,engagierten Autors\": Die Überwindung des alten Geist-Macht-Gegensatzes
- V. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht das Verhältnis von Geist und Macht bei Günter Grass, insbesondere seine politische Positionierung im Kontext der Nachkriegsgeschichte Deutschlands. Sie analysiert Grass' Engagement im Spannungsfeld zwischen Literatur und Politik und beleuchtet die Überwindung des traditionellen Geist-Macht-Gegensatzes, den er in seinen Werken thematisiert.
- Günter Grass' politisches Engagement und seine Motivation
- Die Überwindung des traditionellen Geist-Macht-Gegensatzes in Grass' Werken
- Das Verhältnis von Literatur und Politik im Nachkriegsdeutschland
- Die Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft
- Grass' Kritik an der deutschen Geschichte und Politik
Zusammenfassung der Kapitel
- I. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik ein und skizziert die historische und literarische Situation in Westdeutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere im Hinblick auf das Verhältnis von Schriftstellern zur Politik.
- II. Versuchungen des Absoluten: Dieses Kapitel beleuchtet die Schwierigkeiten, die sich für Schriftsteller bei der politischen Positionsfestlegung ergeben. Es analysiert die Gründe für das Zögern von Schriftstellern, sich politisch zu engagieren, und die Entstehung des "elitären Zögerns".
- III. Die Lehren der deutschen Geschichte: In diesem Kapitel wird Grass' politisches Selbstverständnis im Kontext der deutschen Geschichte analysiert. Es werden die Einflüsse der Vergangenheit auf seine Werke und seine Kritik an der Politik der Bundesrepublik untersucht.
- IV. Der Typus des „,engagierten Autors": Dieses Kapitel fokussiert auf die Überwindung des traditionellen Geist-Macht-Gegensatzes in Grass' Werk. Es analysiert seine Schriften, in denen er sich aktiv für ein sozialdemokratisches Programm einsetzt und seine Rolle als "engagierter Autor" reflektiert.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Schlüsselthemen des Verhältnisses von Geist und Macht, politischem Engagement, Literatur und Politik, der deutschen Geschichte und der Rolle des Schriftstellers in der Gesellschaft. Sie analysiert die Werke von Günter Grass, insbesondere seine Reden und seine politische Agitation im Kontext der Nachkriegsgeschichte. Die Arbeit betrachtet die Überwindung des traditionellen Geist-Macht-Gegensatzes und untersucht die Gründe für Grass' sozialdemokratisches Politikverständnis.
Häufig gestellte Fragen
Worum geht es im Verhältnis von Geist und Macht bei Günter Grass?
Die Arbeit untersucht die Aufhebung des traditionellen Gegensatzes zwischen Poesie (Geist) und Politik (Macht) durch Grass' aktives politisches Engagement.
Welches Politikverständnis vertritt Günter Grass?
Grass entwickelte ein dezidiert sozialdemokratisches Politikverständnis, das er in Reden und Schriften aktiv vertrat.
Warum zögerten deutsche Schriftsteller traditionell bei der Politik?
Oft herrschte eine Haltung vor, die Poesie als „rein“ und Politik als „schmutzig“ begriff, was zu einem elitären Zögern führte.
Welche Rolle spielt die deutsche Geschichte in Grass' Werk?
Die Lehren aus der deutschen Geschichte sind zentral für Grass' politisches Selbstverständnis und seine Kritik an der Bundesrepublik.
Was zeichnet den „engagierten Autor“ nach Grass aus?
Ein engagierter Autor überwindet die Trennung von Literatur und Gesellschaft und nimmt bewusst am politischen Alltag teil.
- Arbeit zitieren
- Henriette Kunz (Autor:in), 2006, Die Lehren der Geschichte und deren Nutzung: Das Verhältnis von Geist und Macht bei Günter Grass, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/58120